Special queer
Editorial
Bezugnahmen auf das kurze Titelwort queer – in der Eigenschaft einer uneinheitlichen, nicht definitorischen Gruppen-Bezeichnung – sind derzeit verschiedentlich anzutreffen, in negativer Form zumal. Allerdings mit der Besonderheit, dass es Mode geworden zu sein scheint, Worte für ihr Bezeichnetes, sogar Referenziertes, zu halten und zur Aktion zu rufen.
Fertig machen! Platt machen! Was sollte anderes geantwortet werden als „So nicht!“
Aber wie?
_ _ _ _ _
/\ \ /\_\ /\ \ /\ \ /\ \
/ \ \ / / / _ / \ \ / \ \ / \ \
/ /\ \ \ \ \ \__ /\_\ / /\ \ \ / /\ \ \ / /\ \ \
/ / /\ \ \ \ \___\ / / // / /\ \_\ / / /\ \_\ / / /\ \_\
/ / / \ \_\ \__ / / / // /_/_ \/_/ / /_/_ \/_/ / / /_/ / /
/ / / _ / / / / / / / / // /____/\ / /____/\ / / /__\/ /
/ / / /\ \/ / / / / / / // /\____\/ / /\____\/ / / /_____/
/ / /__\ \ \/ / / /___/ / // / /______ / / /______ / / /\ \ \
/ / /____\ \ \/ / /____\/ // / /_______\/ / /_______\/ / / \ \ \
\/________\_\/\/_________/ \/__________/\/__________/\/_/ \_\/
Schreiben lässt sich queer dann wohl noch am schönsten in einem alten Text-to-ASCII-Art-Generator in der Schrifttype namens impossible, in Erinnerung an eine Zeit anderer Moden. Damit das Wort lesbar wird, oder auch wieder in Serien von verschieden geneigten Slashes, Leerzeichen, Gedankenstrichen und Umbrüchen zerfällt, gilt es, das Browserfenster auf die passende Breite einzustellen und das Denken am Leben zu halten.
Oder es heißt vielleicht auch zu zitieren: „For queerness can never define an identity, it can only ever disturb one.“ (Lee Edelman, No Future: Queer Theory and the Death Drive, 2004)
Großzügiges Gebrauchen eines alten Kampfwortes, das weniger Identität, noch nicht einmal eine oppositionelle, zu versprechen hat – eher die Bewegung, die aus einer Unmöglichkeit kommt –, hat auch diese Spezialausgabe im Culturmag motiviert. Eine impossible oppositional position, – ii, ooo, pooo, im pooo, oppo pop poo, na, Post ab, si. Si, sit, io. Sitzt, wie’s einem Treffer nachgesagt wird. Sie lädt ein, Unzeitgemäßes, vor und rückschauend, stockend, solidarisch wiederzuentdecken und neu mit zu erfinden.
Sit In!
Die hier miteinander platzierten Beiträge stammen aus einer weiten Zeitspanne und reichen bis an die Jahrtausendwende und dort mehrfach bis in Zeiten des Cyberfeminismus <http://www.obn.org>, <https://www.faces-l.net/> samt angewandter Medientheorie, zurück. Diese stehen in Verbindungen zu neuen und ganz neuen Bearbeitungen von queer in Texten, Bildern, Filmen, Tönen.
Ein operationaler Knotenpunkt der queer-Bezüge, avant und après la lettre, findet sich in der Arbeit des Frauen.Kultur.Labor. thealit in Bremen. Aus Diskussionen, Vorträgen, Auftritten und Publikationen (ja, wir sind auch ein Verlag!) sind die aktuellen und potentiellen Linien dieser dynamischen Konstellationen entstanden, die es hier zu entdecken und zu testen gibt.
Hält die kritische Verbindung zu queer über den Feminismus, Cyber-, Philosophie, Pychoanalyse, über die Kunst und Literatur?
Die möglichen Einstiege lassen sich anhand der einzelnen Beiträge vielleicht so bewerkstelligen:
 Andrea Braidt: Queer Art – Prohibit the Adjective.
Andrea Braidt: Queer Art – Prohibit the Adjective.
Diese entschlossene Parteinahme in drei Paragraphen samt konstruktiven Vorschlägen gegen den allzu plumpen Gebrauch des Adjektivs queer von denjenigen, die sich vielleicht unter diesem taktischen Adjektiv versammeln mochten, räumt erst einmal den Tanzplatz frei.
Erinnert wird an eine einmal elegante, dann zu häufig und schlecht kopierte Tanzfigur: Eine Bedeutungsdrehung an einem einstigen Schimpfwort, insbesondere gegen männliche Homosexuelle hatte nämlich schon etwa 20jährigen Geburtstag gehabt: der „Shaming Term“ so schlug unter andern Judith Butler 1993 vor, sollte als „critically queer“ in affirmativer Selbstzuschreibung die Angreifer beschämen. Vorgetragen hat Andrea Braidt den Text im „quite queer“ Lab 2012, die hier publizierte Form geht auf die gleichnamige Buchveröffentlichung von 2014 aus dem thealit zurück, hier ein bloßes Zitat einer Papierform.
 Ulrike Bergermann: Manifesto #372, Delete the Y Chromosome? Do the X?
Ulrike Bergermann: Manifesto #372, Delete the Y Chromosome? Do the X?
Dieses Manifest aus der Zeit der ersten cyberfeministischen Internationale auf der documenta x im Hybrid workspace 1997 zurück. Dort flatterte den Mitgliedern des Old Boyz Network, unter anderem mir, dies gedankenschnelle utopische Manifest wie eine geworfene Papierschwalbe zu. Die Vorteile in einer cyberfeministischen Gründungsphase sind offenkundig: Medientheorie und aktivistischer Techno-Feminismus werden über die Frage der Repräsentation literarisch verbunden und das, was das fem- in dem Cyber-F-Wort ist mal kurzerhand hybridisert zu einer Figur, die in verschiedenen Registern zu spielen, äh, zu implementieren wäre. XXX
 Moritz Simons: Manifest Hybrosexueller Freiheit
Moritz Simons: Manifest Hybrosexueller Freiheit
Noch ein Manifest, weder queer-avoiding noch Cyberfeminismus verquert verkreuzend, sondern eines, das heute und jetzt Freiheit will und ein neues Wort dafür entwickelt: hybrosexuell … Das Manifest ist definitely not amused über den nicht nur anhaltenden sondern sich verfestigenden Heterosexismus heute. Dieser Beitrag fängt nochmal von vorne an, macht hier den dritten Anfang, und behauptet eine Fluidität des Geschlechts mit der Stärke eines starken Wunsches. Als Performance hielt Moritz Simons das Manifest 2017 mithilfe zweier Megaphone auf dem abendlichen Bürgersteig vor thealits Aktionsraum, auf einer belebten Bremer Straße – im Rahmen des Labs DEBATTERIE! Antagonismen aufführen. Dazu gibt es ein Video , dem ich asynchrone Elemente im Spiel der alten Paarbeziehung sound und image hinzugefügt habe.
 Rae Spoon: Armour
Rae Spoon: Armour
Dieser Beitrag kommt schon als ein Video, in Form eines nachdenklichen Lieds von einer transgender Person, die in einem Buch (mit Ivan E. Coyote) Gender Failure schon mal „Gender Retirement“ vorschlug. Rae Spoon nimmt das Format Lyric Video ernst und zeigt die Zeilen ihres*, seines* Lieds Armour von 2016 (aus dem gleichnamigen Album) in einer seltsamen schwankenden Spanne im Nirgendwo zwischen synchronem Mitlesen und Mitsingen. „On our bodies we wear armour / we can’t tell where which one ends“. Verdichtet in einer beunruhigenden Leere, wo die Stimme noch nicht oder doch schon irgendwie aktiviert ist, führt die vermeintliche Verdopplung von Hören und Lesen eine Unterbrechung ein, die der Irritation durch suchenden Kamerabewegungen in einem pink gefärbten Birken-Gestrüpp irgendwie zu ähneln scheint. Unterstützt wird dies sich selbst bei den Betrachtenden anwendende Verfahren durch einen digitalen Analog-Fake, den einer verschwommenen Bildgrenze wie bei einem alten Kamera-Sucher oder alter filmtechnischer Projektion. Ich ist nur ein Rahmen, äh, nun ja, Rahmen-Fake.
 Susanne Lummerding: So, if man is perhaps simply a woman who thinks that she does exist, … ; phantasm, symptom, and the political
Susanne Lummerding: So, if man is perhaps simply a woman who thinks that she does exist, … ; phantasm, symptom, and the political
Hier kommt ein Vorschlag, der theoretischen und analytischen Art von Susanne Lummerding, der die 4 Formeln zur Sexuierung des „tout fou Lacan“ (Libération, 1981) probiert für politische Anwendungen bereitzumachen. Denn schon seit 1971 wurde von dem französischen Psychoanalytiker unter Einsatz von Existanzquantor, Allquantor und deren jeweiligen Verneinungen 4 Subjektpositionen in Relation zur phallischen Funktion und dem sexuellen Genießen entwickelt, zwei „weibliche“ und zwei „männliche“! Wie queer**** ist das denn? Ebenso dessen damit einhergehende Behauptung „la femme n’existe pas“ …
Susanne Lummerdings Text von 2006, vorgetragen im thealit trans European Lab do not exist: europe, woman, digital medium, ließe insofern mühelos z.B. einen derzeitigen Akteur im Spektakel des Politischen, in der Funktion des President of the United States, in seiner obszönen, großmäuligen Selbstinszenierung als phantasmatisch entziffern: Jemand, der eine einzigartige Position beansprucht, nämlich der „sich selbst freien Sexualgenuß vorbehält“ (Sigmund Freud) und somit über dem Gesetz stünde, wie Freud’s fiktiver Urvater einer ebenso fiktiven Urhorde: Dessen exception, kann flugs als deception erkannt werden. Allerdings ebenso wie die Position eines Außen, die glaubte erkennen zu können, dass alle x der phallischen Funktion, und damit der Kastration unterliegen. Hier führt der Text über gängige Oppositionen von Täuschung/Medialität gegenüber Realität souverän hinaus und bietet Erholung von derzeitigen populistischen Verteidigungsversuchen gegenüber „Fake News“.
(Schwerer könnte es dessen einleitende Behauptung haben, die besagt, dass das Konzept des thealit Labs „amounts to an argument that exclusively refers to the socio-symbolic level”.)
 Miglena Nikolchina: Between Irony and Revolution, Sexual Difference and the Case of Aufhebung
Miglena Nikolchina: Between Irony and Revolution, Sexual Difference and the Case of Aufhebung
Diese inspirierte Analyse dessen, was eine russische Übersetzung des eigentlich unübersetzbar vielschichtigen Hegelschen Begriffs der Aufhebung (in der dialektischen Vermittlung von These und Antithese zur Synthese) an Verschiebungen der Bedeutung transportiert haben könnte, ist ein Must Read für alle, die sich von queerNOTquerer Seite der Frage der Revolution nähern wollen und auf eine Position neugierig sind, die sich an der Über(determinierten) Kreuzung von Philosophie, politischer und feministischer Theorie am leuchtenden Punkt der Sprache erfinden lässt.
Es ist das russische Wort snyat’, bzw. Snyatie, das als Übersetzung des deutschen Wortes Aufheben in Gebrauch ist und das gegenüber der Aufwärtsbewegung die das deutsche Verb mittransportiert, die Bedeutungen eines Herunterreißens und Stürzens mit sich trägt: “may refer to the more or less decisive or energetic removal of barriers, obstacles, taboos, limitations, differences, bans, responsibilities, charges, classes, chiefs, royal persons, gods”, wie Miglena Nikolchina schreibt, sogar bis dahin, dass snyatie zusätzlich orgasmische Entladung und sexuelle Erleichterung zu bezeichnen hat.
Was diese Un/Übersetzbarkeiten von Hegel zu Marx, zu Lenin, zu Derrida , zu Lacan zu Badiou, zu Judith Butler und Joan Copiec im philosophischen und politischen Weltgeschehen für eine Rolle gespielt haben könnten, wenn nur einmal davon ausgegangen wird, dass, wie Lacan konstatiert, der Phallus der Signifikant der Aufhebung sei, das liest sich spannend und ergreifend angesichts der Frage nach einer weiblichen Position in den einstigen Ostblockstaaten, als der nach einem unnennbaren Verlust in der postrevolutionären Melancholie der 2000er Jahre.
(Die hier publizierte Version des Aufsatzes ist eine Erweiterung eines Vortrags, den Miglena Nikolchina im thealits TransEuropean Lab do not exist: europe, woman, digital medium 2006 gehalten hat.)
 Anna Daučíková: Conversations with Ghosts
Anna Daučíková: Conversations with Ghosts
Dieses Zitat eines Beitrags der (Video)Künstler_in Anna Daučíková gibt Teile eines Archivs wieder, das „s_he“ in schriftlicher und bildlicher Aufzeichnung und punktuellen Dokumentation von Situationen und Begegnungen erstellt. Thematisiert sind in den notierten Situationen meist biographische Wendepunkte von nicht-heterosexuellen (oder gängigen heterosexuellen Normen genügenden Personen) im ehemaligen Ostblock, insbesondere der ehemaligen Sowjetunion. Systematisiert in Place, Persons, Situation und Notes, erscheinen in wenigen poetischen wie faktischen Worten die Ghosts, die der Titel nennt, wie sie Anna Daučíková aus Bekanntschaften sich kreuzenden Lebenslwegen begegnet sind. Die archvierten Notate zu den Ghosts geben nicht nur von sexuellen Biographien, sondern auch von deren Interdependenz etwa zu erfahrenener Kriminalisierung und Ableistung von Gefängniszeit und Zwangsarbeit Zeugnis. Die Fotografien, die den individuellen Situationen zugeordnet sind, werden im Beitrag wiedererkennbar: als Screenshots aus dem Film zu diesem Projekt, den Anna Daučíková 2012 in thealits quite queer Lab in einer Lecture Performance präsentierte. Anders als in der Buchpublikation quite queer kann hier der Film von Anna Daučíková eingangs ihres Beitrags gezeigt werden.
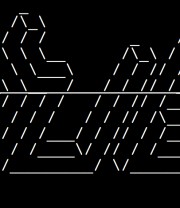 Warriors of Perception: Thoughts on Submission
Warriors of Perception: Thoughts on Submission
Die Warriors of Perception – aka Mistresses of Technology– sind mit einem Text von 2004 vertreten, der für die Publikation Cyberfeminsim.Next Protocols, gestaltet wurde, erschienen bei autonomedia, New York. Sie haben Protokolle einer kollaborativen digtialen Schreibszene in den frühen IRC Internet Relay Chats und andere literarische Produktionen zusammengestellt, mit Bildern, die teilweise die einstigen Benutzeroberflächen und Interfaces mit abbilden, teilweise mit ASCII Art arbeiten, wie sie die Visuals dieses Editorials inspiriert haben könnten. Die Mitglieder der Gruppe haben jeweils nicht nur einen Namen, sondern tauchen unter Identitäten aus der Kunst, des Aktivismus und aus Rollen in diesen literarischen Universen der multiplizierten Identitäten der Chats auf. Efemera, Discordia, Liquid_Nation, Plastique, Efemera_Clone_2 sind auch Diane Ludin, Agnese Trocchi, Francesca da Rimini, Julietta Aranda und Ricardo Dominguez. Aus den Praxen des Virtuellen und der gesteuerten Un/Kenntlichkeit der Akteure ergibt sich das Fehlen der sonst jedem Beitrag nachgestellten biographische Notiz. Beweglich und vieldeutig bleibt es, wie es den waghalsigen sprachlichen Verdichtungen dieser Praxis zukommt – mode on, mode off – sich entziehend, dabei maßlos nah und klar. Ein rares poetisches Gebilde, voll erotischer und widerständiger Überschreitungen, das in feministische und kapitalismuskritische Gedanken mitnimmt.
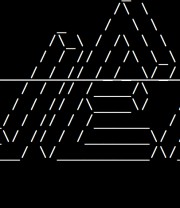 Elisabeth Strowick: Digitaler Akt, Interface-Körper. Überlegungen zu einer cyberfeministischen Ästhetik
Elisabeth Strowick: Digitaler Akt, Interface-Körper. Überlegungen zu einer cyberfeministischen Ästhetik
Den Thoughts on Submission schon im Buch Cyberfeminism, Next Protocols von 2004 benachbart, ist auch dieser Digitale Akt von Elisabeth Strowick wie ein etwas anders gearteter Drahtseilakt, in kühner Schwindelfreiheit, durch die Zeit herüberbalanciert. Die Vorschläge den performativen Akt als Artikulation einer chiastischen, sich verfehlenden Durchkreuzung von Sprache und Körper zu denken – ebenso inkongruent wie untrennbar verbunden – transferiert Elisabeth Strowick auf die chiastische Konstruktion eines Auftauchens und Verschwindens, wie sie das digitale Medium in der Konstruktion von 0 und 1 auszeichnet, was wiederum schon Jacques Lacan in der widersprüchlichen Schließung (eines Stromkreises) als Öffnung (des Stromflusses) anhand der Funktionsweise der Rechenmaschine Mitte der 1950er Jahre auffiel. Was passiert also, wenn weiter nach einer Performanz des Digitalen und der digitalen Differenz, strukturiert wie die Geschlechtsdifferenz, gefragt wird? Das disqualifiziert gleich reihenweise, fast könnte man sagen: automatisch, die Mehrzahl der damals wie heute grassierenden Theorien zur Virtualität und Immaterialität (respektive gegenteiliger Eigenschaften) des Digitalen! Hier mehr zu verraten könnte nur spoil sports einfallen, aber noch kurz angemerkt: Der Aufforderung Do X! aus Ulrike Bergermanns Manifest #372 hat sich dieser Text angenommen.
 Christina Goestl: Viva La Vulva !¡!¡!¡!
Christina Goestl: Viva La Vulva !¡!¡!¡!
Als eine künstlerische Umsetzung der hier in einigen Beiträgen wiederkehrend geforderten performativen Durchkreuzung von Digitalität und Geschlechtsdifferenz könnte die hier zitierte und verlinkte Arbeit der Netzkünstlerin Christina Goestl angeschaut werden. Oder auch, mit verblüfft geöffnetem Mund, als eine besonders untergründige, verstörende Art einer sexuellen Darstellung … In schnelle Bewegung versetzte Bilder typographischer Satz- und Steuerzeichen für die Zwecke einer feministischen Aufklärung über blinde Flecken im Reiche der Technik wie der weiblichen Physiologie des körperlichen Genießens, das könnte die Arbeit sein. Eine Materialität der kulturellen und technologischen Zwischenräume ist hier schon 1998 zu lesen und zu bearbeiten unternommen worden, der auch die anderen Arbeiten Christina Goestls korrespondieren, insbesondere bei der Wissenssammlung und Realisierung von Klitorismodellen, die nicht zur, sondern in der Differenz von Digitalem und Analogem, Anatomie und Lust, Lebendem und Totem forschen.
„I am your Clitoris!“, so sagte sie einmal in einer Performance Lecture im thealit, was gekonnt vor- und angebracht war.
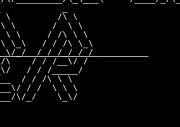 Andrea Sick: Standard Queer. Effekte intermedialer Verwicklungen am Beispiel von Beth Ditto
Andrea Sick: Standard Queer. Effekte intermedialer Verwicklungen am Beispiel von Beth Ditto
Was Sie schon immer über die Vermainstreamung und Standardisierung von ‚queer’ wissen wollten, und nicht zu fragen wagten, das tut Andrea Sick in diesem Text zu der lesbischen und 2012 schon in der großen, bunten Medien- und Geschäftswelt angekommenen Sängerin Beth Ditto. Das Grund-Paradox des Systems Mode gilt auch für queer. Mode braucht Authentizität samt widerständigen Normüberschreitungen, um, diese Eigenschaften, sobald zu Merkmalsgruppen zeichenhaft fixiert, einhergehend mit deren instantaner Verkehrung ins Gegenteil, zu vermarkten. Die sich in der heutigen Modewelt kreuzenden Aufzeichnungs-, Austausch und Vervielfältigungsmechanismen beschleunigen dabei diese Funktionsabläufe und das recht gierige Interesse an queer, wie beispielsweise in der Individualität Beth Dittos dingfest gemacht, wirkt zum einen systemerhaltend, aber nicht nur … Auch dieser Text nahm im quite queer Lab des thealit Frauen.Kultur.Labor. 2012 seinen Ausgangspunkt.
Wie nun mit der eingangs thematisierten und, im Verhältnis zu 2012, gewandelten, entstehenden ‚Mode’ gegenüber Queers umzugehen wäre? Aus den Arbeiten dieses Specials queerNOTqueer, die jeweils eine impossible oppositional position einnehmen, heißt es das zu lesen.
Allen Autor*innen danke ich für die großzügige Erlaubnis zum (Wieder)abdruck, für Neubearbeitungen und die neuen Arbeiten! Dank auch an LG Beard für den Font „Impossible“!
_____________
Claudia Reiche ist Künstlerin und Medienwissenschaftlerin, die probiert mit Theorie Kunst zu machen und mit Kunst Theorie.
Sie arbeitet über Kulturen des Digitalen und deren epistemologische, ästhetische und politische Effekte und ist in mehreren weiblichen und queeren Projekten engagiert, die die Grenzverläufe von Kunst und Wissenschaften verzeichnen. (Im thealit Frauen.Kultur.Labor Bremen ist sie sie seit 1993 in konzeptueller und organisatorischer Funktion tätig, gemeinsam mit Andrea Sick) Sie lehrt derzeit an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Theorie und Geschichte gegenwärtiger Medien. In CulturMag erschien von ihr im Rahmen des Special ESSAY Special der lyrische Essay FUNNYSORRYANGRYANONYMOUS.CLOWNS.












