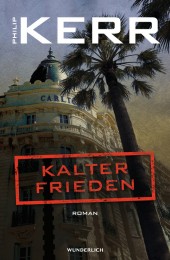 „Ich arbeite zwischen den Zeilen der Geschichte“
„Ich arbeite zwischen den Zeilen der Geschichte“
„Kalter Frieden“, die Übersetzung von „The Other Side of Silence“ erlebte er noch als Rohexemplar, aber er starb – mit 62 viel zu jung – bevor das Buch nun in die deutschen Buchhandlungen kommt. Es ist das elfte seiner insgesamt 13 Bücher mit dem Privatdetektiv und ehemaligen Berliner Kriminal-oberkommissar Bernhard „Bernie“ Gunther. Es waren bei weitem nicht seine einzigen Romane. Philip Kerr wird vermisst werden.
Andreas Pflüger schrieb uns:
Um eine Stimmung zu beschreiben, braucht man Gefühl. Um Action zu kreieren, braucht man Poesie. Für erstklassige Dialoge sollte man beides haben, außerdem Humor, Präzision und ein Händchen für Rhythmus. Nichts von alldem lernt man an der Uni. Dazu muss man die Bücher von Philip Kerr lesen. Ein großer Verlust.
Auch CrimeMag-Autor Marcus Müntefering war „großer Kerr-Anhänger seit dem Wittgenstein-Programm und trotz vieler wirklich mieser und mittelmäßiger Bücher (Game Over, Der Plan, die Fußball-Trilogie…). Aber die Gunthers (und vor allem die der zweiten Phase) sind für mich heilig… gerade im Vergleich mit solch mittelmäßigen Figuren wie Vo….“ – hier schweigt des Sängers Höflichkeit.
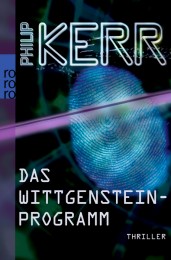 Der deutsche Verlag von Philip Kerr hat innerhalb seines Nachrufs einen historisch chronologisch (und nicht nach Erscheinungsdaten) sortierten Überblick auf die Bernie-Gunther-Reihe.
Der deutsche Verlag von Philip Kerr hat innerhalb seines Nachrufs einen historisch chronologisch (und nicht nach Erscheinungsdaten) sortierten Überblick auf die Bernie-Gunther-Reihe.
Wir zitieren zum Abschied die erste Seite aus „Kalter Frieden“ und veröffentlichen noch einmal das Interview, das Alf Mayer 2014 mit ihm geführt hat.
Französische Riviera, 1956
Gestern habe ich versucht, mich umzubringen.
Nicht weil ich unbedingt sterben wollte, sondern damit der Schmerz endlich verging. Elisabeth, meine Frau, hatte mich vor einer Weile verlassen, und ich vermisste sie sehr. Das war eine Ursache für den Schmerz, eine ziemlich gewichtige, wie ich zugeben muss. Selbst nach einem Krieg mit mehr als vier Millionen toten deutschen Soldaten sind deutsche Frauen nicht leicht zu bekommen. Ein anderer großer Schmerz in meinem Leben war natürlich der Krieg selbst, und das, was danach in den sowjetischen Kriegsgefangenenlagern mit mir passiert war. Was meine Entscheidung, Suizid zu begehen, vielleicht eigenartig erscheinen lässt, wenn man bedenkt, wie schwer es war, nicht in Russland zu sterben; andererseits war der Wille, am Leben zu bleiben, für mich schon immer mehr eine Gewohnheit als eine aktive Wahl.
Während der Jahre unter den Nazis beispielsweise war ich nur aus schierer Sturheit am Leben geblieben. Also frag- te ich mich eines Morgens, warum dem nicht ein Ende machen? Für einen Goethe liebenden Preußen wie mich war die schlichte Rationalität einer solchen Frage geradezu bestechend. Abgesehen davon – es war nicht so, als wäre mein Leben noch besonders schön gewesen, auch wenn ich ehrlich gesagt nicht sicher bin, ob es das jemals war. Morgen und die langen, langen leeren Jahre danach sind nichts, was mich sonderlich interessiert hätte, erst recht nicht hier unten an der französischen Riviera. Ich war allein, ging auf die sechzig zu und verrichtete in einem Hotel einen Job, den ich im Schlaf beherrschte – nicht dass ich dieser Tage viel davon abbekommen hätte. Die meiste Zeit fühlte ich mich miserabel. Ich lebte irgendwo, wo ich nicht hingehörte, und es fühlte sich an wie eine kalte Ecke in der Hölle – ich glaubte also nicht, dass irgendjemand, der sich an einem sonnigen Tag erfreut, die dunkle Wolke vermissen würde, die mein Gesicht war.
All das sprach dafür zu sterben, plus die Ankunft eines Gastes im Hotel. Eines Gastes, den ich wiedererkannte und den ich lieber vergessen hätte…
Aus:
Philip Kerr: Kalter Frieden (The Other Side of Silence, 2016). Aus dem Englischen von Axel Merz. Wunderlich, Reinbek bei Hamburg 2016. 396 Seiten, Hardcover, 22,95 Euro. Verlagsinformationen. Mit freundlicher Genehmigung.
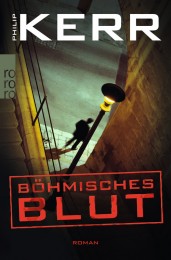 Ein Interview mit Philip Kerr
Ein Interview mit Philip Kerr
Alf Mayer: Ich nehme an, Sie sprechen fließend Deutsch?
Philip Kerr: Leider gar nicht, nicht im Geringsten. Gesprochenes Deutsch kann ich zwar ziemlich gut verstehen, aber ich bin doch eher Germanophiler als Sprachkundler. Deutschland mochte ich immer schon, ganz besonders Berlin.
AM: Können Sie mir ein oder zwei große deutsche Leseerfahrungen nennen?
PK: Ich kann Ihnen meine drei deutsch-österreichischen Lieblingsbücher nennen, gelesen aber habe ich sie auf Englisch. Es sind der „Tractatus“ von Ludwig Wittgenstein, „Der Zauberberg“ von Thomas Mann und „Steppenwolf“ von Hermann Hesse.
AM: Erinnern Sie sich, wie Bernie Gunther seine Existenz bekam?
PK: Das ist schon eine Weile her. Späte 1980er. Ich wollte einen Roman schreiben über normale Deutsche, die keine Nazis waren. Vor allem aber wollte ich verstehen, möglichst genau verstehen, wie das, was geschah, passieren konnte. Mir schien es ein guter Weg, dafür einen Detektiv zu wählen. Im Nachhinein erscheint das fast ein wenig arrogant, aber wir Engländer hatten immer schon eine Liebesaffäre mit Berlin – Isherwood, Auden, Spender, Le Carré, Len Deighton und David Bowie, um ein paar zu nennen. Kein Berliner zu sein, das erschien mir nicht unbedingt als disqualifizierend, um über Berlin zu schreiben.
AM: Gab es irgendwo Einflüsse? Inspirationen?
PK: Nun, ganz bestimmt alles von beidem. Chandler, natürlich. Dürrenmatt, vermutlich. Ich war mir aber ganz sicher, dass meine Bücher anders als alle andere sein sollten. Ich wollte sie auf besondere Weise und eben einzigartig von Berlin sprechen lassen.
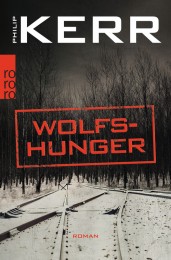 AM: Berlin vor dem Mauerfall – kannten Sie auch den östlichen Teil und wie dessen Bewohner waren?
AM: Berlin vor dem Mauerfall – kannten Sie auch den östlichen Teil und wie dessen Bewohner waren?
PK: Den Osten habe ich öfter besucht, meist auch der Komischen Oper wegen, weil sie erschwinglicher und besser war als die Berliner Oper. Wann immer ich heute die S-Bahn an der Friedrichstraße nehme oder Unter den Linden spaziere, erinnere ich mich, wie ich dasselbe 1988 getan habe. Nachts. Die Menschen von heute haben keine Vorstellung davon, wie verlassen Ost-Berlin um diese Zeit war. Was für ein Ödland. Ich bin voller Bewunderung, wie diese Stadt wiederaufgebaut worden ist. Andererseits sollte ich darüber nicht so verwundert sein, die Unverwüstlichkeit der Berliner ist schließlich historische Tatsache.
AM: Was ist ein Detektiv in einer totalitären Gesellschaft? So etwas wie die letzte Zuflucht für die Wahrheit?
PK: Ja, absolut. Ganz genau. Forensik lügt nicht. Vielleicht ist es auch die letzte Lizenz für eine bestimmte Form von Widerstand. Polizisten konnten Dinge sagen, die sich niemand sonst erlauben konnte. Bernie Gunther ist dafür ein gutes Beispiel, denke ich.
AM: Als sie Bernie nach fast 15 Jahren wiederbelebten, was hatte sich da verändert? Was war zum Bleiben bestimmt?
PK: Mich hat einfach sein Charakter wieder angezogen. Da war so viel mehr Material, von damals und erst recht nach der deutschen Wiedervereinigung. Und ich denke, da gab es eben auch meinen Appetit auf Berlin. Wenn ich könnte, würde ich dort leben. Vermutlich irgendwo im Grunewald, in einem dieser großen wilhelminischen Häuser am Rande eines Sees.
AM: Mittlerweile können Sie Bernie Gunther überall hin schicken und wir Leser würden es glauben – war das für Sie selbst auch eine Überraschung?
PK: Er ist eine Art Fliegender Holländer. Ich mag es, ihn rund um die Welt zu schicken, wenn es sich ergibt. Aber er ist ein Berliner. Das ist ein Bewusstseinszustand, also prägt immer Berlin diese Bücher.
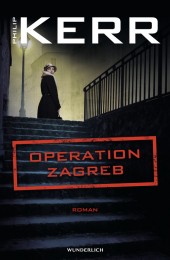 AM: Kann ich fragen, wie Sie ihre Bernie-Romane bauen?
AM: Kann ich fragen, wie Sie ihre Bernie-Romane bauen?
PK: Ich arbeite sozusagen zwischen den Zeilen der Geschichte. Das ist für mich die einzige Art, zu arbeiten. Ich brauche reale Fakten und reale Historie, um daraus Fiktion zu machen. Reale Personen ebenso, davon werden Sie immer viele in meinen Romanen finden. Das macht es interessant für mich selbst.
AM: Ja, und dann das vielleicht Erstaunlichste: Wie recherchieren Sie?
PK: Ich lese viel. Ich bin vor Ort. Sie werden mich oft im Hotel Adlon finden, im meiner bescheidenen Meinung nach besten Hotel der Welt. Ich diskutiere viel mit meiner Frau, die ebenfalls viel über Deutschland weiß und über Berlin geschrieben hat. Zurzeit entwickle ich so allmählich eine neue Geschichte.
AM: Gab es jemals ernsthafte Beschwerden?
PK: Keine ernsthaften. Die letzte Rüge, die ich erhielt, stammte von einem Mann aus München, der mir erklärte, dass in einem meiner Bücher die Trambahn auf einer bestimmten Münchner Route fälschlicherweise als Doppeldecker beschrieben worden war. Ich denke, es ist gut zu wissen, dass das Eindecker waren. Aber ist das etwas Ernsthaftes?
AM: Bekommen Sie Reaktionen von deutschen Lesern?
PK: Eher selten. Ich denke, die Deutschen wollen im Allgemeinen lieber mit der Zukunft vorankommen als zu viel Zeit mit dem Nachdenken über das Gestern verbringen. Die Engländer, denke ich, sind weit mehr an Geschichte interessiert als die Deutschen. Nicht umsonst zeigt die Geschichte uns, wie groß England einmal war. Deutschen ist so etwas vermutlich eher peinlich.
AM: Was können wir von Bernie in der Zukunft erwarten?
PK: Ich bin mir da noch nicht sicher.
AM: Gibt es Pläne, Bernie auf die Leinwand zu bringen?
PK: Ich hoffe es. (HBO, der amerikanische Kabelproduzent, der auch „Boardwalk Empire“ verantworte, hat für Tom Hanks die Filmrechte für die „Berlin Noir“-Trilogie gekauft.)
AM: Falls Bernie Gestalt annimmt, dessen Gesicht Sie ja niemals beschreiben, wer könnte das sein?
PK: Ich würde gerne Michael Fassbinder als Bernie Gunther sehen.
AM: Danke für Ihre Geduld.
PK: Pleasure.
Philip Kerr bei CrimeMag hier.
September 2014: Triff mich dann am Massengrab
Februar 2014: Polizist zu sein in dunkler Zeit











