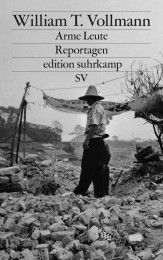 Wie real darf es denn sein?
Wie real darf es denn sein?
Die Reportagen von William T. Vollmann und der Vielen doch lieber vorsichtige Abstand zur Wirklichkeit.
Wir wollen unsere Literatur welthaltig, deshalb sind Bücher wichtig, die sich tatsächlich hinaus wagen in die Realität. „O-Ton“-Reportagen nennt man das dann gerne. Einer dieser Scouts, bei uns viel zu wenig als Instanz bekannt, ist der Amerikaner William Tanner Vollmann – bei CrimeMag 2013 anlässlich seines „Europe Central“ ausführlich porträtiert: „Wahrhaft dicke Bretter bohren.“ Alf Mayer, der selbst 2017 für ein „Schwarzbuch Rente mit 70“ quer durch Deutschland 50 nicht ganz so reiche Menschen interviewte und porträtierte, über William T. Vollmanns große Reportage „Arme Leute“.
„Nie werde ich den alten Mann in Tokio vergessen,
der einen Comic lesend auf dem Gehsteig saß und nach Urin stank.“ (WTV, 2007)
Aus dem Paradies vertrieben, „Expelled from Eden“, heißt ein Vollmann-Reader. Immer will er so viel wie nur möglich über eine Realität lernen, die er nicht kennt. Ob von Ausrottung bedrohte Indianerstämme, Guerillakämpfer in Afghanistan, Bettler in Thailand, Prostituierte in San Francisco, Erntearbeiter im kalifornisch-mexikanischen Imperial Valley, der Krieg gegen die Nez Perce, immer sind es vor allem die Underdogs, denen Vollmann eine Stimme verschafft – denen sein Interesse gilt. Und seine Poesie.
Als Journalist lebt er, bekennt er freimütig, von Magazinbeiträgen und Reportagen rund um den Erdball; unterwegs ist er dabei als Autor, der sich zum Lebensunterhalt wie ein Prostituierter verkauft und seine Texte nach Belieben verstümmeln lässt. Endgültige Form findet all seine Arbeit dann in den Büchern, für die er sich mit oft bescheidenen Honoraren zufrieden gibt, weiß er doch, dass seine Anforderungen an die Verlage gigantisch sind, den schieren Umfang und die Ausstattung, etwa alle seine eingestreuten, oft mit einer einfachen Lochkamera aufgenommen Bilder betreffend.
Das mit 448 Seiten vergleichsweise schlanke „Poor People“, für das WTV Menschen auf allen Kontinenten die gleiche Frage stellte, nämlich „Why are you poor?“ (Warum sind Sie arm?) enthält 128 Fotos seiner Interviewpartner. Zu „Imperial“, einer gewaltigen Studie zum kalifornisch-mexikanischen Ausbeuter- und Grenzgebiet, 1310 Seiten mit 120 Interviewten, erschien ein eigener, 210-seitiger Fotoband in einem anderen Verlag, weil Viking sich überfordert sah. Vollmanns gewaltiges Œuvre stellt aber nicht nur Verlage, sondern auch seine Leser vor größte Herausforderungen.
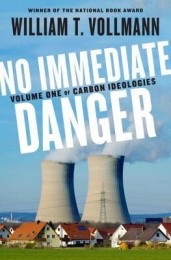 In den USA sind gerade von ihm zum Ende der Ära der fossilen Brennstoffe die „Carbon Ideologies“ mit zwei voluminösen Bände erschienen: „No Immediate Danger“ (602 Seiten) und „No Good Alternative“ (688 Seiten), den Anmerkungsapparat von 129.000 Worten gibt es nur online. Das Vorwort ist so etwas wie ein selbstgewählter Abgesang auf die Art von literarischer Expedition, wie Vollmann sie sein ganzes Schriftstellerleben lang betreibt. Kein Verlag, auch nicht der ihm am wohlsten gesonnene, könne sich wohl einen Autor wie ihn auf Dauer leisten. 1376 klein bedruckte (und höchst eindrucksvolle) Seiten hatte sein 2017 herausgekommenes „The Dying Grass. A Novel of the Nez Perce War“.
In den USA sind gerade von ihm zum Ende der Ära der fossilen Brennstoffe die „Carbon Ideologies“ mit zwei voluminösen Bände erschienen: „No Immediate Danger“ (602 Seiten) und „No Good Alternative“ (688 Seiten), den Anmerkungsapparat von 129.000 Worten gibt es nur online. Das Vorwort ist so etwas wie ein selbstgewählter Abgesang auf die Art von literarischer Expedition, wie Vollmann sie sein ganzes Schriftstellerleben lang betreibt. Kein Verlag, auch nicht der ihm am wohlsten gesonnene, könne sich wohl einen Autor wie ihn auf Dauer leisten. 1376 klein bedruckte (und höchst eindrucksvolle) Seiten hatte sein 2017 herausgekommenes „The Dying Grass. A Novel of the Nez Perce War“.
Um so erfreulicher, dass jetzt, erneut vom zuverlässigen Robin Detje übersetzt, die Reportagen „Arme Leute“ im Suhrkamp Verlag vorliegen. Dies sogar mit allen 128 Fotos der US-Originalausgabe, wenn auch nicht als Hardcover, sondern als Klappenbroschur. Zwar hat es mehr als zehn Jahre gedauert, bis das Buch jetzt zu uns gelangt ist – aber es ist eh zeitlos. Es schaut dahin, wo die Welt ganz unten ist. Und es fragt nach unserem Verhältnis dazu. Fast, möchte man sagen, unideologisch.
„Bist du arm?“ Die meisten von uns, meint Vollmann, würden die Frage ohne große Schwierigkeiten beantworten können. – „Warum bist du arm?“ Die Antworten armer Leute auf diese Frage sind in der Regel so ärmlich wie ihr Leben, notiert er.
Ein verdorrter Japaner saß im Lager am Flussufer auf seinem Fahrrad, die Füße auf dem Beton. Ich fragte ihn:
Warum sind manche Leute reich und andere arm?
Er lehnte sich zum Nachdenken an sein Fahrrad und sagte dann: Weil manche Arbeit haben und andere nicht.
Und ist das Glückssache oder hat es andere Gründe?
Wenn man älter wird, sagte er, und man will arbeiten, dann kann man es nicht. Die meisten von uns hier arbeiten schwer auf dem Bau. Ich sammle Müll im Park.
Ist die Arbeit schwer?
Ja, schwer …
Wir blickten einander an, und es gab nichts mehr zu sagen.
Wie einst Pasolini, einfach auf die Felder …
Immer wieder musste ich bei der Lektüre an einen wunderbaren Dokumentarfilm von Pier Paolo Pasolini denken. Für sein „Gastmahl der Liebe“ (Comizi d’amore, 1964) reist er von März bis November 1963 quer durch Italien, vom industrialisierten Norden bis zum archaischen Süden, befragt die Menschen an ihrem Arbeitsplatz oder in der Freizeit über die Liebe und über sexuelle Vorlieben, oft absichtlich naiv. Er sieht Erntearbeiterinnen auf dem Feld, hält sein Auto an, nimmt Tonband und Mikrofon und läuft munter zu ihnen hin, fragt sie, ob sie an den Storch glauben und erntet fröhliche Antworten. Er fragt Kinder, wie sie auf die Welt kommen, fragt Jugendliche am Badestrand, ob es in Italien sexuelle Freiheit gibt, was sofort ein munteres Durcheinander an Diskussion ergibt, fragt reife Männer, was sie über Homosexualität denken. Die scheinbare Naivität des Austauschs ist oft verblüffend tiefschürfend, feiert das Wunder des Kommunizierens. Pasolini hätten Vollmanns „kunstlose“ Fotos und seine Herangehensweise gefallen.
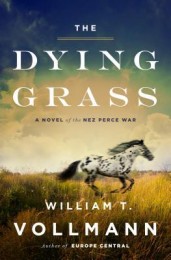 Wie immer bei Vollmann ist es erfrischend, wie er sich naheliegenden Erklärungen verschließt, dass er wenig Interesse an vorgezimmerten Weltbildern hat, dass er – wie ein guter Dokumentarfilmer – seine Protagonisten selbst sprechen lässt und überhaupt zum Sprechen bringt. Natürlich ist da auch Reflexion, natürlich arbeitet er sich an eingeübten Sichtweisen ab. Etwa an Adam Smith, der meinte: „Ein jeder Mensch ist reich oder arm in dem Grade, wie er imstande ist, sich die Bedürfnisse, Annehmlichkeiten und Vergnügungen des menschlichen Lebens zu beschaffen. Nachdem aber einmal die Teilung der Arbeit überall Eingang gefunden hat, kann eines Menschen eigne Arbeit ihn nur mit einem sehr kleinen Teil dieser Dinge versorgen.“
Wie immer bei Vollmann ist es erfrischend, wie er sich naheliegenden Erklärungen verschließt, dass er wenig Interesse an vorgezimmerten Weltbildern hat, dass er – wie ein guter Dokumentarfilmer – seine Protagonisten selbst sprechen lässt und überhaupt zum Sprechen bringt. Natürlich ist da auch Reflexion, natürlich arbeitet er sich an eingeübten Sichtweisen ab. Etwa an Adam Smith, der meinte: „Ein jeder Mensch ist reich oder arm in dem Grade, wie er imstande ist, sich die Bedürfnisse, Annehmlichkeiten und Vergnügungen des menschlichen Lebens zu beschaffen. Nachdem aber einmal die Teilung der Arbeit überall Eingang gefunden hat, kann eines Menschen eigne Arbeit ihn nur mit einem sehr kleinen Teil dieser Dinge versorgen.“
Vollmanns Essay über arme Leute ist in anderem Geist entstanden – er will weder die Armut nach irgendeinem System erklären noch ihr neben dem „Kapital“ auf dem Friedhof abgenagter Gedanken ein zweites Mahnmal errichten. Er kann nur von außen einen Blick darauf werfen. Seine Bekanntschaften sind zufällig und notwendigerweise oberflächlich. Die Interpretation der Selbstbilder der Helden und Heldinnen dieses Buches findet ihre Grenzen in der Kürze der Bekanntschaften, meist handelt es sich nur um eine Woche oder weniger. Trotzdem ist da viel mehr Hinschauen und viel mehr Nähe, als das sonst zu haben wäre. Vollmann ist jedoch immer klar: „Ich weiß, wie wenig ich weiß. Dennoch haben diese Schnappschüsse zufälliger Augenblicke in der Armutserfahrung armer Leute für mich Bedeutung von unschätzbarem Wert. Ich konnte über ihnen brüten, als meine Gesprächspartner mich schon lange vergessen hatten und das Geld, das ich ihnen gegeben hatte, ausgegeben war. Dass es unmöglich war, ein Verständnis ihres Lebens über längere Zeit zu gewinnen, gerade, dass ich für sie unbedeutend geblieben bin, mag die Wahrhaftigkeit dieser Darstellung durchaus erhöhen – denn was habe ich schon zu beweisen? Wie hätte ich so albern sein können zu glauben, ich könnte etwas »bewirken«? Es gibt nichts, was ich ehrenhaft versuchen könnte, als nach besten Kräften zu zeigen.“
 Und er betont: „Dieser Essay wurde nicht für arme Leute geschrieben oder für eine andere bestimmte Gruppe. Mein ganzes Wagnis besteht darin, dass ich gewisse Ähnlichkeiten und Unterschiede vermerke, von denen ich glaube, dass sie für die Erfahrung der Armut Geltung haben.“ Schon in der Vorrede ist ihm wichtig, sich von einem der großen Werke der Sozialreportage abzusetzen, von James Agee und Walker Evans berühmtem Essay „Preisen will ich die großen Männer“ (Let Us Now Praise Famous Men, USA 1941), das er einen „elitären Ausdruck egalitärer Neigungen“ nennt. Es wäre interessant, die Fotografien von Vollmann und die Kompositionen von Walker Evans zu vergleichen, er will auch hier klar Anti-Programm sein.
Und er betont: „Dieser Essay wurde nicht für arme Leute geschrieben oder für eine andere bestimmte Gruppe. Mein ganzes Wagnis besteht darin, dass ich gewisse Ähnlichkeiten und Unterschiede vermerke, von denen ich glaube, dass sie für die Erfahrung der Armut Geltung haben.“ Schon in der Vorrede ist ihm wichtig, sich von einem der großen Werke der Sozialreportage abzusetzen, von James Agee und Walker Evans berühmtem Essay „Preisen will ich die großen Männer“ (Let Us Now Praise Famous Men, USA 1941), das er einen „elitären Ausdruck egalitärer Neigungen“ nennt. Es wäre interessant, die Fotografien von Vollmann und die Kompositionen von Walker Evans zu vergleichen, er will auch hier klar Anti-Programm sein.
Ja, es bleibt in den Kleidern
Das Kapitel „Selbstbeschreibungen“ hat Abteilungen wie: Ich glaube, ich bin reich/ Ich glaube, sie sind arm/ Man muss für alles selber sorgen. Als „Phänomene“ macht er Missbildung/ Unsichtbarkeit/ Unerwünschtsein/ Abhängigkeit/ Unfallanfälligkeit/ Schmerz/ Abstumpfung/ Entfremdung aus. Er sucht „Wahlmöglichkeiten“, „Hoffnungen“ und „Platzhalter“. In fünf größere Kapitel gegliedert, mit Interviews in Thailand, im Jemen, in Japan, in Russland, China, Pakistan, Afghanistan, auf Madagaskar, in Kolumbien, Kenia, Kasachstan, Kambodscha, Burma, Sarajewo, Mexiko und anderen Orten und Ländern, hat Vollmann das Buch seinen Dolmetschern gewidmet, ohne die er „noch tauber und dümmer geblieben wäre, als ich es mit ihnen war… Nur ihre Geduld, oft auch ihr Wagemut und vor allem, dass sie sich vor Ort auskannten, haben dieses Buch möglich gemacht.“
Tatsächlich wagt William T. Vollmann, ein ruhelos Reisender (man denke an seinen „Hobo Blues“) natürlich viel. Immer wieder macht er sich angreifbar, schreibt auch über seine eigenen Ängste und Vorurteile. Und keiner sage, dass all die Begegnungen mit den Ärmsten der Armen, mit Bettlern, Drogensüchtigen und Prostituierten, Verfemten, Verfolgten, Illegalen, Kranken, Diskriminierten, dass all diese Begegnungen mit den unteren Rändern der Existenz nicht „in den Kleidern bleiben“.
Nicht umsonst wendet der Normalbürger die Augen vor allzu viel Elend und Armut.
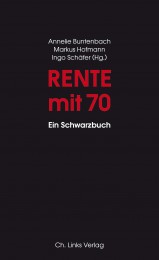 Ich kann das aus eigener Erfahrung – mit über 25 Jahren immer wieder Reportagearbeiten für deutsche Gewerkschaften – nur bestätigen. Vor einem Jahr erschien das „Schwarzbuch Rente mit 70“, für das ich länger recherchiert, dann fünf Monate lang durch Deutschland gereist war und 50 Interviews gemacht hatte. Meine Überlegung dabei: Wenn Politiker und Wirtschaftsexperten glauben, dass man bis 70 arbeiten könne und solle und müsse, wie sieht denn eigentlich die Realität derjenigen aus, die heute plusminus 50 und eigentlich „fertig“ sind, in körperlich wie psychisch belastenden Berufen arbeiten, teils schon gesundheitlich angeschlagen, bereits erwerbsgemindert oder nur noch prekär beschäftigt, und die das jetzt nach dem Willen realitätsferner Leute alles noch 20 Jahre länger durchstehen sollen bis zu irgendeiner Rente? Oder eben nach einem harten Arbeitsleben – von dem viele von uns keinerlei nähere Anschauung haben – vorher ausscheiden, alle Rücklagen aufgebraucht, entwürdigt, Mini-Renten und/ oder einer Pseudo-„Grundsicherung“ ausgeliefert. Es waren Noir-Erlebnisse, die ich da hatte. Den schwarzen Umschlag, den das Buch hat, trägt es zu Recht.
Ich kann das aus eigener Erfahrung – mit über 25 Jahren immer wieder Reportagearbeiten für deutsche Gewerkschaften – nur bestätigen. Vor einem Jahr erschien das „Schwarzbuch Rente mit 70“, für das ich länger recherchiert, dann fünf Monate lang durch Deutschland gereist war und 50 Interviews gemacht hatte. Meine Überlegung dabei: Wenn Politiker und Wirtschaftsexperten glauben, dass man bis 70 arbeiten könne und solle und müsse, wie sieht denn eigentlich die Realität derjenigen aus, die heute plusminus 50 und eigentlich „fertig“ sind, in körperlich wie psychisch belastenden Berufen arbeiten, teils schon gesundheitlich angeschlagen, bereits erwerbsgemindert oder nur noch prekär beschäftigt, und die das jetzt nach dem Willen realitätsferner Leute alles noch 20 Jahre länger durchstehen sollen bis zu irgendeiner Rente? Oder eben nach einem harten Arbeitsleben – von dem viele von uns keinerlei nähere Anschauung haben – vorher ausscheiden, alle Rücklagen aufgebraucht, entwürdigt, Mini-Renten und/ oder einer Pseudo-„Grundsicherung“ ausgeliefert. Es waren Noir-Erlebnisse, die ich da hatte. Den schwarzen Umschlag, den das Buch hat, trägt es zu Recht.
Bis auf ganz wenige Ausnahmen fand ich dafür Menschen, die mit vollem Namen auftreten und sich auch von mir fotografieren lassen wollten – bis auf ausgerechnet im Kursleiterinnenbereich VHS zwei Frauen mit je doppeltem Doktortitel, aber so prekär beschäftigt, dass sie Angst um ihre kläglichen Verträge haben mussten und ich sie deshalb anonymisierte. Bezahlt wurde mir die Recherche vom DGB, bis auf ein einziges Adjektiv gab es keinerlei Eingriffe in meine Porträttexte. Das Lektorat im Christian Links Verlag war eine geradezu luxuriöse Erfahrung. So weit so gut. Es war eine Recherche, wie ein Verlag oder eine Zeitung sie heutzutage kaum mehr ansatzweise bezahlen würde. Weshalb es so etwas auch kaum noch gibt. Zu oft nach „Ganz unten“ soll es doch bitte nicht, das stört die gute Laune der Talkshowgesichter. Die andern kommen als Mikrofonfutter vor: Mein Leben und meine Nöte als Putzfrau/ Paketbote/ Lagerarbeiter/ Verkäuferin/ Hilfsarbeiter/ Erntehelfer/ Friseuse, aber in bitte maximal 50 Sekunden.
Was ich dabei gelernt habe? Ja, es bleibt in den Kleidern, wen und was man da trifft, erlebt und erfährt. Und zweitens: So genau wollen es die allermeisten Leser gar nicht unbedingt wissen, was an der unteren Beschäftigungs- und Existenzgrenze in unserer Republik so Sache ist.
Nicht nur griff keine einzige der von mir angeschriebenen 20 Regionalzeitungen mein Angebot auf, eine der durchrecherchierten Geschichten, die immer auch den Zustand in einer Branche beschreiben, wie immer bearbeitet zu übernehmen. „Die Zeit“ bot mir für eine kolossale Überarbeitung, „bitte mit mindestens 40 belegten längeren O-Tönen“, zweieinhalb Zeitungsseiten und 760 Euro „Honorar“ – für die Arbeit mehr als eines halben Jahres. Ich verzichtete.
Noch grotesker: Kein einziges Gewerkschaftsblatt – die von mir Interviewten waren allesamt Gewerkschaftsmitglieder – hatte an irgendeinem Porträt oder einem Hintergrundartikel Interesse. Das in den Monaten vor der Bundestagswahl 2017. Die Lobby der Geringverdiener (und nur zu niedrigen Gewerkschaftsbeiträgen Fähigen) ist dünn und das Interesse am Thema mehr als volatil.
Im Freundeskreis gab es freundliches Interesse an dem Projekt, Genaueres aber wollte dann doch kaum jemand so richtig wissen. Ich musste damit alleine fertigwerden. Die offensten Ohren hatten zwei dänische Journalistenkollegen, sie waren schon bei meiner „Reportage über die Fleisch-Mafia“ dabei gewesen.
Wie redet man miteinander über armselige Wirklichkeiten? Über Armut? Über „die da unten“? So richtig haben wir das Interesse und die Sprache dafür nicht. Also: wenigstens Vollmann lesen!
William T. Vollmann: Arme Leute. Reportagen (Poor People, USA 2007). Aus dem Englischen von Robin Detje. Mit 128 Fotografien des Autors. Edition suhrkamp, Berlin 2018. Klappenbroschur, 448 Seiten, 22 Euro. Verlagsinformationen.
Ein zweistündiges Videointerview zum Buch mit dem Autor.
CrimeMag-Porträt von William T. Vollmann hier: Wahrhaft dicke Bretter bohren.
Rente mit 70. Ein Schwarzbuch. Mit 47 Reportagen von Alf Mayer. Christian Links Verlag, Berlin 2017. 192 Seiten, 15 Euro. Verlagsinformationen.
Einige Umfänge bei William T. Vollmann:
744 Seiten: „Rising Up and Rising Down. Some Thoughts on Violence, Freedom and Urgent Means“. Kondensierte Ausgabe 2004 der großen Untersuchung zur Gewalt. 3.300 Seiten umfasst diese in sieben Bänden 2003 bei McScweeny’s erschienene, heute antiquarisch hoch gehandelte Originalarbeit, WTV hatte 23 Jahre daran gearbeitet: Vol 1: Three Meditations on Death / Vol 2-3: Justifications (2 Bände) /Vol 4: Justifications, Section Two: Policy and Choice / Vol 5: Part II: Studies in Consequences (1991-2003) / Vol VI: The Muslim World (1994, 1998, 2000, 2002) / Vol VII: Annexes. Einen Bericht zur Entstehung gibt es hier.
832 Seiten, dt. Ausgabe 1028 Seiten: „Europe Central“, 2005.
1.310 Seiten: „Imperial“, 2009, mit 120 Interviewten. Dazu ein gleichnamiger Bildband mit 210 Seiten.
3.984 Seiten: die bisher fünf vorliegenden Bände der „Seven Dreams“-Serie.
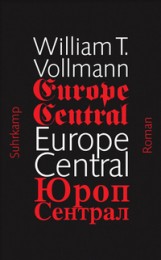
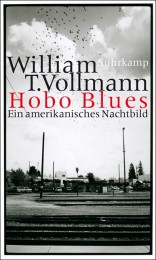 Übersetzte Bücher von William T. Vollmann:
Übersetzte Bücher von William T. Vollmann:
Afghanistan Picture Show oder Wie ich lernte, die Welt zu retten. Marebuchverlag 2003 (als Taschenbuch bei Suhrkamp, 2008)
Huren für Gloria, Suhrkamp 2006
Hobo Blues. Ein amerikanisches Nachtbild (Riding Toward Everywhere), Suhrkamp 2009
Sperrzone Fukushima. Ein Bericht (Into the Forbidden Zone), Suhrkamp 2011.
Europe Central. Suhrkamp 2013, 1.028 Seiten.
Arme Leute. Suhrkamp 2018, 448 Seiten.
Novellen und Sammelbände:
You Bright and Risen Angels (1987). 656 Seiten.
The Rainbow Stories (1989). 560 Seiten.
13 Stories and 13 Epitaphs (1991). 318 Seiten.
The Atlas (1996). 468 Seiten.
Europe Central (2005). 832 Seiten. Deutsche Ausgabe 1.028.
Seven Dreams Series:
The Ice-Shirt (1990) (Vol One). 432 Seiten.
Fathers and Crows (1992) (Vol Two). 1.008 Seiten.
Argall: The True Story of Pocahontas and Captain John Smith (2001) (Vol Three). 736 Seiten.
The Poison Shirt (Vol Four). Noch nicht erschienen
„The Dying Grass. A Novel of the Nez Perce War (2015) (Vol Five). 1.376 Seiten.
The Rifles (1994) (Vol Six). 432 Seiten.
The Cloud-Shirt (Vol Seven). Noch nicht erschienen.
The Prostitution Trilogy:
Whores for Gloria (1991). 138 Seiten.
Butterfly Stories: A Novel (1993). 279 Seiten.
The Royal Family (2000). 672 Seiten.
Non-fiction:
An Afghanistan Picture Show: Or, How I Saved the World (1992). 268 Seiten.
Rising Up and Rising Down: Some Thoughts on Violence, Freedom and Urgent Means (2003). 3.300 Seiten.
Expelled from Eden: A William T. Vollmann Reader (2004). 512 Seiten
Uncentering the Earth: Copernicus and the Revolutions of the Heavenly Spheres (2006). 294 Seiten.
Poor People (2007). 464 Seiten und 128 Fotos.
Riding Toward Everywhere (2008). 288 Seiten.
Imperial (2009) je ein Text- und Bildband. 1310 und 210 Seiten.
Kissing the Mask: Beauty, Understatement and Femininity in Japanese Noh Theater (2010). 528 Seiten.
Into the Forbidden Zone: A Trip Through Hell and High Water in Post-Earthquake Japan (2011)
The Book of Dolores (2013). 200 Seiten, mit vielen Abb.
„No Immediate Danger“ (2018). 602 Seiten. Anmerkungen nur online.
No Good Alternative“ (2018). 688 Seiten. Anmerkungen nur online.














