
Kurzbesprechungen von fiction – Joachim Feldmann (JF), Tobias Gohlis (TG), Günther Grosser (gg), Alf Mayer (AM), Ulrich Noller (UN), Frank Rumpel (rum), Florian Valerius (FV) und Thomas Wörtche (TW) über:
Germano Almeida: Der treue Verstorbene
Roberto Andó: Ciros Versteck
Simone Buchholz: River Clyde
Horst Eckert: Die Stunde der Wut
Pascal Engman: Rattenkönig
Dana Grigorcea: Die nicht sterben
Jürgen Heimbach: Vorboten
Kai Hensel: Terminal
Michael Horvath: Wiener Hundstage
Sven Heuchert: Kleiner Glanz
Tom Hillenbrand: Montecrypto
Stephen Mack Jones: Der gekaufte Tod
James McBride: Der heilige King Kong
Ling Ma: New York Ghost
Wilfred Owen: Die Erbärmlichkeit des Krieges. Gesammelte Gedichte
Hans Platzgumer: Bogners Abgang
Matthias Wittekindt: Vor Gericht
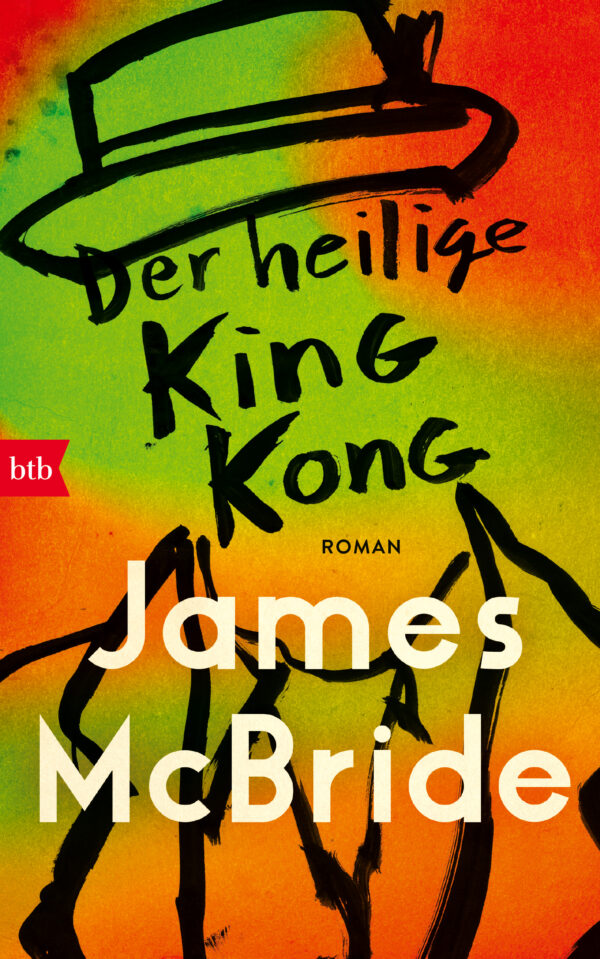
Welch ein Gewürzgarten
(TG) Dass kriminalliterarische Fiktion herzerfrischende Erweckungsliteratur sein kann (heilsam in der Oster-Ruhe, als hätte es nie und nirgendwo Oster-Unruhen gegeben, hey, ihr Biederdeutschen!) zeigt James McBride in Der heilige King Kong. Ich sage nur: Lesen, LESEN, LESEN! Man muss die Allergrößten – Cervantes, Dickens, Baldwin, Márquez und noch viele mehr – aufrufen, um diesen Gewürzgarten von Roman und seinen Helden mit dem grünen Daumen zu preisen. Heiter und bissig, verspielt und voll tiefer Trauer, satt mit lebensklugem Witz: Es ist die Geschichte eines wahren Gotteskindes, das weder von Krankheit noch Repression, weder von der Mafia noch den Schwarzen Gangstern noch von den Bullen fertig gemacht werden kann. Das einem jungen Drogendealer ein Ohr abschießt, damit die Baseballtradition einer Sozialsiedlung in Brooklyn nicht abbricht und die schönste Frau der Welt, die Venus von Willendorf, gerettet werden kann. Der Spitzname dieses Gotteskindes: Sportcoat.
James McBride: Der heilige King Kong (Deacon King Kong, 2020). Aus dem Amerikanischen von Werner Löcher-Lawrence. Btb, München 2021. Hardcover, 448 Seiten, 22 Euro.

Mafiosi vor dem Haus
(rum) Bloß nicht die Wege kreuzen mit den Mafiosi im neapolitanischen Viertel Forcella. Bislang gelang das dem Klavierlehrer Gabriele Santoro ganz gut, lebte er doch zurückgezogen, sein Leben kreiste um Poesie und Musik. Bis sich der zehnjährige Ciro aus der Nachbarschaft bei ihm versteckt. Er und sein Kumpel, rückt der mit der Zeit heraus, hätten in einer Gasse eine Frau überfallen, wollten ihre Handtasche. Die Frau stürzte, schlug mit dem Kopf auf, kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Pech nur, dass es sich um die Mutter eines Camorra-Bosses handelte, zudem „eine alte Hexe, die die kriminellen Machenschaften von halb Neapel verwaltete“. Sein Kompagnon ist verschwunden, er nun beim Professor untergetaucht. Die Mafiosi haben einen Verdacht, überwachen den Hauseingang. Die Lage wird brenzlig, als die Frau im Krankenhaus stirbt.
Roberto Andó ist ein leiser, genauer Erzähler. Sein Augenmerk gilt in diesem ersten auf Deutsch vorliegenden Roman einerseits der schwierigen Beziehung der beiden ungleichen Protagonisten. Der Musiker entwickelt väterliche Gefühle für den Jungen, beschließt, ihn zu beschützen, auch wenn er sich damit selbst in Gefahr bringt und sein ruhiges Leben damit völlig aus der Bahn zu kippen droht. Schließlich weiß er sehr genau, mit wem er sich da anlegt. Der mit Straßenkriminalität, harschen Hierarchien und Armut vertraute Junge wiederum muss erst begreifen, dass er sich beim Schöngeist Santoro in eine völlig andere Welt fügen muss, wenn er denn überleben will. Santoro sperrt den Jungen in seiner Wohnung ein, kommt sich dabei vor, wie ein Gefängniswärter. Gleichzeitig ist er selbst ein Gefangener der Verhältnisse, mit Freigang zwar, wohl aber unter Beobachtung.
Der 1959 in Sizilien geborene Andó wurde zunächst als Regisseur bekannt, lernte in jungen Jahren als Assistent unter anderem von Fellini und Coppola, soll später dann von Leonardo Sciascia zum Schreiben angeregt worden sein (eine beachtlich Riege an Lehrmeistern). In seinem Roman Ciros Versteck, den er gerade selbst verfilmt, erzählt er mit Leichtigkeit von dramatischen Zuständen. Er blickt auf kriminelle Strukturen, die tief in die Gesellschaft eingesickert sind. Das haben vor ihm schon andere getan, doch bricht Andó das gekonnt zu einer Art Kammerspiel herunter. Im Haus sind viele irgendwie mit der Camorra verbandelt. Entsprechend beschwert sich niemand über die am Eingang lungernden Mafiosi. Keiner der beiden Jungen wird als vermisst gemeldet. Die Lage spitzt sich mit jedem Tag mehr zu. Und Andó zwingt seinen Protagonisten, der sich sonst eher treiben lässt, eine klare Entscheidung zu treffen.
Roberto Andó: Ciros Versteck ( Il bambino nascosto, 2020). Aus dem Italienischen von Verena von Koskull. Folio-Verlag, Bozen 2021. 231 Seiten, 22 Euro.

Detroit ist zurück auf unserer Krimilandkarte
(hpe) Als «Motor City» war Detroit bekannt. Das Zentrum der US-Autoindustrie. Dann kam der Niedergang der Autoindustrie, der selbst die Stadt in den Bankrott riss. Ein großartiger Schauplatz für Kriminalliteratur. Loren D. Estleman machte uns in den Achtziger- und Neunzigerjahren des letzten Jahrhunderts mit seinem Privatdetektiv Amos Walker und mit anderen Detroit-Romanen damit bekannt. Leider erscheinen seine Werke schon länger nicht mehr auf Deutsch. Doch jetzt bringt Stephen Mack Jones, ein ehemaliger Werber, Lyriker und Theaterautor, der 2017 mit 63 Jahren als Krimiautor debütierte, das heutige Detroit näher, das daran ist, sich von der Krise zu erholen. »August Snow« hieß das Debüt, benannt nach dem Namen seines Helden, das jetzt als Der gekaufte Tod auf Deutsch vorliegt.
Als August Snow nach einem Jahr, in dem er durch die Welt gereist war, nach Detroit zurückkehrte, «hatten sich die Gemüter immer noch nicht ganz beruhigt». Der Ex-Polizist hatte «gegen den ehemaligen Bürgermeister und etliche Detroiter Cops – jetzt entlassen oder im Gefängnis –, die ihm bei seinen diversen kriminellen Machenschaften behilflich gewesen waren», ausgesagt. Gegen seine darauffolgende Entlassung hatte Snow geklagt – und 12 Millionen Dollar Entschädigung erhalten. Snow lebt im Haus seiner verstorbenen Eltern in Mexicantown, einem Viertel in Südwest-Detroit, in dem sich seit den 1920er Jahren Einwanderer aus dem Süden niederließen, um in der Autoindustrie der Motor City zu arbeiten. Snows Mutter stammte aus Mexiko. Sein Vater war Afroamerikaner. Und Polizist, wie es auch der Sohn wurde.
«Wir werden definiert durch die Menschen, die wir verlieren», hat August Snow vor seinem Vater gelernt, «diejenigen, denen wir vielleicht hätten helfen könne, es aber nicht getan haben.» Dennoch lehnt er ab, als ihn eine reiche alte Bankbesitzerin wegen ominösen Machenschaften in ihrem Finanzinstitut um Hilfe bittet. Als sie wenig später tot ist, will die Polizei das als Suizid abhaken. Doch Snow glaubt nicht daran und macht sich auf die Jagd nach dem Mörder. Es entwickelt sich eine actionreiche Geschichte, die spannend und mit trockenem Humor erzählt ist. Dabei werden nicht nur soziale Unterschiede immer wieder deutlich, Icherzähler Snow geizt auch nicht mit sarkastischen Feststellungen: «Wenn es strafbar wäre, ein egozentrischer Drecksack zu sein, dann säße keine Menschenseele im US-Senat.»
Die zweite Hauptrolle in den Roman spielt die Stadt Detroit, in der sich ein neuer Aufschwung abzeichnet. Dieser manifestiert sich auch in der Gentrifizierung einst verschmähter Stadtteile wie Mexicantown. Snow, der sein Viertel mag, setzt sein neues Vermögen dafür ein, alte Häuser zu sanieren und als zahlbaren Wohnraum zu erhalten. Dabei bleibt der Ex-Polizist, der mit einer inneren Zerrissenheit zu kämpfen hat, aber immer skeptisch: «Da ich aus Detroit stammte, habe ich dem Glück natürlich nie so recht getraut.»
Stephen Mack Jones: Der gekaufte Tod (August Snow, 2017). Aus dem Englischen von Ulrike Wasel und Klaus Timmermann. Tropen, Stuttgart 2021. 359 Seiten, Klappenbroschur, 17 Euro.
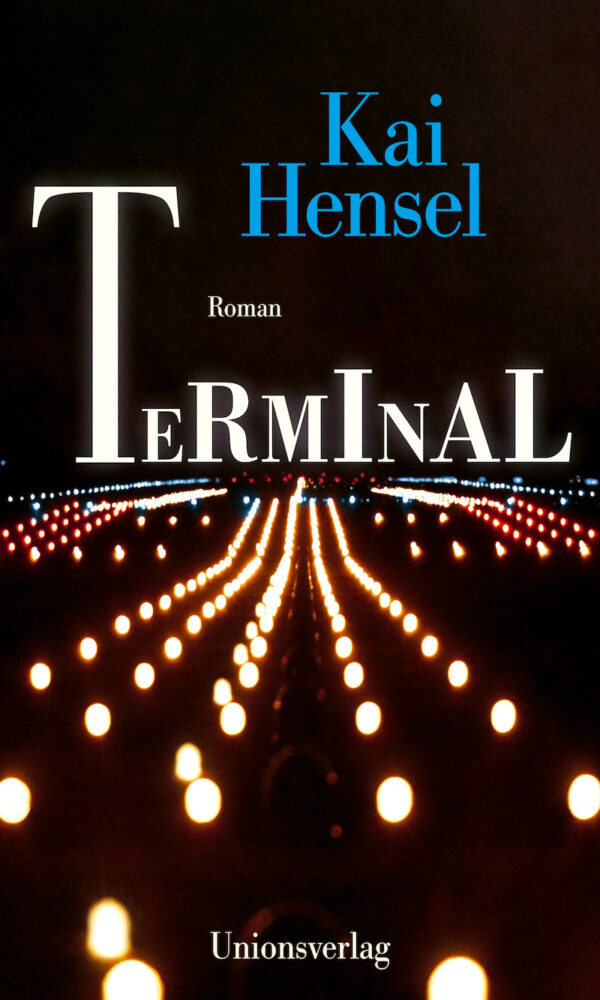
Tadellose Spannungsliteratur
(JF) Nun ist es doch anders gekommen. Entgegen allen Erwartungen wurde der Großflughafen Berlin-Brandenburg mit neunjähriger Verspätung am 31.10.2020 eröffnet, dummerweise zu einer Zeit, als der internationale Luftverkehr in seiner bislang größten Krise steckte. Noch muss es sich erweisen, ob das Bauwerk nicht als gigantische Investitionsruine in die Geschichte eingehen wird. Oder vielleicht auch als Sakralbau für unsere Zeit. Denn ein Mysterium ist die schier unendliche Pannenreihe, von der das Projekt seit seiner Planung im Jahr 1995 verfolgt wurde, schon. Da mag mancher vermuten, dass der Flughafen schlicht nicht fertig werden wollte.
Auf dieser verführerischen Idee beruht Terminal, der neue Roman des Berliner Schriftstellers Kai Hensel, der sich schon in seinem letzten Buch „Bist du glücklich?“ (2016) mit den quasi-religiösen Aspekten avancierter Digitaltechnik beschäftigt hat. Eine Crew aus versierten Informatikern, die der ehemalige Bürgermeister Pankelow, in dessen Amtszeit die erste Bauphase des Flughafenprojekts fiel, angeheuert hat, versucht, den Algorithmen, die das Innenleben des Monsters aus Beton und Stahl kontrollieren, auf die Spur zu kommen. Ansonsten gilt es, mit bewährten Mitteln zu verhindern, dass die Bauarbeiten erfolgreich beendet werden. Schließlich bringt jede Panne neue Aufträge für heimische Unternehmen. Dass Pankelow noch andere Pläne verfolgt, wissen seine Leute nicht. Und sie ahnen auch nichts davon, dass es aktionsbereite Zeitgenossinnen gibt, die dem ganzen Projekt als Symbol fehlgeleiteter Ausgabenpolitik gerne ein explosives Ende bereiten wollen.
Sich in dieser komplexen Lage zurechtzufinden, ist nicht einfach. Deshalb gibt es Jana aus Bottrop, 19 Jahre, frisch in Berlin und die Identifikationsfigur in diesem Roman. Ein Jahr vor dem Abi ist sie aus dem Internat geflüchtet, um ihren Lebenstraum zu verwirklichen. 10.000 Euro braucht es dafür. Als Pizzakurierin müsste Jana lange sparen, bis die Summe zusammenkäme. Schneller scheint es zu gehen, als sie durch Zufall Pankelow, der mit großen Banknoten nur so um sich wirft, kennenlernt. Doch bevor sie sich’s versieht, steckt sie mitten drin im Geschehen, das hier nur angedeutet werden kann. Denn Kai Hensel ist mit „Terminal“ nicht nur ein vielschichtiger und einfallsreicher Roman mit beachtlichem Überraschungspotential gelungen, sondern auch ein mitreißend erzähltes Stück Spannungsliteratur, das man so leicht nicht vergisst.
Kai Hensel: Terminal. Unionsverlag, Zürich 2021. 279 Seiten, 18 Euro.
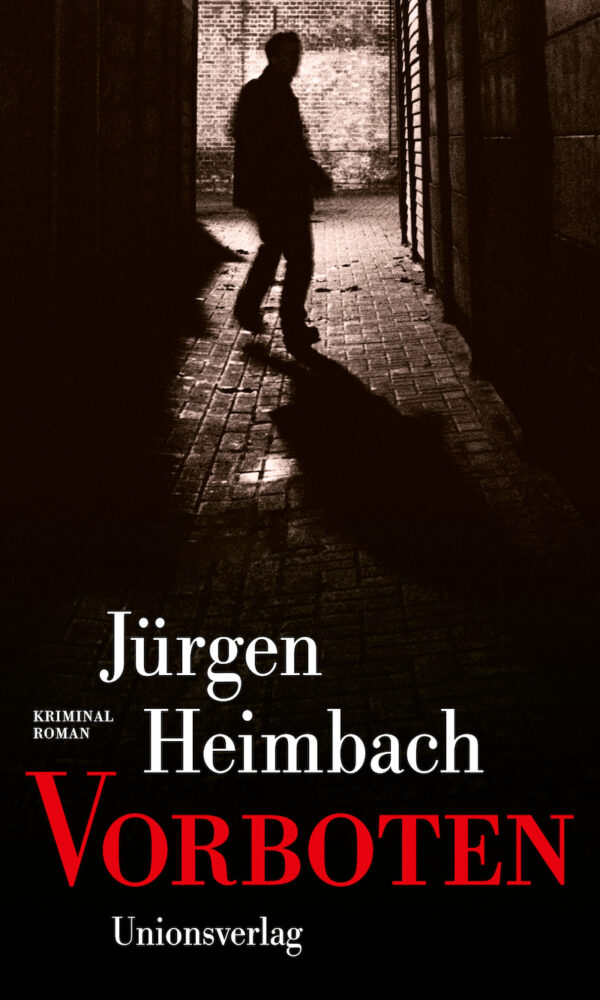
Weit mehr als nur Geschichtsdekor
(gg) Am Ende liegen in Jürgen Heimbachs historischem Kriminalroman Vorboten viele Tote herum, aber an Leichen, an Verschollene, Tote hatte man sich im trostlosen Jahr 1919 längst schon gewöhnt; im Krieg verschwanden sie reihenweise in den Gräben, dann kam die spanische Grippe, schließlich Straßenkämpfe in den Städten, Fememorde in der Provinz, Linke gegen Rechte, das Alte gegen das Neue.
Wieland Göth kommt zurück in sein Heimatdorf nach Rheinhessen, wo seit Kriegsende die französische Besatzungsmacht hockt und Unmut weckt. Im Untergrund braut sich etwas zusammen, der örtliche Graf sammelt Aufwiegler und könnte den mysteriösen Wieland gut gebrauchen, die anderen sehen in ihm bloß einen irritierenden Fremden, ja einen Spion, ein Kuckucksei der Franzosen. Die Frauen hingegen sind neugierig, seine alte Liebe Freya lässt sich noch einmal auf ein Verhältnis ein, und die irrlichternde Frau des Bäckers – Marianne, sie jedoch lässt sich Apollonia nennen – sieht in ihm einen Ausweg aus der Enge der Provinz. Wieland begleitet seinen bettlägerigen, verbitterten Säufer-Vater beim Sterben, bleibt allen anderen gegenüber reserviert und sucht seine verschwundene Schwester Josepha; die gilt als tot, ermordet von einem russischen Kriegsgefangenen. Wortkarg und vorsichtig manövriert sich Wieland durch diesen schwappenden sozialen Sumpf des Misstrauens. Bis im Wald dann die Fallen zuschnappen.
Alles riecht in „Vorboten“ nach Unausgelebtem, überall lauern die Ressentiments, das Kleinliche, die Missgunst, und alles Fremde wird verteufelt. Heimbach malt die provinzielle Hölle jener historischen Zwischenwelt der totalen Unübersichtlichkeit, in der dann alles in die falsche Richtung lief. Es ist der Versuch, die titelgebenden Vorboten für die kommende deutsche Katastrophe zu illustrieren; die Illustration ist reich an Grautönen und pessimistischer Note, und „Vorboten“ ein seltener Fall von exzellentem, mit mehr als nur Geschichtsdekor aufgeladenem historischen Kriminalroman.
Jürgen Heimbach: Vorboten. Unionsverlag Zürich 2021. 224 Seiten, 18 Euro. – Siehe auch das Interview von Alf Mayer in dieser Ausgabe.
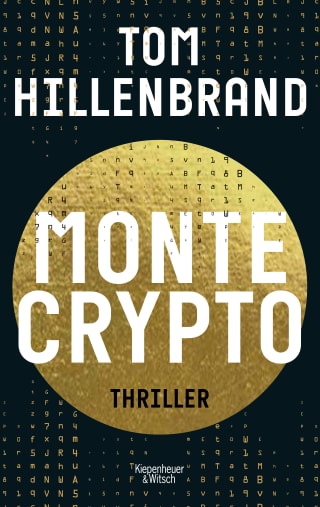
Versiert konstruiert
(JF) Ein Pionier der digitalen Wirtschaft ist abgestürzt. Und das ist nicht metaphorisch gemeint. Nur anhand von DNA-Spuren, lässt sich feststellen, wer im Cockpit der Cessna, die über dem Golf von Mexiko ins Trudeln geriet, saß. Aber wo ist das gigantische Vermögen des exzentrischen Unternehmers geblieben? Seine Halbschwester vermutet, dass er seine Millionen in einer Kryptowährung angelegt und gut versteckt hat. Auftritt Ed Dante. In einem früheren Leben saß der gebürtige Engländer und Liebhaber kräftiger Teemischungen in der Führungsetage einer Investmentbank. Als diese aufgrund fauler Geschäfte kollabierte und damit die Weltwirtschaft ins Taumeln brachte – die Lehman-Brothers-Pleite lässt grüßen–, kam er mit zwei blauen Augen davon. Jetzt lebt er in Los Angeles und betreibt „Financial Forensics“. Das steht zumindest auf seiner Visitenkarte. Im Klartext heißt das, Dante versucht, seinen wohlhabenden und gleichwohl gierigen Klienten, das Geld, welches ihnen bei dubiosen Geschäften abgeluchst wurde, wiederzubeschaffen. Seine Detektivarbeit besteht also vor allem aus Papierkram.
Aber nun ist alles anders. Die Suche nach den verschwundenen Millionen wird zur riskanten Schnitzeljagd, bei der man auch mal über eine Leiche stolpert. Und am Ende kracht und rumst es heftig und real. Schließlich geht es im neuem Thriller Montecrypto von Tom Hillenbrand um nichts weniger als das Schicksal der Welt, wie wir sie kennen. Oder auch nicht. Denn dieser versiert konstruierte Spannungsroman führt uns auf angenehm altmodische Art und Weise an Orte, von deren Existenz wir bestenfalls eine Ahnung haben, und erweist sich so als eine ebenso nützliche wie vergnügliche Lektüre.
Tom Hillenbrand: Montecrypto. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2021. 444 Seiten, 16 Euro.

Erfreulich unzeitgeistig
(TW) In ganz, ganz raren Fällen kann „Klassizismus“ auch Freude machen. Wiener Hundstage von Michael Horvath ist so eine Ausnahme. Der Roman spielt vom 10ten bis zum 16ten Juli 1995. Die Hauptfigur ist der leicht heruntergekommene, alkoholaffine, James-Lee-Burke-lesende, Zippo-benutzende Journalist Paul Mazurka, dem gerade die Freundin weggelaufen ist. Das gehört so. Jetzt ist eine Kollegin ermordet worden und ein Kollege spurlos verschwunden, der heißes Material für Mazurka hatte. So heiß, dass eine Menge dubioser Schurken konsequenterweise hinter ihm her sind. Das gehört auch so. Diese Schurken sind auch nicht irgendwer. Mazurka, dessen letzte Coup ein Interview mit Karlheinz Deschner („Kriminalgeschichte des Christentums“, wir erinnern uns) war, sticht in ein einschlägiges Wespennest aus kinderschänderischen Klerikalen und miesen Waffengeschäften in den damals noch virulenten Balkankonflikten. Ach ja, weil es so gehört, gibt es auch noch eine geheimnisvolle Schönheit, die nicht ist, was sie zu sein vorgibt. Leichen fallen an, es wird geprügelt und geschossen, was das Zeug hält, gesoffen auch, und die mit der fiesen Denke sind klar im Vorteil. Der Erzählton ist schön schnoddrig hardboiled, wise cracks allenthalben.
Horvath, so vermute ich mal, hatte beim Schreiben eine Menge Spaß, er suhlt sich fast wollüstig in den Standardsituationen des Subgenres, versucht sie auch nicht zu transzendieren oder sonstigen Metafidelwipp zu treiben. Auch das gehört so. Denn so gleitet das Buch dahin wie der „Bemsha Swing“ von Miles Davis & Milt Jackson. Und verstellt nicht den Blick auf den harten Kern des Romans: Die ungute Verquickung von Kirche, Politik und der Unterstützung kroatischer Gräuel während der Balkan-Konflikte, die von Wien und Rom damals in Szene gesetzt wurde, wobei, auf die Aktualität muss man nicht extra hinweisen, der Kindesmissbrauch im österreichischen Klerus schon damals notorisch skandalös war. Namen wir Bischof Kurt Krenn oder Hans Hermann Groër (Erzbischof von Wien) sind mir noch gut in Erinnerung und treten bei Horvath nur leicht verschlüsselt auf. Auch wenn all das ein gutes Vierteljahrhundert her ist, die Wut und den Zorn über diese österreichischen Verhältnisse (mit dabei natürlich auch Gladio und Opus Dei) sind noch lange nicht vergessen, und Horvath erinnert sehr massiv daran, denn strukturell hat sich nicht viel zum Guten verändert.
Den Roman würde man paratextuell (Verlagsort, Titel, Cover) als „Regiokrimi“ verorten, aber das wäre falsch, zumindest was die Klischeekriterien für „Regio“ betrifft. „Wiener Hundstage“ ist ein durchaus unbehaglicher Roman, dessen oberflächliche Behaglichkeit aus einem einst unbehaglichen Erzählmuster, eben der hardboiled-novel, herrührt. Aus dieser Dialektik der meaning of structur hat Horvath einen sehr erfreulichen Kriminalroman gemacht. Aber nochmal: Don’t try this at home.
Michael Horvath: Wiener Hundstage. Emons Verlag, Köln 2021. 288 Seiten, 13 Euro.
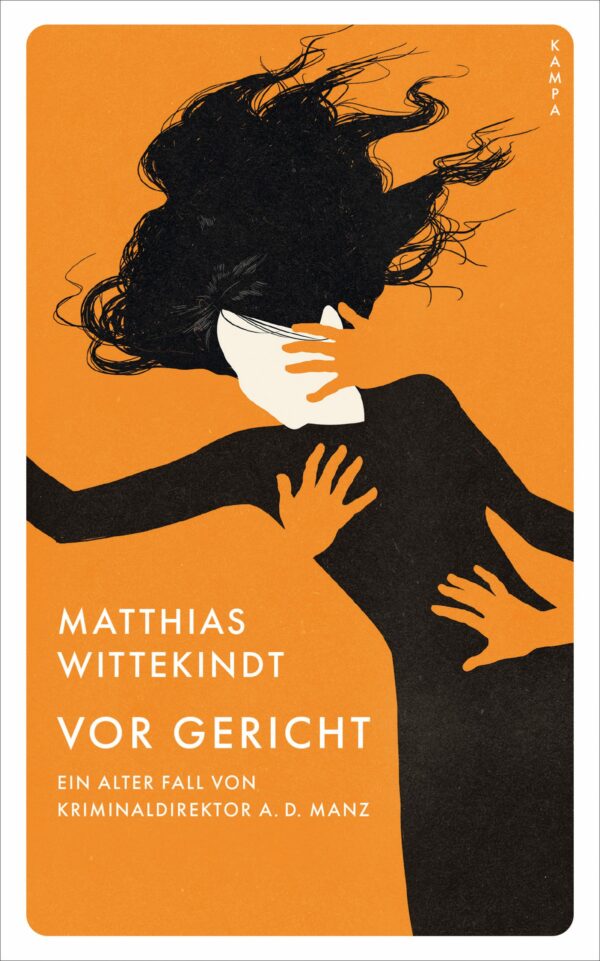
Helden in Sinnkrise
(TG) Unbestrittenes Qualitätskriterium für Kriminalliteratur ist ihre Fähigkeit, die Legitimität von Recht und Gesetz zu überprüfen. In der Krimibestenliste April (von T.S. Eliot in “Waste Land” als “grausamster Monat” verunglimpft) geschieht das auf zweierlei Weise. Weder Matthias Wittekindt noch Simone Buchholz verbreiten den strahlenden Optimismus, dessen unsere von Strukturkritik ins Mark verunsicherten Sicherheitskräfte so dringend benötigen. Wittekindt, beeindruckt von der teilnehmenden Beobachtung eines Gerichtsverfahrens, fieselt in Vor Gericht nicht nur die immanenten Schwächen des juristischen Prozesses auf, die diesem die eigentlich verfolgte Wahrheitsfindung verunmöglichen, er kombiniert dazu noch dieses desaströse Courtroom-Drama mit der Sinnkrise eines Kriminaldirektors im Ruhestand. Der über dem ganzen Recherchieren, Rekonstruieren, Revidieren in eine Kopf bis Fuß erfassende Sinnkrise verfällt.
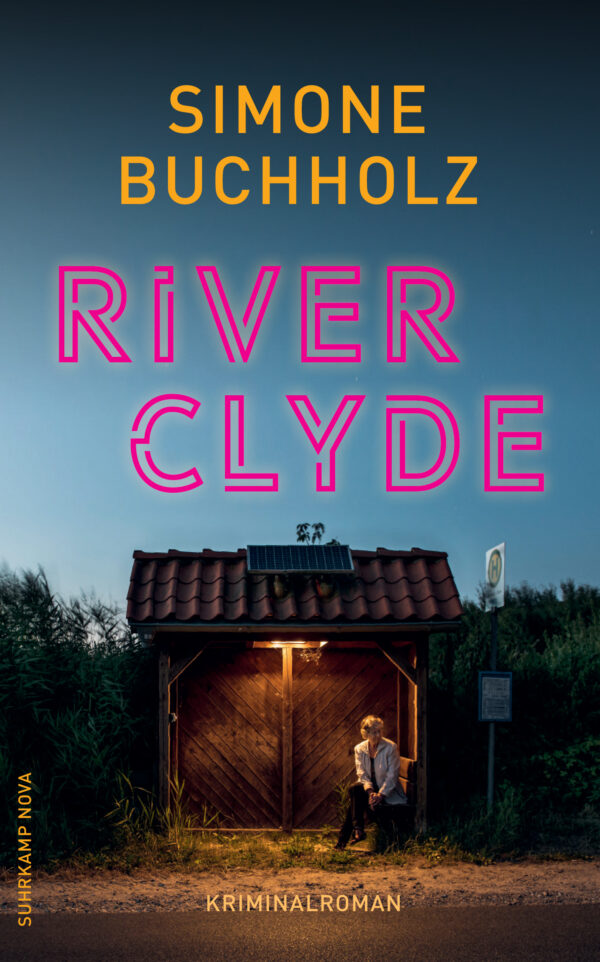
Sinnkrise wäre auch das Stichwort für Simone Buchholz‘ River Clyde. Wenn nicht ihre Protagonisten die Sinnkrise längst hinter sich hätten. Chastity hat sich ans Ufer eines anderen Flusses gerettet, auch zeitlich: Vom River Clyde brach ein Vorfahr in gesegnete Land Amerika auf, von wo nach etlichen Schicksalsschlägen und Kriegen ihr Vater Generationen später nach Hanau an den Main gelangte, um Chastity zu zeugen, die jetzt wieder an den Familienursprung väterlicherseits in Glasgow zurückkehrt, wo die Menschen mindestens genauso wunderbar und herzzerreißend trauern (und trinken) wie an der Elbe. Verwaist ergeben sich ihre Kumpel in St. Pauli – nein, nicht dem Suff, den beherrschen sie aus dem FF – sondern dem Achtsamkeitstraining: Bullen lernen sich auf einer Decke hinzusetzen und sich mit Vornamen anzureden. Man bekommt richtig Mitleid mit ihnen, wenn man sich die Zeit nimmt, Simone bei einem ihrer Interviews zuzuhören. Nein, weder die Dresdner, noch die Hamburger Polizisten bringen’s noch, doch keine Bange: Alles Fiktion.
Matthias Wittekindt: Vor Gericht. Ein alter Fall von Kriminaldirektor a.D. Manz. Roman. Kampa 2021. 320 S., 19,90 Euro.
Simone Buchholz: River Clyde. Suhrkamp, Berlin 2021. Klappenbroschur, 230 Seiten, 15,95 Euro.
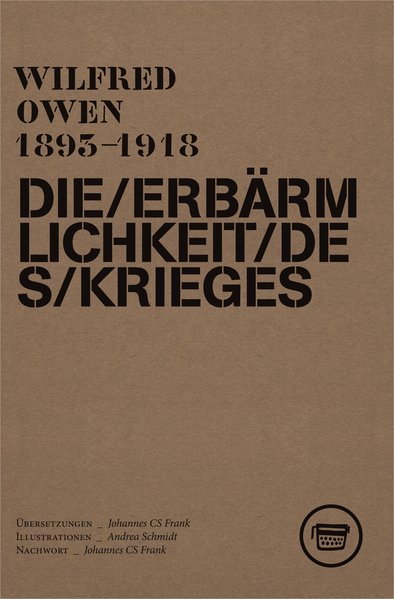
Nichts Heldenhaftes
(AM) „Oh, warum quälen sich die Sonnenstrahlen sinnlos, um den Schlaf der Erde zu unterbrechen?“, zitiert Derek Raymond in „Ich war Dora Suarez“ aus einem Brief von Wilfred Owen von der Front. Raymonds dritter Factory-Band, „Wie die Toten leben“, hat gar eine andere Owen-Stelle als Motto. Der wohl düsterste Poet der Kriminalliteratur fühlte sich dem britischen Kriegsdichter seelenverwandt. Owen fiel am 4. November 1918 in Frankreich, am Canal de la Sambre à l’Oise, ganze 25 Jahre alt, fast auf die Stunde genau eine Woche vor es im Ersten Weltkrieg zm Waffenstillstand kam. Owen gilt heute als wichtigster britischer „War Poet“. Seine Wirkung reicht freilich darüber hinaus. So, wie bestimmte Filmemacher auf immer den Zugriff auf Bilder veränderten, so stürmt seine Sprache unmittelbar in Aktion. Robin Robertson, dessen Buch in Versform „Wie man langsamer verliert“ ich in dieser Ausgabe nebenan bespreche, ist zum Beispiel klar von Owen geprägt.
Owens Gedichte sollte jeder kennen. Es gibt sie, sensationell schön präsentiert und passgenau übersetzt, in der Edition ReVers im Verlagshaus Berlin, jenem Verlag, der in seinen Prospekten dazu aufruft: POETISIERT EUCH!
Der bibliophile Band Die Erbärmlichkeit des Krieges – wunderbar illustriert von Andrea Schmidt, trotz hochklassiger Ausstattung zum Preis eines normalen Taschenbuchs erhältlich und von der Stiftung Buchkunst als eines der schönsten deutschen Bücher ausgezeichnet – versammelt die Gedichte Owens, dazu Auszüge aus Briefen von der Front, ein sehr informatives Nachwort des Übersetzers Johannes CS Frank sowie eine Zeitleiste für Leben und Zeit dieses Ausnahmedichters. In der nicht zu schmalen Fußleiste sind die Gedichte im Original lesbar. Bei Wilfred Owen hat das Leiden und hat der Krieg nichts Heroisches; der Feind ist letztlich ein Leidensgenosse. Fürs Vaterland zu sterben ist weder süß noch ehrenvoll, das Gedicht „Dulce et decorum“ stellt das brutal klar. „Alles, was ein Dichter heute tun kann, ist warnen“, schrieb Owen vor mehr als hundert Jahren. Dies ist ein Band, der viel Verbreitung verdient.
Wilfred Owen: Die Erbärmlichkeit des Krieges. Gesammelte Gedichte (zweisprachig) und ausgewählte Briefe. Aus dem Englischen und mit einem Nachwort von Johannes CS Frank. Illustrationen von Andrea Schmidt. Edition ReVers #02, Verlagshaus Berlin, 2. überarbeitete Auflage, Berlin 2015. 140 Seiten, 14,90 Euro.
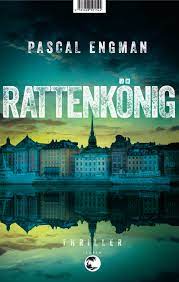
Das Harte als Triebkraft
(gg) Rattenkönig, der zweite Band von Pascal Engmans Reihe um die Stockholmer Kommissarin Vanessa Frank, endet mit zahlreichen Toten: zwei Incels (Involuntary celibates – unfreiwillig Zölibatäre; leider bereits fast eine Bewegung), richten bei einem Frauenfestival ein Massaker an. Engman lässt dort gleich eine ganze Reihe von Geschichten zusammenlaufen, mittendrin die junge Journalistin Jasmina, an Körper und Seele geschunden, als sie von drei Kerlen betäubt und vergewaltigt wird, und die harte Kommissarin mit den verschütteten Bedürfnissen, Vanessa Frank, die neben einem Mordfall noch ihr durchhängendes Leben jongliert. Umzingelt von zahlreichen Männern rudern sie durch die Geschichte, denn Frauenhass, Femizide, Incels und radikale Fronten gegen den Feminismus sind das harte Erzählfeld des Buches, und Liebe ist wahrlich nicht das tragende Thema.
Engman versucht, den ideologischen Irrweg zu skizzieren und seine Folgen in all ihrer Härte zu illustrieren. Mit seinem starken Drang zum Thriller und zur Drastik übertreibt er es immer wieder mit der Action, lässt die Fetzen und die Kugeln ordentlich fliegen, das Blut spritzen und jagt uns durch ein paar Cliffhanger, wo dann alles grade noch mal gutgeht. Er versucht, eine Balance zu finden mit ein paar zärtlich getupften Nebengeschichten und liebevollen Details, aber das Harte ist nun einmal Triebkraft und explosiver Kern der Geschichte – ein Männerding. Schwer zu nehmen ist dabei das Ausmaß an Hass und Gleichgültigkeit der Frauenhasser, und man ist geneigt, das Massaker am Ende für unglaubwürdig und überzogen zu halten, aber die Ereignisse draußen zwischen Hanau und Atlanta belehren uns alle eines Besseren. Und obwohl man sich beim Tropen Verlag für ein ruhiges Coverfoto entschieden hat, mit alten Häusern, die sich bei Sonnenuntergang im Wasser spiegeln: „Rattenkönig“ ist nicht der nette Krimi für Mimi abends im Bett.
Pascal Engman: Rattenkönig. Aus dem Schwedischen von Nike Karen Müller. Tropen Verlag, Stuttgart 2021. 464 Seiten, 17 Euro.

Zu den ewigen Top Ten
(FV) Im Februar 2020 entdeckte ich den Roman „Severance“ von Ling Ma in New York und kaufte ihn sofort. Er erzählt eine Endzeitgeschichte um tödliche Pilzsporen, die über die Atemwege übertragen werden und die Menschen mit dem „Shen-Fieber“ infiziert – und zu Zombies werden lässt. Corona war zu diesem Zeitpunkt noch kein wirkliches Thema für mich, der Roman wurde 2018 geschrieben. Nach meiner Rückkehr las ich den Roman und uns suchte plötzlich dieser Virus heim: Ich hatte am ganzen Körper Gänsehaut und war von der prophetischen Geschichte absolut geflasht- und fragte mich: Wann & Wo wird er bei uns erscheinen? Nun ist es soweit: Zoë Beck hat den Roman (grandios!) ins Deutsche übersetzt und in ihrem Verlag Culturbooks, den sie zusammen mit Jan Karsten führt, veröffentlicht. Letzte Woche las ich New York Ghost, so der deutsche Titel, erneut – und was soll ich sagen? Jahreshighlight, vielleicht sogar ein Platz in meiner ewigen Top Ten.
Wichtig ist zu erwähnen: Dieser Roman ist SO viel mehr als ein Abbild unserer momentanen Pandemie: Er ist Kapitalismuskritik Deluxe, er ist eine Einwanderergeschichte, eine Liebesgeschichte, eine Familiengeschichte und eine „state of the art“ Erzählung über junge Großstadtmenschen. Eine Meditation über Einsamkeit und Entfremdung. Müsste ich dieses Meisterwerk einer Geschichte einordnen, würde ich spontan sagen: Wenn George A. Romero & Sally Rooney ein Baby haben würden – es hieße Ling Ma. Nicht nur der Inhalt ist perfekt – auch der Ton (den die Übersetzerin sowas von trifft/einfängt) ist irgendwo zwischen lethargisch, stoisch, melancholisch und so dermaßen anders, dass ich keine Worte dafür finden kann. Ihr müsst es selbst erfahren – wenn ihr dieses Jahr nur ein Buch lest: Dann sollte es „New York Ghost“ sein.
Ling Ma: New York Ghost (Severance, 2018). Aus dem Englischen von Zoë Beck. CulturBooks Verlag, Hamburg 2021. 360 Seiten, Hardcover mit Lesebändchen, 23 Euro. – Florian Valerius bei Instagramm.
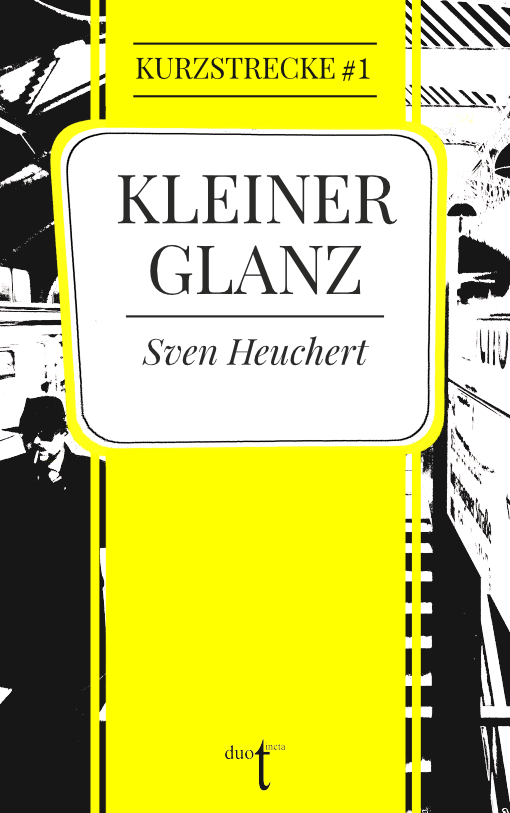
Bekennender Minimalist
(JF) Ludger Baginski, einst Profifußballer und jetzt Säufer ohne Job, hat vierzig Cent zu wenig, um seinen Einkauf zu bezahlen. Nun muss er sich für eine der beiden Schnapsflaschen entscheiden, denn die Kassiererin bei Aldi gibt keinen Kredit. Nicht einmal für ein paar Minuten. Später bekommt er einen Fünfzig-Euroschein geschenkt. Ein alter Fan hat ihn wiedererkannt. Dann besucht er eine Frau, die er früher einmal besser kannte, alkoholkrank wie er selbst. Keine gute Idee. Am Ende der Geschichte steht Baginski an einer Kreuzung. Die Ampel zeigt grün. Ob er gehen wird, bleibt offen.
„Die Mechanismen des Geschäfts“ heißt diese Story eines Verlierers ohne Ziel, aber mit viel Vergangenheit. Sven Heuchert, der sich mit zwei großartigen Spannungsromanen von poetischer Düsternis einen Namen erschrieben hat, zeigt in dem kurzen Text sein ganzes Können. Kunstvoll knappe Dialoge, Hauptsätze, Ellipsen. Und viele Leerstellen. Wir müssen nicht lesen, wie und wann Baginski abgestürzt ist. Oder was genau ihn mit Babette, die eigentlich Monika heißt, verbindet. Die Bilder im Kopf entstehen von selbst.
Die Geschichte Baginskis ist eine der wenigen in Heucherts Storysammlung „Kleiner Glanz“ die personal erzählt wird. Häufiger lässt der Autor seine Hauptfiguren selbst sprechen. „Ich“ heißt es dann, aber das kann vieles bedeuten. Denn besonders auskunftsfreudig sind sie nicht. Und ob man ihnen alles glauben darf, ist ungewiss. „Lügen, die wir uns erzählen“ lautet der programmatische Titel einer solchen Geschichte.
Sven Heuchert ist bekennender Minimalist, geschult an der Tradition der amerikanischen Short Story. Seine Sujets findet er an Orten, die der deutschen Gegenwartsliteratur eher fremd sind, von wenigen Ausnahmen wie dem kürzlich verstorbenen Ludwig Fels abgesehen. Und was er daraus macht, hat Klasse. In einem Rutsch allerdings sollte man diese Geschichten vom Rande der Gesellschaft nicht lesen. Denn jede von ihnen hat ihren ganz eigenen Glanz.
Sven Heuchert: Kleiner Glanz. Stories. Verlag Duotincta, Berlin 2020. 171 Seiten, 17 Euro.
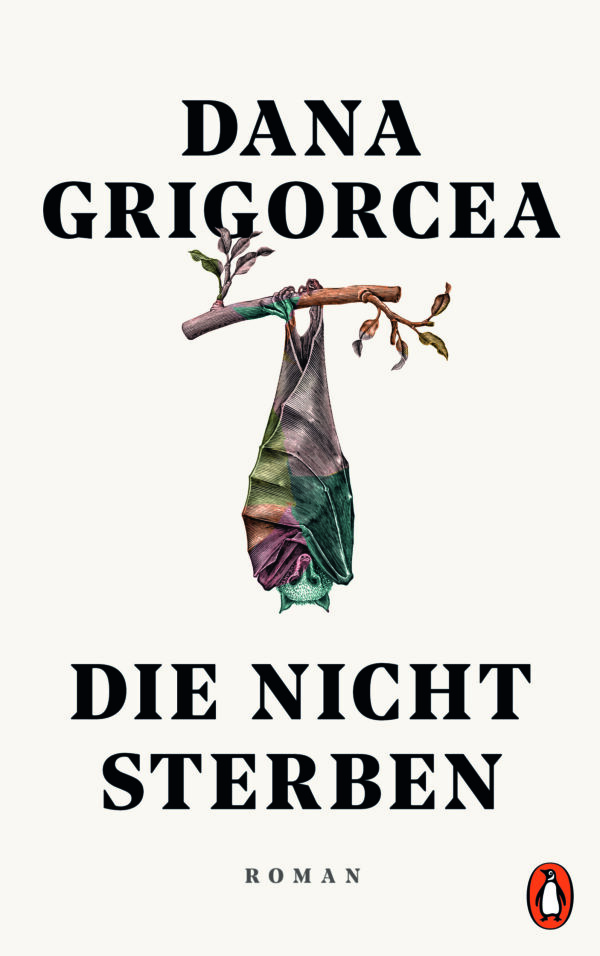
Ein starker Roman
(UN) Dracula, die alte Klamotte, kann man dem noch etwas Neues, Frisches, Aktuelles abgewinnen? Klar doch, man kann. Also: Dana Grigorcea kann das. In ihrem neuen Roman Die nicht sterben geht es allerdings erst einmal um eine junge Frau, Malerin und Kunststudentin, die aus Paris nach Rumänien zurückkehrt. Genauer: In einen Ort namens B. in der Walachei, am Fuße der Karpaten gelegen. Es ist die Zeit nach dem Ende des Staatskommunismus, die Tante hat in dem Städtchen ihre Villa zurück erhalten, wie in den guten (?) alten Zeiten versammeln sich nun wieder alle möglichen Freunde und Verwandten zur beschwingten Sommerfrische hier “auf dem Land”. Es ist eigentlich ja kaum etwas vorstellbar, das diese ausgeruhte Geselligkeit trüben könnte – dann allerdings stürzt eine ältere Dame aus dieser Gesellschaft bei einer gemeinschaftlichen Wanderung zu Tode. Nun, so etwas kann ja durchaus einmal passieren, kein Grund zur Erschütterung eigentlich.
Den liefert allerdings ein Blick in die Familiengruft, in der die Dame bestattet werden soll: Dort findet sich nicht bloß ein Toter, ein Mann aus dem Dorf, der auch noch nach Art der Gegend gepfählt wurde – sondern auch das Grab des Mannes, der Vorbild war für diesen Dracula-Mythos, der über Jahrzehnte durch die (Populär-)Kultur zentrifugiert wurde bis zur Unkenntlichkeit: Vlad, der Pfähler, der im 16. Jahrhundert eine Zeit lang ein starker Mann war im südöstlichen Europa. Seine Spezialität: Eben das Pfählen, nach allen Regeln der Kunst, bei möglichst lang lebendigem Leib. Solch einen Vorfahr in der Ahnenkette zu wissen, das ändert natürlich so einiges, nicht nur für die Erzählerin. Und einigen so windigen wie findigen Lokal-Honoratioren blüht die Phantasie angesichts der Möglichkeiten, die sich da auftun, Stichwort: Dracula-Park. Oder ist das alles nur Einbildung, ein Fake, den jemand hübsch angerichtet hat und garniert hat, samt gepfähltem Mitbürger?
Dana Grigorcea, geboren 1979, ist in Bukarest aufgewachsen, nach Stationen in Deutschland, Österreich und Belgien lebt sie heute in der Schweiz. Sehr geschickt und gewitzt ist, wie sie in ihrem Roman die historische Ebene mit der aktuellen in Bezug setzt, dabei zugleich auch den Mythos mit der (historischen) Realität ins Spiel bringt – und das Ganze in eine so unterhaltsame wie sprachgewandte Geschichte zaubert. Eine Geschichte, die man auch als Mahnung und Warnung verstehen darf: Vorsicht mit der (nicht nur in Rumänien) grassierenden Sehnsucht nach “dem starken Mann”. Ein starker Roman jedenfalls, der das Narrativ der politischen orientierten Schauergeschichte auf eigene Weise auffrischt und aktualisiert. Ganz abgesehen von seiner sprachlichen Klasse: Dana Grigorcea schreibt seit 2003 auf Deutsch, mit sprudelnder Lust am Erzählen, wie sie die Sprache zum Perlen und Glänzen bringt, das allein ist schon ein großes Vergnügen.
Dana Grigorcea: Die nicht sterben. Penguin Verlag, München 2021. 264 Seiten, 22 Euro.
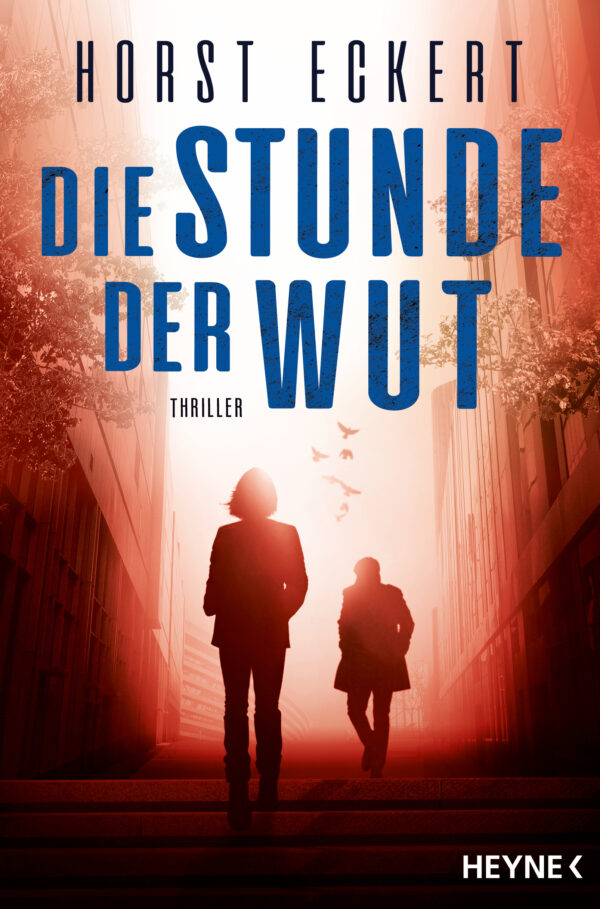
Politischer Autor
(JF) Roland Kracht hat sein Herz auf dem rechten Fleck. Das würde zumindest die Mutter eines in Afghanistan gefallenen Kameraden des ehemaligen Elitesoldaten sagen. Rührend kümmert er sich um die fast blinde alte Dame, kauft ein und begleitet sie zum Arzt. Dabei leidet Kracht selbst unter einer posttraumatischen Störung, die ihn immer wieder den Taliban-Angriff durchleben lässt, bei dem sein Freund getötet wurde. Nächtelang sitzt er vor dem Computer, schläft wenig, trinkt viel und postet Hasskommentare im Internet. Denn Roland Kracht ist ein Nazi. Ob er schon immer so gedacht hat oder sich erst nach seiner Entlassung aus der Bundeswehr radikalisiert hat, bleibt offen. Aber sicher ist, dass er davon träumt, allen „die Deutschland in den Dreck ziehen“, mit Gewalt zu Leibe zu rücken. Gelegenheit dazu hat er immer wieder, wenn er als Mann fürs Grobe des skrupellosen Immobilienmilliardärs Hartmut Osterkamp unterwegs ist.
Roland Kracht, eine handlungstragende Figur in Horst Eckerts neuem Politthriller „Die Stunde der Wut“, entspricht ziemlich genau jenem „soldatischen“ Typ, wie ihn Klaus Theweleit in seinen „Männerphantasien“ exemplarisch dekonstruiert hat. Und ist deshalb die ideale Besetzung, um das Gefahrenpotential des Rechtsradikalismus zu personifizieren. Hasserfüllt und verblendet. Wie geschaffen, einem Mann wie Osterkamp, der die politische Rechte unterstützt, um seine Geschäftsinteressen zu befördern, als Werkzeug zu dienen.
Wer nun glaubt, solche Gestalten seien reine Erfindung, darf gerne mit einschlägigen Suchbegriffen im Netz recherchieren. Schließlich ist Horst Eckert ein politischer Autor. Und ein gewiefter Konstrukteur elaborierter Plots obendrein. Gerne lässt er sein Stammpersonal, Hauptkommissar Vincent Veih und dessen neue Chefin Melia Adan, in dem komplexen Handlungsgeflecht die Übersicht verlieren. Denn außer Osterkamp und Kracht hat die Gegenseite noch einige andere einflussreiche Spieler aufzubieten. Dass angesichts dieser Konstellation das Bedürfnis nach poetischer Gerechtigkeit unerfüllt bleiben muss, versteht sich. Eckert, der seine Geschichte in einer sachlichen, manchmal fast bürokratischen Sprache erzählt, würde diesen Verzicht wahrscheinlich realistisch nennen.
Horst Eckert: Die Stunde der Wut. Heyne Verlag, München 2021. 446 Seiten, 12,99 Euro.
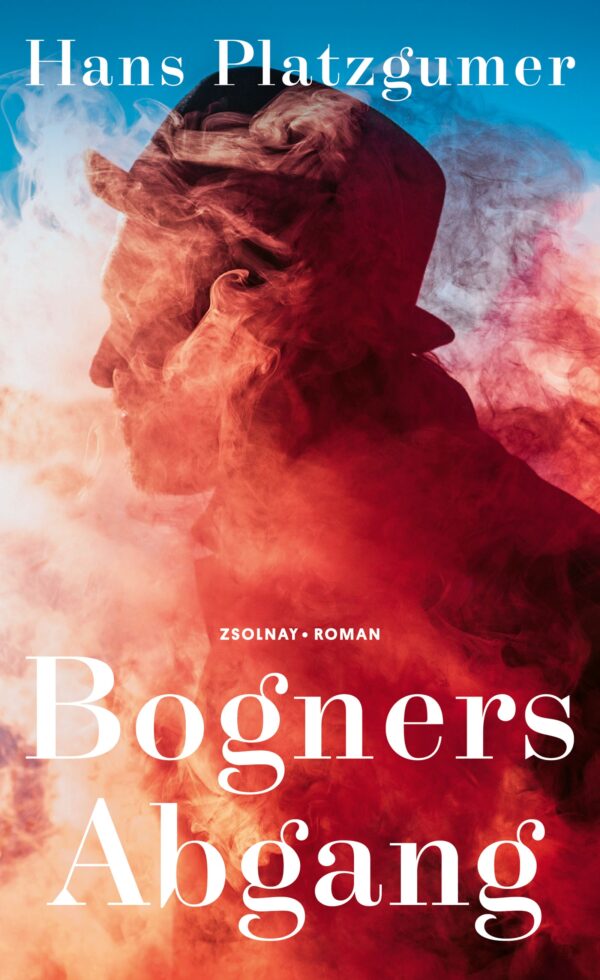
Die Ungewissheit füttern
(rum) Die Kunst, in der Kunst zu leben, nicht mit und schon gar nicht von ihr – für Andreas Bogner, einem der Protagonisten in Hans Platzgumers neuem Roman, funktioniert das zunächst ganz gut. Er hat geerbt und kann sich seiner künstlerischen Arbeit widmen, die nicht nach draußen drängt und ihn dennoch ganz einnimmt und unglücklich macht. Wie ein Besessener tüftelt er an seinen Projekten, für die er eben doch nach Anerkennung giert, entsprechend heftig trifft ihn das Urteil eines Kritikers, als er sich mit einer Arbeit an die Öffentlichkeit wagt. Vernichtend ist es und Bogner bedient. Groll und Selbstzweifel nagen an ihm.
Ein zweiter, rückwärts laufender Erzählstrang beginnt mit einem tödlichen Unfall. Eine Studentin überfährt an einer Kreuzung in Innsbruck eine Person und begeht Fahrerflucht. Ihrer Mutter gesteht sie den Unfall, behauptet aber, das Opfer sei nur leicht verletzt. Die Mutter hilft ihr, die Tat zu vertuschen und doch kommt sie nicht davon los. Ins Leben vor dem Unfall findet sie nicht mehr zurück und jeden weiteren Tag mehren sich auch bei ihr die Zweifel.
Hans Platzgumer, Jahrgang 1969, ist als Musiker (in den 90ern mit HP Zinker und den Goldenen Zitronen, später mehr Elektronisches) und Autor (von Romanen, Essays und Hörspielen) ein produktiver Tausendsassa. Kristallisationspunkt seines aktuellen knapp und präzise erzählten Romans Bogners Abgang ist der Unfall, um den herum sich die aufeinander zulaufenden Geschichten drängen. Ausgiebig widmet sich der um seine Protagonisten kreisende Platzgumer da etwa der grotesken Auseinandersetzung zwischen Künstler und Kritiker, den jeweiligen Befindlichkeiten und jener roten Linie, die da in beide Richtungen überschritten wird. Vor allem aber ist es ein spannender Roman über den Umgang mit Schuld und Ungewissheit, mit Extremsituationen, fatalen Entscheidungen und dem Gefühl, zu weit in die falsche Richtung gegangen zu sein. Und schuldig gemacht hat sich hier am Ende jeder auf seine Art.
Hans Platzgumer: Bogners Abgang. Zsolnay, Wien 2021. 143 Seiten, 20 Euro.
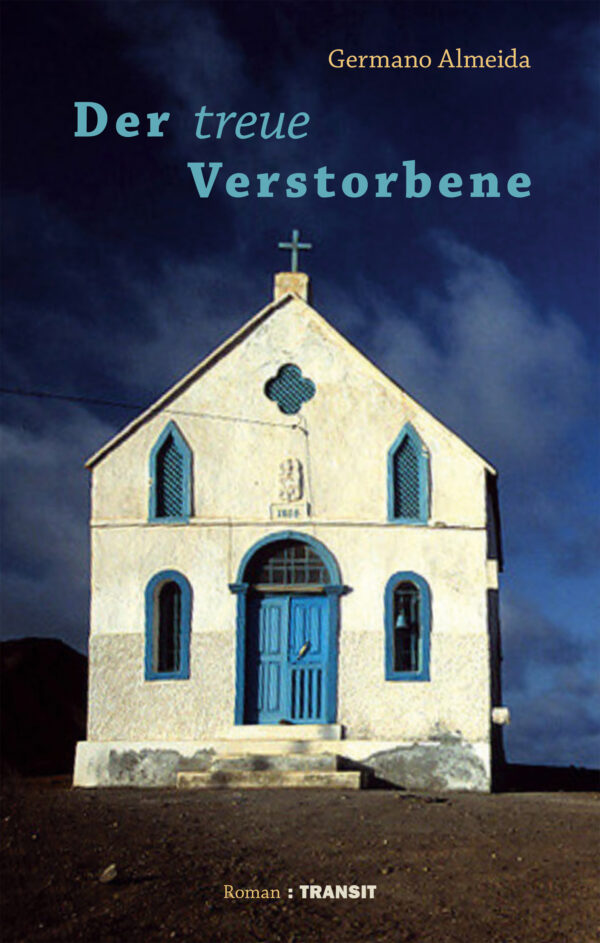
Langweilen können andere
(UN) Literatur aus Kapverde, da geraten wir in – hierzulande – ziemlich unbekannte Gefilde. Selbst auf Wikipedia finden sich gerade mal zehn Namen mit SchriftstellerInnen von der Inselküste vor Westafrika. Man darf annehmen, dass das nicht daran liegt, dass es nicht mehr Autoren und Autorinnen gäbe, denn die Inseln sind bekannt für ihr reichhaltiges Kulturleben – nicht nur in Sachen Musik. In Portugal, bei der ehemaligen Koloinalmacht also, weiß man es zum Beispiel weitaus besser. Denn da ist Germano Almeida wie überhaupt in portugiesisch-sprachigen Welt ein bekannter, erfolgreicher und auch preisgekrönter Schriftsteller. Auf jeden Fall ist er der bekannteste Vertreter der Literatur von den Kapverden. Sehr begrüßenswert also und fast überfällig, dass nun nach vielen Jahren auch mal wieder ein Roman von im ins Deutsche übersetzt wurde:
In Der treue Verstorbene erzählt Germano Almeida die Geschichte eines berühmten kapverdischen Schriftstellers, der allerdings um die zehn Jahre nichts mehr veröffentlicht hat. Dann erscheint doch ein neues Buch, die Premierenlesung soll zum großen Freudenfest werden, mit geradezu nationaler Bedeutung. Allerdings kommt es ganz anders als gedacht, kurz vor Beginn wird der Schriftsteller nämlich von seinem besten Freund erschossen, und zwar im Veranstaltungssaal. Ein Schock! Wie konnte es dazu kommen, was steckt dahinter? Das fragt sich das ganze Land …
Dahinter kann natürlich nur eine Liebesgeschichte stecken, und zwar eine reichlich schräge. Diese Liebesgeschichte ist das Zentrum und der Motor des Romans, drumherum erzählt Almeida von der Gesellschaft und ihren Eigenheiten, von der kapverdischen Zeitgeschichte, von der Migration, denn es leben weit mehr Kapverder rund um die Welt verstreut und in Portugal als auf den Inseln selbst. Ein großer Kessel Buntes also, wenn man so will, allerdings nicht in dem Sinne, dass die Ingredienzien wahllos zusammengemischt wären – facettenreich, vielfältig, auch abgründig, immer aber mit einem Augenzwinkern erzählt Germano Almeida vom Leben und vom Sterben auf den Kapverden. Und das Augenzwinkern ist bei diesem Schriftsteller nicht bloß ein Nebeneffekt, sondern Programm – ein Erzähler, der sein Publikum ganz bewußt nicht bloß unterhalten, sondern amüsieren möchte. Langweilen mit Literatur können andere, genau.
Germano Almeida: Der treue Verstorbene (O Fiel Defunto, 2018). Aus dem Portugiesischen von Michael Kegler. Transit Verlag, Berlin 2020. 304 Seiten, 24 Euro.










