
Kurzbesprechungen von fiction – Bruno Arich-Gerz (ari), Joachim Feldmann (JF), Günther Grosser (gg), Sonja Hartl (sh), Alf Mayer (AM), Ulrich Noller (UN), Frank Rumpel (rum) und Jan Christian Schmidt (jcs) über:
Reinhard Boos: Augenblicke
Candice Fox: Dark
Tom Franklin: Wilderer
Samantha Harvey: Westwind
Doug Johnstone: Der Bruch
Ted Lewis: Schwere Körperverletzung
Tim MacGabhann: Der erste Tote
Graham Moore: Verweigerung
Ottessa Moshfegh: Der Tod in ihren Händen
Julia Phillips: Das Verschwinden der Erde
Nathaniel Rich: King Zeno

Mitreissende Erzählung
(JF) „Es war eine dunkle, stürmische Nacht“. Was so anfängt, kann nicht gut enden. Denn der erste Satz aus Edward Bulwer-Lyttons Roman „Paul Clifford“ (1830) gilt als Musterbeispiel eines schlechten und melodramatischen Schreibstils. Sogar die kleine Bethany, genannt Bean, muss kichern, wenn ihr Bruder Tyler eine fantastische Geschichte, in der sie selbst die Heldin sein darf, so beginnt. Die beiden sitzen spätabends auf dem Dach eines heruntergekommenen Wohnblocks im Edinburgher Stadtbezirk Niddrie, wo sie mit ihrer drogenabhängigen Mutter Angela eine Wohnung teilen. Auf derselben Etage hausen ihre Halbgeschwister Kelly und Barry gemeinsam mit zwei Kampfhunden. Barry ist es auch, der die nächtliche Idylle stört. Denn es gibt Arbeit. Nicht in Niddrie, da ist wenig zu holen. Aber in „gerade mal zehn Minuten“, heißt es in Doug Johnstones Kriminalroman Der Bruch, gelangt man vom „härtesten sozialen Brennpunkt Edinburghs zu den Wohnstätten der Millionäre“. Und hier lohnt es sich einzubrechen. Tyler ist mit dabei, weil er schmal genug ist, auch durch winzige Fenster ins Hausinnere zu gelangen. Dabei hat er sogar ein schlechtes Gewissen, wenn er ein Stofftier für seine kleine Schwester mitgehen lässt. Aber Barry ist ein anderes Kaliber.
Dass im noblen Stadtteil Morningside allerdings nicht nur „das ganze alte Geld“ wohnt, sondern auch Leute aus Niddrie, die auf ungesetzliche Weise reich geworden sind, weiß keiner der drei, als sie in das Haus des Gangsterbosses Deke Holt einsteigen. Tyler ahnt etwas, als er unterm Ehebett eine abgesägte Schrotflinte und im Nachttischchen jede Menge teurer Uhren und Handys findet. Aber es ist zu spät. Holts Frau überrascht das Trio, Barry sticht zu, und Tyler befindet sich in Teufels Küche. Denn während Monica Holt auf der Intensivstation um ihr Leben kämpft, sinnt ihr Mann auf Rache. Gleichzeitig möchte die Polizei, dass Tyler seinen Halbbruder ans Messer liefert. Und dafür gäbe es sogar gute Argumente, denn Barry ist ein sadistisches Monster.
Doug Johnstone, der selbst in Edinburgh lebt, führt uns in Teile der schottischen Hauptstadt, in die sich Touristen kaum verirren dürften, und schildert das soziale Elend schonungslos, aber mit viel Empathie. Tyler Wallace ist ein kluger Junge, den die Umstände zu unvernünftigem Verhalten zwingen. Und das ist ihm bewusst. Deshalb endet der Roman zwar äußerst blutig, aber nicht ohne Hoffnung. Denn Johnstone ist nicht nur ein leidenschaftlicher Chronist sozialer Verwerfungen, sondern auch ein gewiefter Erzähler mit einem Sinn für romantische Effekte, dem mit „Der Bruch“ ein mitreißendes, von Jürgen Bürger in ein sehr lesbares Deutsch gebrachtes Buch gelungen ist.
Doug Johnstone: Der Bruch (Breakers, 2019). Aus dem Englischen von Jürgen Bürger. Polar Verlag, Stuttgart 2021. 308 Seiten, 20 Euro.

Der Boden unter den Füßen
(AM) Dieser Roman, für den National Book Award nominiert, als literarischer Thriller tituliert, rund um die Welt verkauft und für die New York Times eines der zehn besten Bücher des Jahres 2019, ist kein konventioneller Kriminalroman, sondern ein Bernsteinstück, nach stürmischer Nacht an einem wilden Strand gefunden. Was darin eingeschlossen ist, verändert beim Betrachten ständig die Kontur, bleibt Geheimnis – und offene Form. Wenn die „hohe“ Literatur sich des Krimigenres annimmt, kann das ganz schnell peinlich und gruslig altbacken werden, Sibylle Lewitscharoffs Katzenkrimi „Killmousky“ etwa und 20 weitere Bücher zum Fremdschämen fallen mir ein, Das Verschwinden der Erde von Julia Phillips aber ist kein solcher Fall. Dieser Roman bereichert das Genre, bereichert die Literatur. Man muss ihn nicht als Kriminalroman klassifizieren, aber es ist klar Literatur, die das Genre referenziert. Thema ist „das Private“ eines solchen Kriminalfalls, ist der Schatten, den er wirft. Und das Politische dieses Privaten ist die Gewalt gegen Frauen, die hier in allen Spektralfarben schillert. Der Romankern ist Konvention: Es gibt eine Entführung, es gibt Hinterbliebene und Neugierige, einen Ermittler und sehr viel Ort, die Halbinsel Kamtschatka im hintersten Winkel Russlands, nur über die See und auf keinem Landweg erreichbar (Johannes Groschupf hat sich hier einmal auf die Suche nach einem Roman gemacht, siehe unser CulturMag-Special Natur).
An einem Sommertag im August verschwinden zwei Mädchen, die Schwestern Aljona und Sofija, elf und acht Jahre alt. Sie steigen in ein fremdes, schwarzes Auto, werden nie wieder gesehen. In elf Kapiteln, Monat für Monat, vom tragischen August bis zum Juli des nächsten Jahres, folgt der Roman diesem Ereignis. In jedem Kapitel steht eine andere Frau im Mittelpunkt. Dem Polizisten Kolja begegnen wir „richtig“ erst im April, acht Monate nach der Entführung, und zwar, wie er sich beim Frühstück für den Dienst fertig macht. Dann sind wir mit seiner Frau Sonja alleine, das ganze Kapitel lang. Mit ihren Phantasien, mit ihrem Leben, mit ihrer Realität, mit der Gewalt, von der sie zum Teil sexuell phantasiert. „Hallo, Fräulein, wird der Migrant sagen. Beim Klang seiner Stimme wird ihr das Wasser im Mund zusammenlaufen … Sie wird auf die Hütte zeigen. Nimm mich mit da rein, wird sie sagen.“
Das Verschwinden der Erde, der bebende Boden unter den Füßen, das sind die sublimen Schockwellen der Erschütterung, die der Entführungsfall quer durch die Gesellschaft der Halbinsel treibt. Nicht alles davon ist klar zu benennen und eindeutig, vieles bleibt atmosphärisch – darin ist Julia Phillips ganz großartig. Das gilt auch für ihren „sense of place“, das wilde Kamtschatka, wo sie ein bereicherndes Jahr ihres Lebens verbracht hat und uns davon schenkt. Was für ein Debütroman, „von Russland inspiriert und in Amerika geschrieben“, so die Autorin. Bernstein-Klasse.
Julia Phillips: Das Verschwinden der Erde (Dissappearing Earth, 2019). Aus dem amerikanischen Englisch von Pociao und Roberto de Hollanda. dtv, München 2021. Hardcover, 374 Seiten, 22 Euro.
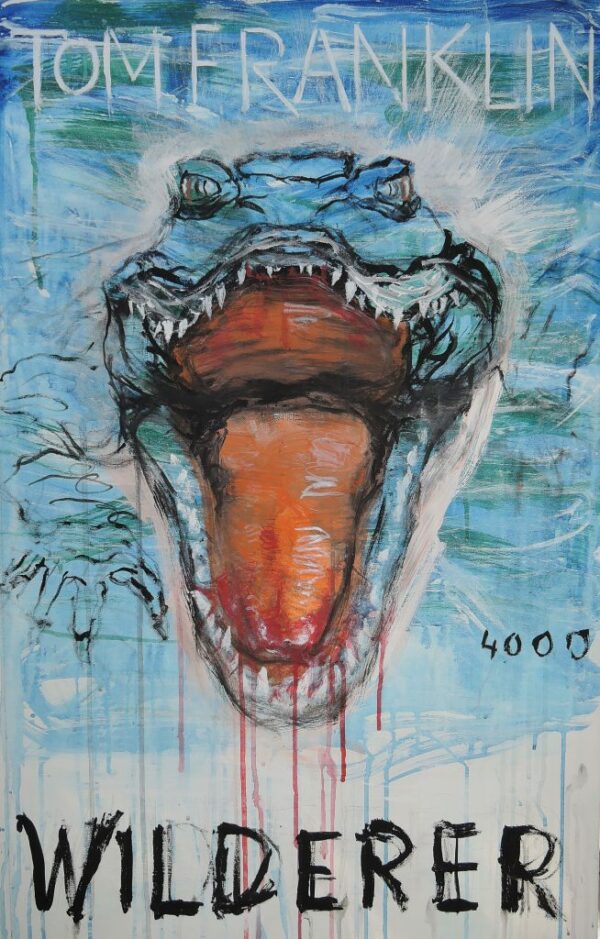
Tief verwurzelt
(jcs) Südstaaten-Prosa von Tom Franklin, der mit seinem Roman „Crooked Letter, Crooked Letter“ von 2010 den Edgar und den Dagger gewann, die beiden wichtigsten Auszeichnungen in der englischsprachigen Kriminalliteratur. Franklins schriftstellerische Karriere begann 1999 mit einer Story-Anthologie, die der Pulpmaster Verlag jetzt unter dem Titel Wilderer veröffentlicht (dt. von Nikolaus Stingl). Der mit „Jagdzeit“ betitelten Einleitung entnehmen wir, dass Franklin im Süden der USA literarisch ähnlich tief verwurzelt ist, wie Joe R. Lansdale im Osten Texas‘ oder James Lee Burke im Iberia County in Louisiana: „Vor vier Jahren, mit dreißig, bin ich aus dem Süden weggegangen, zu einem weiterführenden Studium in Fayetteville, Arkansas, wo mir unter den dorthin verpflanzten Yankees und Weststaatlern klar wurde, welches Glück ich hatte, hier in diesen Wäldern aufgewachsen zu sein, unter Wilderern und Geschichtenerzählern. Ich weiß natürlich, daß Arkansas für die meisten Leute zum Süden zählt, aber ist nicht mein Süden. Mein Süden – der mir bis heute im Blut liegt und meine Vorstellungswelt bestimmt, der Süden, in dem diese Geschichten spielen – ist das südliche Alabama, üppig, grün und voller Tod, die waldreichen Countys zwischen dem Alabama und dem Tombigbee River.“
Tom Franklin: Wilderer (Poachers, ##). Deutsch von Nikolaus Stingl. Pulp Master, Berlin 2020. ####
Nah an der Wirklichkeit

(UN) Mexiko, irgendwo in der Provinz, abends. Zwei Journalisten, die es für eine Reportage über die Fracking-Industrie in die Stadt Poza Rica verschlagen hat, finden auf dem Heimweg am Stadtrand eine grausam zugerichtete Leiche. Bei dem Toten handelt es sich um einen jungen Mann, der die örtlichen Proteste angeführt hat – gegen ein Kartell aus Polizei, organisiertem Verbrechen, Politik, Industrie und Sicherheitsdiensten, die Leute also, die auf Kosten anderer und der Umwelt am Fracking dicke verdienen. DICKE verdienen. Reporter Andrew, der Ire, möchte weiter fahren; Carlos der mexikanische Fotograf will dran bleiben. Das bezahlt er bald mit dem Leben – und erst nach und nach realisiert man beim Lesen, dass es viel weniger eine Frage der Ehre ist für Andrew, die Story komplett zu recherchieren und aufzuklären – als eine der Liebe …
Der erste Tote ist ein sehr guter Journalistenkrimi, der die Koordinaten dieses Subgenres auf eine ganz eigene Weise gekonnt durchspielt – und zwar mit autobiographischer Substanz. Wie sehr und wie genau das mit hineinspielt ins Geschen, ist nicht klar; auch der Autor stammt aus Irland, hat lange in Mexiko gelebt und gearbeitet. Die Energie seiner Story rührt jedenfalls ersichtlich auch aus ihrer Authentizität: Tim MacGabhann verdichtet und fiktionalisiert die Beobachtungen und Recherchen prototypisch, die er journalistisch nicht aufarbeiten kann oder will, vermutlich auch aus Sicherheitsgründen, dabei bewahrt er sich durchgängig bis zum Schluss das entsetzte, schockierte Staunen angesichts dieser völlig verrohten Variante von “Kapitalismus”, wie sie teils in Mexiko gang und gäbe zu sein scheint.
Tim MacGabhann: Der erste Tote (Call him mine, 2019). Aus dem Englischen von Conny Lösch. Suhrkamp Verlag, Berlin 2020. 274 Seiten. Euro 15,95.
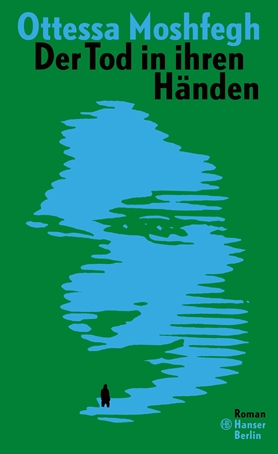
Ein zerbröselndes Leben
(rum) Magda wurde ermordet. So viel steht für Vesta Guhl fest. „Vesta Guhl sagten sie? Was ist das denn für ein Name?“, fragt sie sich in einem Tagtraum selbst und erhält „keine Antwort“. Die 72-Jährige in Ottessa Moshfeghs neuem Roman ist nach dem Tod ihres Mannes mit ihrem Hund Charlie wohl in den Osten der USA und dort in eine abgelegene Waldhütte gezogen. Bis dahin hatte sie mit ihrem Mann Walter in einem abgelegenen Farmhaus gelebt, „verloren inmitten endloser Hektar Grasland, die einfach nur leer waren“. An ihrem neuen Wohnort scheint alles ganz gut zu laufen, bis sie auf einem Waldspaziergang einen Zettel findet: „Sie hieß Magda. Niemand wird je erfahren, wer sie ermordet hat. Ich war es nicht. Hier ist ihre Leiche.“ Allein: Da ist keine Leiche. Doch Vesta kann an nichts anderes mehr denken. Wer war diese Magda und wer hatte sie weshalb umgebracht? Blake heißt der Mörder. Das steht für Vesta fest, genau so wie der englische Naturmystiker und Dichter William Blake.
Magda war 19, kam aus Weißrussland in die USA, jobbte bei McDonalds, lernte Blake kennen, wohnte bei ihm und seiner Mutter in einer feuchten Kellerwohnung. All das bastelt sich Vesta anhand eines Leitfadens für angehende Schriftsteller zusammen, über den sie bei einer Internetrecherche in der Bibliothek gestolpert ist. Sie arbeitet an der Figur Magda und nähert sich dabei sich selbst. Doch allmählich überwuchert ihre Fantasie die Realität. Sie bezieht Menschen aus dem Ort in ihre Geschichte mit ein, immer absurder geraten deshalb ihre Begegnungen. Und es passieren seltsame Dinge. Ihr Hund ist plötzlich weg, jemand gräbt ihre gerade im Garten ausgebrachten Blumensamen wieder aus, ihr Auto macht keinen Mucks mehr.
Einem allmählichen Verschwinden, einem langen Abschied, einer Suche nach sich selbst schaut man da zu. Ottessa Moshfeghs Protagonistin klingt lange einigermaßen vernünftig nach einer Frau, die nach „einem Leben in Geiselhaft“ die restlichen Jahre selbstbestimmt verbringen will. Walter, schreibt sie, „war wirklich unfähig zu ekstatischen Gefühlen gewesen; er hatte schreckliche Angst vor Spaß und Freiheit gehabt“. Doch die alten Lügen blühen auch in ihrem neuen Leben weiter, das rasch an allen Ecken zu bröseln beginnt, sacht aus den Fugen kippt. Wie viel mag von dem, was sie da erzählt hat, stimmen, wie viel glaubt sie selbst? Und wer war diese Magda?
Der Lücke zwischen Wahn und Wirklichkeit, der Diskrepanz von Wollen und Können, hat die in Los Angeles lebende Ottessa Moshfegh bereits etliche Texte (alle bei Liebeskind erschienen) gewidmet, zuletzt mit kantigem Humor und sehr variantenreich in ihrem eindrucksvollen Story-Band „Heimweh nach einer anderen Welt“. Hier arbeitet sie mit ein paar Thrillerelementen, die sie als Motor für die bisweilen etwas absehbar geratene Geschichte verwendet, diesen Ansatz aber durch ihre unzuverlässige Erzählerin immer wieder unterläuft. Spannend ist das dennoch, hat Moshfegh doch ein Faible für wunderbar bizarr anmutende Situationen, während sie lächelnd die ganz alltäglichen Abgründe ihrer Figuren ausleuchtet.
Ottessa Moshfegh: Der Tod in ihren Händen (Death in her hands, 2020). Aus dem Englischen von Anke Caroline Burger. Hanser Berlin, Berlin 2021. 256 Seiten, 22 Euro.
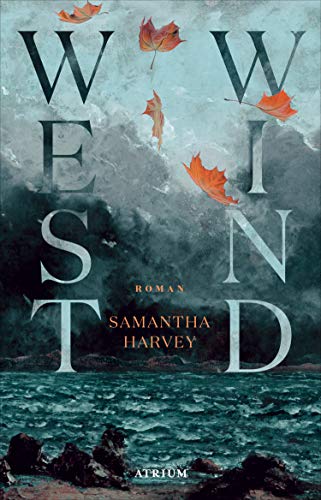
Reichhaltig und schillernd
(gg) Wer Mittelalter, Priester und Mord zusammenbringt, evoziert natürlich Umberto Ecos Millionenseller „Der Name der Rose“ von 1980. Die englische Schriftstellerin Samantha Harvey wagt sich mit ihrem vierten, im Jahr 1491, kurz vor der Reformation angesiedelten historischen Kriminalroman Westwind tatsächlich auf dieses Feld – und findet problemlos ihren eigenen Platz. Der reichste Mann des kleinen Dorfes Oakham im Süden Englands stirbt im reißenden Fluss, und der junge Priester John Reve fragt sich, ob Neid und Missgunst zu Mord führen konnten. Profitieren könnten viele, auch in den besser gestellten Dörfern der Umgegend, wo man mit Wolle und importiertem Zucker Geld verdient, während Oakham darbt. Reve nimmt die Beichten ab und zieht seine Schlüsse.
Mit einem sich langsam aufdröselnden, über vier Tage rückwärts erzählten Plot entwickelt Samantha Harvey das schillernde Bild einer Übergangsepoche, wo Wissen und Vernunft sehr behutsam Einzug halten und neben der immer noch ungebrochenen Dominanz von Glaube und Vorsehung bald eine eigene Macht bilden werden. Für Schmutz, Dreck und Armut entschädigt Harveys schöne und reichhaltige Sprache.
Samantha Harvey: Westwind (The Western Wind, 2019). Aus dem Englischen von Steffen Jacobs. Atrium-Verlag, Zürich 2020. 384 Seiten. 22 Euro.
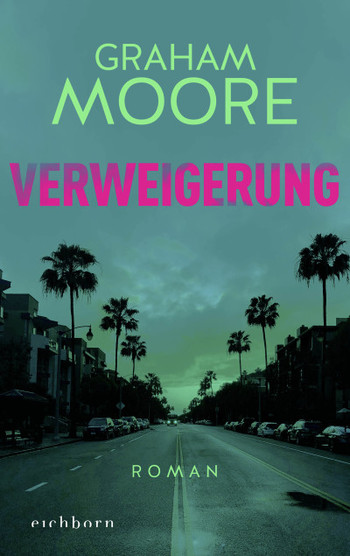
Mehr als Konfektion
(JF) Ein fünfzehnjähriges Mädchen verschwindet spurlos. Auf ihrem Handy finden sich Nachrichten und Bilder, die auf eine sexuelle Beziehung zu einem ihrer Lehrer hindeuten. Als dessen Auto untersucht wird, stößt man auf Blutspuren auf dem Beifahrersitz und im Kofferraum. Sie stammen von der vermissten Schülerin. Der Mann wird des Mordes angeklagt, doch das Urteil der Jury lautet „nicht schuldig“. Mangels eindeutiger Beweise. Die öffentliche Empörung ist groß. Später wird der Freigesprochene wegen Besitz von Kinderpornographie zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Schließlich zeigten die Fotos auf dem Handy eine Minderjährige.
Wie sich unschwer denken lässt, spielt das Ganze in den USA. Das vermeintliche Opfer ist weiß und Tochter eines millionenschweren Geschäftsmannes, der mutmaßliche Täter ein Afro-Amerikaner aus kleinen Verhältnissen. Ausschlaggebend für den Freispruch war das Engagement der Geschworenen Maya Seale, die sich nicht mit dem vorliegenden Beweismaterial zufriedengeben wollte und die anderen elf Jurymitglieder überzeugte. Man kennt die einschlägigen Vorbilder aus Literatur und Film. Doch die Geschichte ist noch nicht zu Ende.
Zehn Jahre später ist die junge Frau eine mit allen Wassern gewaschene, erfolgsverwöhnte Strafverteidigerin. Und gar nicht begeistert, als der alte Fall zum Gegenstand einer Fernsehdokumentation werden soll, zumal ihr Mitgeschworener Rick, der immer noch von einem Fehlurteil ausgeht, erzählt, er habe neue, untrügliche Schuldbeweise auftreiben können. Dass er und Maya während des Prozesses eine heftige (übrigens streng verbotene) Affäre hatten und im Unfrieden auseinandergingen, macht die Sache nicht besser. Wieder geraten sie in Streit, und als Maya wenig später Ricks Leiche findet, ist sie selbstredend die Hauptverdächtige.
Trotz all ihrer Bemühungen herauszufinden, wer wirklich für Ricks Tod verantwortlich ist, bleibt das auch so, bis in den letzten drei Kapiteln von Graham Moores Justizthriller „Verweigerung“ holterdiepolter ans Licht gezerrt wird, was tatsächlich passiert ist. Manches davon konnte man ahnen, anderes ist tatsächlich überraschend. Was dieses Buch aber tatsächlich von anderen Genreprodukten unterscheidet, ist die Sorgfalt, mit der Graham die Mitglieder der Jury und ihre individuellen Zwangslagen charakterisiert. Ein gewöhnlicher Spannungsroman wird auf diese Weise zur eindringlichen Sozialstudie. Und das macht ihn lesenswert.
Graham Moore: Verweigerung (The Holdout, 2020). Aus dem amerikanischen Englisch von André Mumot. Eichborn Verlag, Köln 2020. 395 Seiten, 22 Euro.
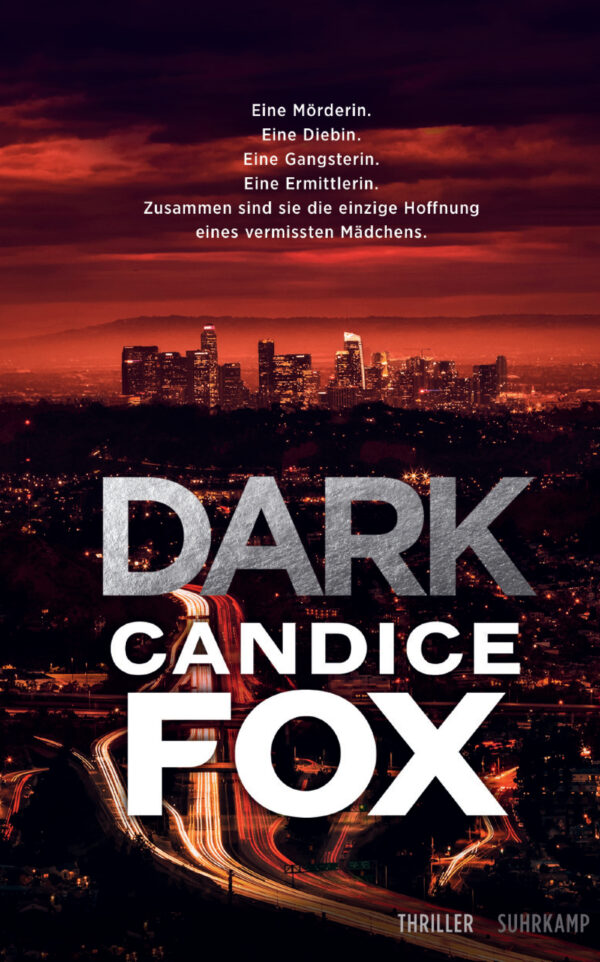
Vier Frauen und ein Raub
(sh) Zehn Jahre hat Blair Harbour im Gefängnis gesessen, nachdem sie ihren Nachbarn erschossen hat. Seit einem Jahr ist sie nun auf Bewährung draußen und jobbt an einer Tankstelle. Sie tut alles dafür, es nicht vermasseln, denn sie hat einen Sohn, der bei einem befreundeten Ehepaar lebt und zu dem sie mehr Kontakt haben will. Dann wird eines Nachts die Tankstelle überfallen, in der sie arbeitet. Sie warnt die junge blonde Diebin, dass die Tankstelle einem Kartell gehört, aber das Mädchen ist so verzweifelt, dass es ihr egal ist. Blair indes ist im Grunde genommen ein guter Mensch. Also gibt sie der Räuberin, was in der Kasse ist, und füllt sie hinterher mit ihrem eigenen Geld wieder auf.
Dieser Überfall könnte eine kurze Störung ihres Alltags sein, doch dann taucht ihre ehemalige Zellengenossin Sneak auf. Sneaks Tochter Dayly ist verschwunden. Sie war es, die Blairs Tankstelle überfallen hat. Und Sneak will, dass Blair ihr hilft, sie wiederzufinden. Blair schuldet Sneak etwas, ohne sie hätte sie das Gefängnis kaum überstanden. Also stimmt sie widerwillig zu – und sucht abermals eine ehemalige Mitgefangene auf: die gefährliche Ada Maverick, die ein eigenes Gangsterimperium führt, aber Blair etwas schuldet. Und die Polizistin Jessica Sanchez, die gerade ein Sieben-Millionen-Dollar-Haus geerbt hat und deshalb von ihren Kollegen fertig gemacht wird.
Candice Fox hat mit „Dark“ das heimatliche Australien gegen Los Angeles eingetauscht und erzählt von vier sehr unterschiedlichen Frauen mit einem zumindest teilweise gemeinsamen Ziel. Blair ist die Nette, die Fürsorgliche, die sich kümmert, aber auch die Kontrolle und den Status vermisst, den sie früher als Ärztin hatte. Sneak ist chaotisch und dreist, sie stiehlt alles, was sie in die Finger bekommt. Ada ist skrupellos und hart – genau das fehlt den beiden andere Frauen. Die Polizistin Jessica Sanchez hat damals Blair hinter Gittern gebracht und fürchtet nun, sie könnte einen Fehler gemacht haben. Jede Frauen hat Eigenheiten, eigene Probleme und eine eigene Agenda, die sich nach und nach zeigt. Sobald sie aber ihre Erkenntnisse und ihr Wissen zusammenwerfen, sind sie nahezu unschlagbar.
Es sind sehr genau gezeichnete Charaktere, insbesondere Blair und Jessica bieten Anknüpfungspunkte für Leser*innen, Ada und Sneak vor allem für eigenwilligen, exzentrischen Charme. Dazu kommen weitere gute Nebenfiguren und – wie immer bei Fox – Tiere: eine Wühlmaus namens Hugh Jackman ist es, um die Blair sich kümmert.
Diese Konstellation erinnert an Elmore Leonard (auf den die Rückseite des Covers auch verweist) und George V. Higgings. Jedoch besetzt Fox nicht einfach männliche Figurentypen mit Frauen um – bei ihr spiegelt sich in allen Facetten wider, dass es Frauen sind, die sich hier zusammentun. Sie wollen eine Tochter retten, ohnehin spielen Kinder eine wichtige Rolle, es müssen aber nicht die eigenen sein, Nichten und Nachbarssöhne sind auch wichtig. Dass sich die Frauen um andere kümmern, ihnen helfen, macht sie nicht weicher oder schwächer, aber auch nicht per se zu besseren Menschen.
Die (Wahl-)Verwandtschaften sind ein entscheidendes Motiv in diesem Roman: sie stacheln an, führen ins Verderben oder ein besseres Leben. Und sie beschränken sich nicht auf die Beziehungen zu Kindern oder Jüngeren. Es ist die Vorstellung von der Polizei als einer Familie, die Jessica Sanchez zur Polizei gebracht hat. Sie dachte, wenn sie hart genug arbeitet, wird sie Teil dieser Familie. Aber sie lernt auf die harte Tour, dass diese Familie nur diejenigen aufnimmt, die nicht ausscheren, die weiß und männlich sind. Denn manchmal kann man sich eine Zugehörigkeit zwar wünschen und alles für sie tun, aber sie kommt nicht zustande.
Candice Fox: Dark. (Dark, 2020) Aus dem Englischen von Andrea O’Brien. Suhrkamp, Berlin 2020. 395 Seiten. 15,95 Euro.
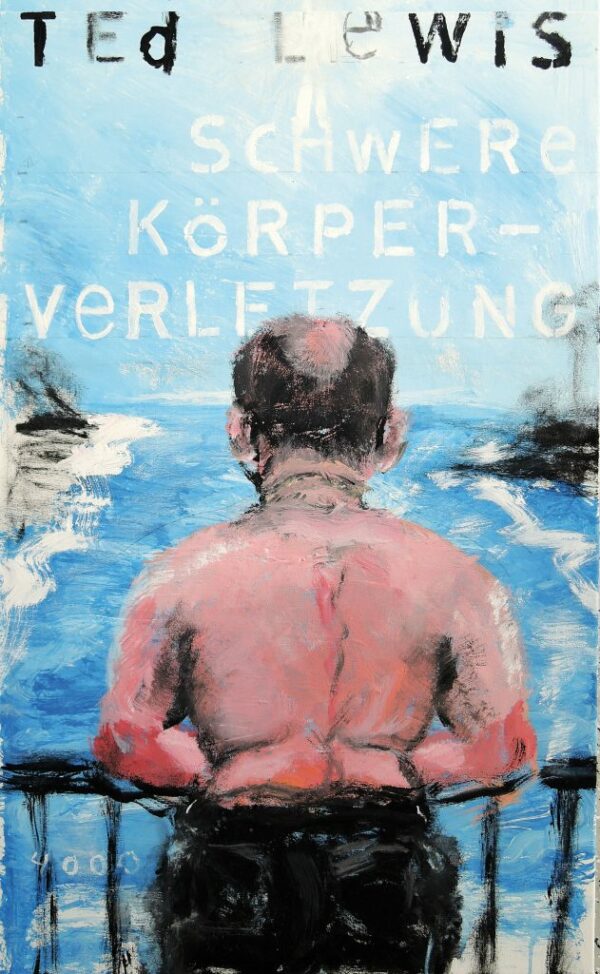
Ein Klassiker des Genres
(JF) George Fowler hat die Kontrolle verloren. Der schwerreiche Geschäftsmann, Herr über ein weitverzweigtes Handelsunternehmen, fühlt sich von der Konkurrenz und von illoyalen Mitarbeitern bedroht. Also schlägt er um sich, foltert und tötet. Denn Fowler vertreibt keine gewöhnliche Ware. Im Britannien der siebziger Jahre ist Pornographie verboten, also kann man mit 20-minütigen Schmuddelstreifen auf 8 oder 16 Millimeter viel Geld verdienen. Und wenn man skrupellos genug ist, auch Filme ins Angebot zu nehmen, die bis zum Mord vor der Kamera authentisch sind, kennt der Profit keine Grenze nach oben.
Roy Carson ist ein einsamer Mann mit einem Alkoholproblem. Ganz allein lebt er in einem Bungalow nahe der Küstenstadt Mablethorpe in Lincolnshire. Es ist Vorsaison, also trifft er nicht viele Menschen. Manchmal unternimmt er Ausflüge in die Stadt, geht in den Pub oder vertreibt sich die Zeit in einer Spielhalle. Er lernt eine junge Frau kennen, aus deren Verhalten er nicht schlau wird, und stellt Nachforschungen an. Doch als er glaubt, dem Geheimnis auf die Spur gekommen zu sein, ist es zu spät. Aber vielleicht gab es auch gar kein Geheimnis.
Georg Fowler ist Roy Carson. Von seinem Imperium sind ihm Kellerregale voller Filmbüchsen und schreckliche Erinnerungen geblieben. Denn seine Befürchtungen waren berechtigt. Allerdings auf ganz andere Weise, als er es sich hat ausmalen können.
„GBH“, die übliche Abkürzung für „grievous bodily harm“ („Schwere Körperverletzung“), ist der letzte Roman der früh verstorbenen Noir-Legende Ted Lewis und gilt als sein bestes Werk. Finsterer kann es kaum werden. Dabei erspart uns Fowler/Carson, den Lewis in abwechselnden, meist ziemlich kurzen Kapiteln selbst von seinen zwei Existenzen erzählen lässt, weitgehend die schrecklichen Details. Andeutungen genügen, damit wir wissen, was passiert. Der Erzählton ist sachlich, fast unterkühlt. Die Fowler-Kapitel dominieren Dialoge, in denen es auch mal um Fußball und normale Filme geht. Der Effekt ist umso stärker.
„GBH“ erschien 1980 in Großbritannien, die erste deutsche Fassung folgte zehn Jahre später. Nun liegt der Roman in einer neuen Übersetzung vor. Während Angelika Müller den Ton des Originals in den beschreibenden Passagen recht gut trifft, ließe sich manche Entscheidung bei Eindeutschung der Gespräche diskutieren. Da wird aus zum Beispiel „his Mrs“ als „sein Gespons“ wiedergegeben, während der Slangausdruck „Old Bill“ (für die Polizei), den hierzulande nicht jeder kennen dürfte, unübersetzt bleibt. Dennoch ist es unbedingt zu begrüßen, dass mit „Schwere Körperverletzung“, so der, entgegen einer momentan beliebten Praxis, unveränderte deutsche Titel, ein Klassiker des Genres auch bei uns wieder zugänglich ist. – Das Vorwort von Derek Raymond dazu lesen Sie bei uns in dieser Ausgabe (d. Red.).
Ted Lewis: Schwere Körperverletzung (GBH, 1980). Aus dem Englischen von Angelika Müller. Pulp Master, Berlin 2020. 334 Seiten, 14,80 Euro.
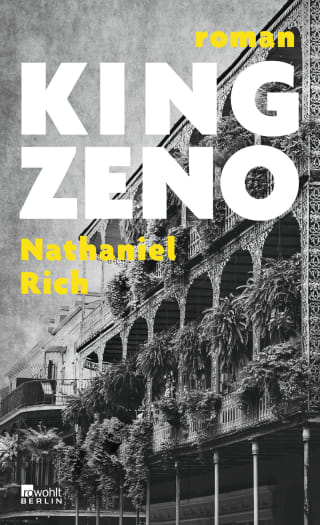
Geschichte nahbar
(UN) „Alle Schulen, staatlich, privat oder kirchlich sind geschlossen. Alle Kinos und Theater geschlossen. Alle Kirchen geschlossen. Alle öffentlichen Zusammenkünfte, Konzerte und Sportveranstaltungen abgesagt. Menschenansammlungen auf Straßen verboten.“ Und so weiter und so fort. Dieses Zitat wirkt wie ein Blick auf ein beliebiges Land in der Corona-Krise, im Jahr 2020. Tatsächlich befinden wir uns in New Orleans, im Oktober 1918. Eine von vielen originalen Zeitungsmeldungen, die Nathaniel Rich in seinen Roman King Zeno eingewirkt hat.
Nach knapp 200 Seiten hält also auch noch die Spanische Grippe Einzug ins Geschehen, da kann es eigentlich schon nicht mehr schlimmer werden – und die Seuche wird sich rasend schnell verbreiten, quer durch alle gesellschaftlichen Sphären. So wird sogar der Axtmörder, der in der Stadt sein Unwesen treibt, zum Nebenthema, für eine Zeit lang zumindest. Ein Corona-Schnellschuss, könnte man vermuten, aber King Zeno ist im amerikanischen Original schon 2018 erschienen. Gutes Timing – aber sicher kein Glückstreffer. Denn das Prinzip Infektion ist in vielerlei Hinsicht ein entscheidender Faktor in diesem historischen Kriminalroman, der weit mehr will, als einfach nur die Geschichte eines Verbrechens zu erzählen, nämlich Geschichte nahbar machen, in die Geschichte entführen. Und die Mechanismen, die Geschichte machen, oft sind es verbrecherische, offen legen.
Dabei spielen eben verschiedenste Infektionsgeschehen ihre Rollen: Das organisierte Verbrechen mit seiner Gier. Der kapitalistische Traum unendlichen Profits. Der Wunsch nach Wohlstands-Transformation. Weltkriegstraumatisierungen. Der unsägliche Rassismus – und der Jazz, der alle Hoffnung auf Zukunft, auf ein anderes Leben birgt. Allesamt jedenfalls Geschehen mit hoher Virenlast – die Verwerfungen bewirken werden wie nichts zuvor.
King Zeno ist ein Roman, der sich liest, wie sich die Serie „Babylon Berlin“ anschaut: Opulent, plakativ, gewaltig. Mit exquisit ausgesuchten und gestalteten Charakteren, Konflikten und Handlungsorten. Man merkt dem Ganzen fast jederzeit an, dass Nathaniel Rich mit seiner Geschichte ein ganz großes Ding landen wollte. Mitunter strotzt der Roman so vor Kraft, dass er etwas zur Unbeweglichkeit neigt, aber alles in allem löst er das Versprechen, das sein Autor gibt, hervorragend ein, insbesondere übrigens mit sprachlichen Mitteln. Ein Roman wie ein Mahlstrom, der einen anzusaugen und mitzureißen droht in den Untergang, der doch eigentlich kommen muss, anders kann es gar nicht sein. Gut zu wissen, dass solch eine Reise gerade die sicherste Weise ist, seine Zeit zu verbringen, angesichts der realen Infektionslage draußen.
Nathaniel Rich: King Zeno (King Zeno, 2018). Aus dem amerikanischen Englisch von Henning Ahrens. Rowohlt Berlin, 2020. 24 Euro.

Lehrer, Schüler, Zeitung: Tod
(ari) Nick Scholl ist 27 Jahre alt und immer noch nicht gesettled. Als Journalist hat er gerade mal das Volontär-Level erreicht und ist weit entfernt von einer Festanstellung für eine Mainzer Tageszeitung. Als Lehrer für Fremdsprachen und Deutsch ist er ein besserer Quereinsteiger, auch wenn er die Qualifikation für einen Job an einem Gymnasium besitzt.Beste Voraussetzungen für einen besonderen Auftrag. Mit seinen halb ausgebildeten Doppelqualifikationen wird er zum Undercover-Ermittler, der den seltsamen Tod seines Vorgängers an der Schule aufklären und für seine Zeitung exklusiv breittreten soll. Reinhard Boos‘ Augenblicke näht die Zusammenhänge der beiden Branchen – Schule und Zeitung – und ihren Figuren gekonnt zusammen. Sein ‚Protokoll einer Katastrophe‘ (Untertitel) ist die Chronologie von Erste Person-Singular-Schnipseln; es geht den erzählerisch herausfordernden Weg über die Perspektiven von Gymnasiallehrern, die alle miteinander was am Laufen haben und miteinander verstrickt sind, von Schülern (denen es nicht anders geht) und Redakteuren-cum-Schwiegersöhnen von Schulleitern.
Boos‘ Stimmen geben zum Besten, was im August 2016 zum Wassertod des so charmanten wie spielsüchtigen Junglehrers Leppich geführt hat. Nick Scholls Schnüffeleien führen zu einem Whodunnit-Ende, das mit Kritik am weiterführenden Schulgewese der Gegenwart nicht spart. Für einen Regionalkrimi ist das absolut beyond average.Überzeugend geraten Boos neben den Einblicken in die schulische Wirklichkeit von heute die Darstellungen von ‚Zeitungsalltag‘. Beide sind mit unschönen Krusten bedeckt. Das Schulwesen bedeckt der Schimmelpilz eines bürokratisierten Von-oben-nach-unten-Durchregiments, in dem weder der Schulamtsdirekt noch die Studienrätin unschuldig bleiben und die Finger voneinander lassen. Und die Branche der lokalen Tagespublizistik sieht sich den Qualitätsjournalismus-gefährdenden Ambitionen globaler Übernahmekandidaten ausgesetzt.Auch wenn die Continuity nicht immer zu stimmen scheint und weil der Tonfall der eingefangenen Milieus stimmt: ein empfehlenswerter Roman für alle, die in Mainz, dem Rheingau und der Frankfurter Gegend einen Krimischriftsteller und einen kleinen Verlag (wieder) entdecken möchten.
Reinhard Boos: Augenblicke. Rheinlese Verlag, Ingelheim 2020. 14,90 Euro. Zur Zeit nur erhältlich unter: info@bildtrifftbuch.com










