
Kurzbesprechungen von fiction – Hanspeter Eggenberger (hpe), Ulrich Noller (UN), Frank Rumpel (rum) und Thomas Wörtche (TW) über:
Johannes Anyuru: Sie werden in den Tränen ihrer Mütter ertrinken
David Diop: Nachts ist unser Blut schwarz
Nava Ebrahimi: Das Paradies meines Nachbarn
Beth Ann Fennelly und Tom Franklin: Das Meer von Mississippi
Tahar Ben Jelloun: Schlaflos
Martin Cruz Smith: Die Spur des Bären
Jessica Barry: Nachtflucht – Hinter dir der Tod

Morden und schlafen
(rum) Schlaflosigkeit macht den namenlosen Protagonisten im neuen Roman von Tahar Ben Jelloun mürbe. Für ein paar Stunden Schlaf ist der in Tanger lebende Drehbuchautor zum Äußersten bereit – und es hilft tatsächlich. Indem er andere um die Ecke bringt, findet er selbst in den Schlaf. Seine Opfer sind ausnahmslos schwer krank. Er sieht sich deshalb nicht als Killer, der er ist, sondern als „Todesbeschleuniger“, der freilich selbst unmittelbar von der Tat profitiert. Sein erstes Opfer ist seine kranke Mutter, doch weitet er nach und nach das Feld. Er nimmt sich unter anderem einen Mann vor, der in den 1970er und 80er Jahren unter König Hassan II. Oppositionelle folterte, später einen Mafiaboss, den reichsten Banker Marokkos. Je schlimmer die Typen, desto besser sein Schlaf. Er nennt es Schlafkreditpunkte, die da vom Sterbenden auf ihn übergehen – und die fallen bei einem üblen Charakter und bei wichtigen Leuten sehr viel höher aus als bei einem rechtschaffenen Namenlosen. Die gesellschaftliche Hierarchie funktioniert eben bis in den Schlaf. Und er erkennt noch etwas: Die größten Egomanen, die skrupellosesten Verbrecher genießen meist einen wunderbar unbelasteten Schlaf.
Gegen die politischen Verhältnisse in Marokko hat Tahar Ben Jelloun schon als junger Mann in den späten 1960er Jahren aufbegehrt, nahm an Studentenprotesten teil und wurde als Oppositioneller in ein Militärlager gesteckt. 1971 gelang ihm die Ausreise nach Frankreich, seither lebt er in Paris. Er ist vielfach ausgezeichneter Autor von Romanen und Sachbüchern, in denen er sich mit Migration, Fundamentalismus und gesellschaftlichen Strukturen im Maghreb, wie in Frankreich auseinandersetzt. Mit Schlaflos hat der heute 74-jährige Autor und Psychotherapeut nun seinen ersten Kriminalroman geschrieben, vielmehr eine rabenschwarze Groteske, eine Farce, mit der Ben Jelloun ganz offensichlich seinen Spaß hatte und sich ganz nebenbei Gedanken über das Leben macht, über die Zeit, das Sterben, aber eben auch über die massiven Schieflagen in der marokkanischen Gesellschaft.
Tahar Ben Jelloun: Schlaflos (L’insomniaque, 2019). Aus dem Französischen von Christiane Kayser. Polar-Verlag, Stuttgart 2021. 215 Seiten, 20 Euro.
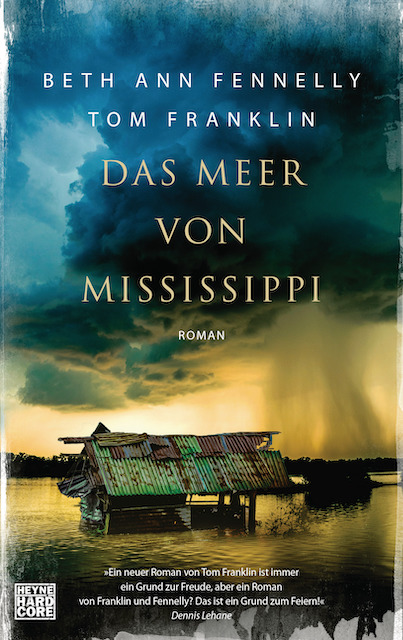
Alles da, alles fließt
(TW) Es ist ein epischer Stoff, den sich das Ehepaar Beth Ann Fennelly und Tom Franklin für ihren Roman Das Meer von Mississippi vorgenommen hat. Die „große Flut“ von 1927 war vermutlich die größte Naturkatastrophe, die die USA zumindest bis dahin getroffen hatte. Anhaltende Regenfälle führten zu Dammbrüchen entlang des mächtigen Mississippis, 70.000 Quadratkilometer Land wurden überschwemmt, Hunderttausende Menschen obdachlos, die genaue Anzahl von Toten ist nicht abzuschätzen. Staatliche Hilfsmaßnahmen waren ineffektiv, von Korruption und Partialinteressen sabotiert.
Der amtierende Präsident Calvin Coolidge legte eine bemerkenswerte Indolenz an den Tag, für seinen „Krisenmanager“ Herbert Hoover war die Flut das Sprungbrett ins Weiße Haus. Ganz besonders hart traf das, was man heute Behördenversagen nennen würde, die in den Südstaaten marginalisierte schwarze Bevölkerung, die letztendlich zunehmend in den Norden abwandern musste.
Um diese apokalyptische Situation erzählbar zu machen, ziehen Fennelly und Franklin einen oberflächlich kriminalliterarischen Plot ein: Die beiden Prohibitionsagenten Ted Ingersoll und Ham Johnson sollen eigentlich Schwarzbrennernester ausheben und nach mutmaßlich ermordeten Kollegen suchen. Als Ingersoll ein Baby findet, das ein Massaker an seinen Eltern überlebt hat, vertraut er es Dixie Clay an, die ihr eigenes Kind jüngst verloren hat.
Dixie Clay ist Schwarzbrennerin und zudem mit dem Gangster Jesse verheiratet, der im Auftrag von finanzkräftigen „Bankiers“ aus New Orleans den Damm bei Hobnob, einer fiktionalen Kleinstadt, sprengen soll, um das Wasser von New Orleans wegzuleiten. Ingersoll und Clay verlieben sich, doch dann kommt die Flut.
Den Stoff, den die Kulisse bietet, reizt das Duo weidlich aus: Naturkatastrophe, Liebe, Gangster, Saboteure, Rassismus, politische Ranküne, Prohibition, Korruption, Action und Gewalt, Natur, Geburt und Tod, Loyalität und Verrat, bizarre Figuren und dazu ein süßes Baby. Alles ist da, alles fließt, um in der Metapher zu bleiben, ineinander.
Und weil Ted Ingersoll, für einen Weißen dieser Zeit ungewöhnlich, ein großer Blues-Freak und -Musiker ist, steckt darin ein Verweis: „Die große Flut“ von 1927 mag zwar, wie Fennelly und Franklin im Vorwort schreiben, „größtenteils in Vergessenheit geraten sein“, aber im Blues der 1920er- und 1930er-Jahre hat sie eine dauerhafte künstlerische Verarbeitung erfahren – Bessie Smith, Memphis Minnie, Charlie Patton, der hier auch erwähnte Barbecue Bob, John Lee Hooker und ungezählte andere haben daraus eindrückliche Songs gemacht.
Die verschiedenen Plot-Lines, die Fennelly und Franklin hier aufbieten, die vielen eingestreuten „Geschichten“, die sie erzählen, aus Dixies Kindheit, aus Teds Kindheit, aus seiner Soldatenzeit im Ersten Weltkrieg etwa, dominieren den Text, der somit eher narrative Breite als eine eigene Sprachgewalt, wie etwa Jeremias Gotthelfs Prosakatarakte in „Die Wassernot im Emmental“ (von 1838) hat.
Beth Ann Fennelly und Tom Franklin: Das Meer von Mississippi (
Aus dem Amerikanischen von Eva Bonné. Heyne Verlag, München 2021. 384 Seiten, 22 Euro.
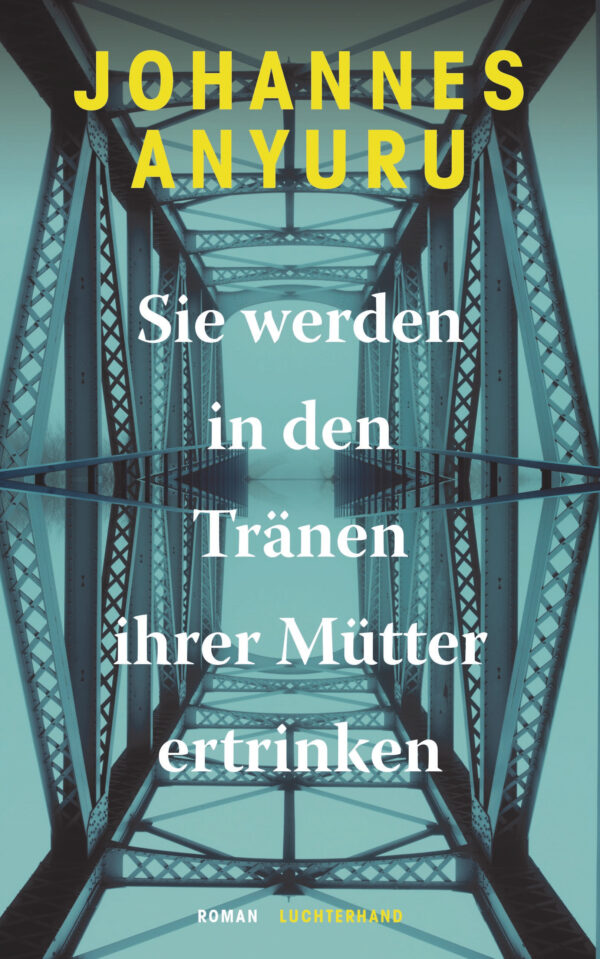
Zeit und Erinnerung
(rum). Ein Trio junger Schweden überfällt einen Comicladen im Zentrum Göteborgs. Ihr Ziel: Ein Autor von Mohammed-Karrikaturen und sein Publikum. Die drei sind schwer bewaffnet, haben selbst gebastelte Fahnen des „Islamischen Staats“ dabei. Allerdings läuft nichts nach Plan: Einer der Attentäter wird von der Polizei erschossen, der zweite von seiner Freundin, die die ganze Aktion filmen sollte.
Sie wird nach dem Überfall in ein jordanisches, guantanamoartiges Lager für islamistische Terroristen gesteckt, meint danach, aus der Zukunft zu kommen und landet in der Psychiatrie. Dort verfasst sie einen Roman, in dem sie eine Zukunftsvision beschreibt: Wer keinen Mitbürgervertrag unterschreibt, wird zum Schwedenfeind erklärt und in einer Hochhaussiedlung interniert, die voll ist mit Muslimen. Den Text schickt sie einem Schriftsteller, der, selbst Muslim, die Geschichte aus seiner Perspektive erzählt. Er macht sich auf die Suche nach Zeugen des Anschlags, nach Angehörigen der Attentäter. Dabei ist er selbst Opfer der Verhältnisse. Denn mit dem Film, den die junge Frau im Laden drehte und der sich rasch verbreitete, kippte auch die Stimmung gegen Muslime im Land. Er will mit seiner Frau und seiner kleinen Tochter deshalb nach Kanada auswandern.
Der Film aus dem Laden markiert aber auch den Punkt, an dem Erinnerung in eine Fiktion umschlägt, die Zeit nicht mehr linear in eine Richtung, sondern sprunghaft vor und zurück verläuft. Was wäre, fragt er, wenn man in der Zeit zurückreisen und etwas verhindern könnte.
Der 1979 geborene Johannes Anyuru hatte bereits in seinem 2016 erschienenen Romandebüt „Ein Sturm wehte vom Paradiese her“ die Geschichte seines Vaters erzählt, eines ugandischen Kampfpiloten, der in den 1970er Jahren nach langer Odyssee nach Schweden gelangt war, mit einer Schwedin eine Familie gegründet hatte und dennoch nie richtig ankam. Diesmal stellt er in Sie werden in den Tränen ihrer Mütter ertrinken die Frage, welche Rolle Religion dabei spielt, ob und wie man als Muslim in der schwedischen Gesellschaft leben kann, wie weit man tatsächlich als Schwede und Schwedin wahr- und ernstgenommen wird. Anyuru macht daraus eine leise, eindringliche und gekonnt in sich gedrehte Geschichte. Immerhin: Sein ausreisewilliger Protagonist und dessen Frau entscheiden schließlich, in Schweden zu bleiben. Sie sehen da wohl durchaus eine Perspektive.
Johannes Anyuru: Sie werden in den Tränen ihrer Mütter ertrinken (De kommer att drunkna i sina mödrars tårar, 2017). Aus dem Schwedischen von Paul Berf. Luchterhand-Verlag, München 2021. 334 Seiten, 22 Euro.
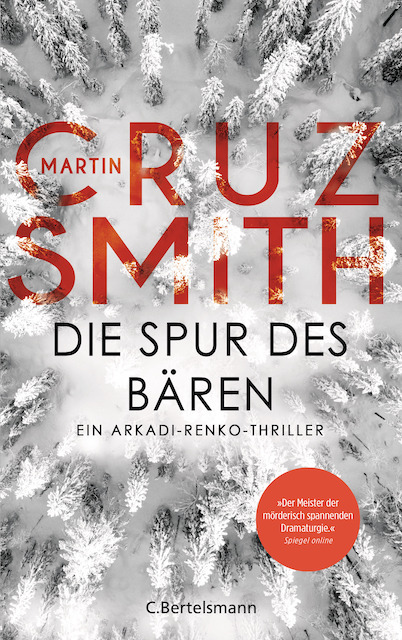
Wer den Kreml herausfordert, riskiert immer noch sein Leben
(hpe) Als Martin Cruz Smith, damals 40-jährig, 1981 mit dem Weltbestseller »Gorky Park« den Moskauer Ermittler Arkadi Renko in die Thrillerwelt setzte, hielt der Kalte Krieg noch weite Teile der Welt in Atem. Im Kreml saß Leonid Breschnew. Als acht Jahre später Renko in »Polar Star« seinen zweiten Auftritt hatte, war Michail Gorbatschow in Moskau am Drücker. Inzwischen ist die Sowjetunion Geschichte, und Cruz Smith legt den neunten Arkadi-Renko-Thriller vor: Die Spur des Bären. Während der Autor mittlerweile 78 Jahre alt ist, bleibt sein Held alterslos. Er hat die Umbrüche der letzten Jahrzehnte überstanden und ist in Russland immer noch Ermittler bei der Moskauer Staatsanwaltschaft.
Wie viel sich in Moskau seit dem Kalten Krieg tatsächlich geändert hat, scheint sich auch der amerikanische Autor zu fragen, wenn er im neuen Roman ziemlich sarkastisch bemerkt: »In Anerkennung dessen, dass der Staat ohne ihn zusammenbrechen würde, gab es für den Präsidenten die Option, ewig zu leben. Das musste man sich vorstellen. Ewig leben mit Putin.« Wer den Kreml herausfordert, riskiert immer noch sein Leben.
»Die hohe ›Aufklärungsrate‹ der russischen Mordermittler verdankte sich einem Rechtssystem, das sich weniger auf Beweise und mehr auf Geständnisse verließ. Aus einem unschuldigen Betrunkenen ein Geständnis herauszuprügeln, war einfacher, als es einem nüchternen Mörder zu entlocken.« Arkadi Renko will seine Fälle nicht so »gelöst« sehen, sondern sucht nach der Wahrheit. Das macht ihn bei seinem Chef nicht besonders beliebt. Der schickt ihn nach Sibirien, um einen Tschetschenen zu vernehmen, der ihm, dem Staatsanwalt, nach dem Leben getrachtet haben soll.
In Sibirien sucht Arkadi auch nach seiner Freundin Tatjana, einer kritischen Journalistin, die sich von ihrer Reportage über einen Oligarchen und Kremlkritiker nicht mehr meldet. Und schon bald stecken er und seine Freunde, zu dem auch der des Mordversuchs beschuldigte Tschetschene geworden ist, in einem gnadenlosen Überlebenskampf in der eisigen Kälte des sibirischen Winters, wo Scharfschützen ebenso lauern wie hungrige Bären. Schnörkellos und nüchtern, mit trockenem Humor gewürzt erzählt Martin Cruz Smith seine neue Geschichte, routiniert, aber durchaus unterhaltsam.
Martin Cruz Smith: Die Spur des Bären (The Siberian Dilemma, 2019). Aus dem Englischen von Rainer Schmidt. C. Bertelsmann, München 2021. 268 Seiten, 16 Euro.

Aus der globalisierten Gegenwart
(UN) Mich bewegte auf meinem Blog öfter schon die Frage, ob der Iran-Irak-Krieg (oder der Irak-Iran-Krieg?) so etwas wie ein ureigenes Thema der zeitgenössischen deutschen Literatur sein kann. Die Frage stellte sich zum Beispiel durch Abbas Khiders aktuellen Roman „Palast der Miserablen“, der in dieser Zeit angesiedelt ist. Klar doch, denke ich, natürlich ist dieser Krieg ein plausibles Thema der deutschen Literatur – dann zumindest, wenn ein deutschsprachiger Schriftsteller auf Deutsch darüber schreibt. So wie Abbas Khider – und so wie bei Nava Ebrahimi, in deren zweitenm Roman Das Paradies meines Nachbarn dieser völlig irre Konflikt mit seinem Millionen Opfern, unter anderem von Giftgasangriffen mit Elementen made in Germany, ebenfalls eine zentrale Bedeutung hat.
Nava Ebrahimi, geboren 1978 in Teheran, lebt nach vielen Jahren in Köln heute in Graz. Mit ihrem Text “Der Cousin” hat sie den Bachmannpreis 2021 gewonnen. Der Text nachzulesen hier. In ihrem Roman erzählt sie vor allem von zwei Männern im besten Alter, deren Leben eine schicksalhafte Verbindung aufweist, was nicht bloß mit ihrer „Mutter“, sondern vor allem auch mit der damaligen Kriegspraxis zu tun hat, Minderjährige als Kanonenfutter an die Front zu schicken. Einer ist schwer versehrt, der andere konnte sich nach Deutschland durchschlagen, wo er später als großmäuliger Designer Karriere machte – beider Schicksal ist viel enger und dramatischer verknüpft, als man Anfangs ahnen kann. Nava Ebrahimi hat eine so einfache wie treffende Konstruktion ersonnen, sehr gut gemacht das, um ihr Thema im Damals und im Heute zu entfalten und zugleich im Iran und Deutschland. Und eben wiederum die Doppelperspektive – die in diesem Roman allerdings noch ergänzt wird durch einen dritten Blick, den eines Beobachters, der beteiligt ist und auch nicht, ein Prototyp belangloser Alltäglichkeit, stellvertretend vor Ort für uns Leser. Das Ganze ist nicht bloß klug konstruiert, sondern (zwischen Teheran, München und Dubai) auch auffallend sorgsam und stilsicher erzählt, das Timing ist klasse, die Figuren spannend – hervorragende neue deutschen Literatur aus der globalisierten Gegenwart. Ein ausgesprochen bildstarker Roman übrigens auch, der nach Verfilmung geradezu schreit, schon das Lesen, so mein Gefühl im Nachhinein, ist wie ein guter Abend im Arthousekino, insofern also: Mein Ausgeh-Tipp in Corona-Quarantänezeiten.
Nava Ebrahimi: Das Paradies meines Nachbarn. btb Verlag, München 2020. 224 Seiten. 20 Euro.
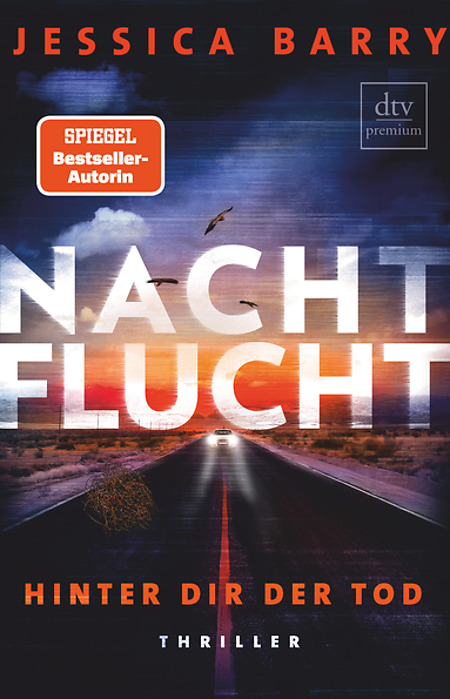
Zwei Frauen werden auf dem Highway gejagt
(hpe) Cait zapft Bier in einer Kneipe in der texanischen Hauptstadt Austin, um Geld zu verdienen, während sie versucht, ihre Karriere als Journalistin voranzubringen. Nach einer Nacht mit einem Musiker, der sie beim Sex brutal gewürgt hat, beschreibt sie ihr Erlebnis in einem Text, der von einem Onlinemagazin anonym abgedruckt wird. Das löst einen gewaltigen Shitstorm aus, und Hacker finden heraus, wer den Text geschrieben hat. Cait ist auch als freiwillige Helferin engagiert bei den »Sisters of Service«, einer Organisation von »Frauen, die für andere Frauen eintraten«. Etwa, indem sie Frauen vor Demonstranten vor Abtreibungskliniken schützen. Oder Frauen in benachbarte Bundesstaaten fahren, wo die Abtreibungsregeln liberaler als in Texas sind.
Dass der Gouverneur von Texas kürzlich ein Gesetz unterzeichnet hat, das einen legalen Schwangerschaftsabbruch faktisch fast verunmöglicht, macht den Thriller Nachtflucht – Hinter dir der Tod von Jessica Barry besonders aktuell. Cait holt in Lubbock im Nordwesten von Texas mitten in der Nacht Rebecca ab, um sie ins fast 500 Kilometer entfernte Albuquerque in New Mexico zu fahren. Rebecca will ihre Schwangerschaft abbrechen, weil ihr Kind laut den Ärzten tot oder einem schnellen Tod geweiht zur Welt kommen würde. Ihr Mann, ein aufstrebender Politiker, wiedersetzt sich der Abtreibung. Darum geht Rebecca die Aktion bei Nacht und Nebel während einer Abwesenheit des Gatten an.
So sitzen die beiden Frauen in Caits altersschwachem Jeep. Schon bald taucht auf dem nächtlich leeren Highway ein Verfolger auf. Rebecca denkt, dieser sei vom Wahlkampfmanager ihres Mannes geschickt. Cait denkt, dass sie das Ziel ist. Während einer atemberaubenden Jagd über Hunderte von Kilometern erfahren wir durch Rückblenden immer mehr über die Geheimnisse und Beweggründe der beiden Frauen. Leider setzt Jessica Barry dabei auf ein schematisches Cliffhangerkonzept, das auf die Dauer mehr nervt als packt. So erzeugt sie Pseudospannung, statt auf die Kraft ihrer Story zu vertrauen, die stark genug wäre. Und brisante Themen anschneidet. Es geht nicht nur um die Abtreibungsfrage, sondern auch um Sexismus und #MeToo, um Online-Mobbing und Cancel Culture. Und um Gefahren, denen Frauen tagtäglich ausgesetzt sind. »Man klemmte die Schlüssel zwischen die Finger, nahm die Ohrhörer heraus, wenn man abends nach Hause ging, rechnete immer damit, dass eine Hand einen packte, dass plötzlich alles vorbei wäre. Man fragte sich immer, wer er sein würde: ein Mann, den man kannte, oder ein Unbekannter.«
Jessica Barry: Nachtflucht – Hinter dir der Tod (Don’t Turn Around, 2020). Aus dem Englischen von Susanne Goga-Klinkenberg. dtv, München 2021. 333 Seiten, 15,90 Euro.
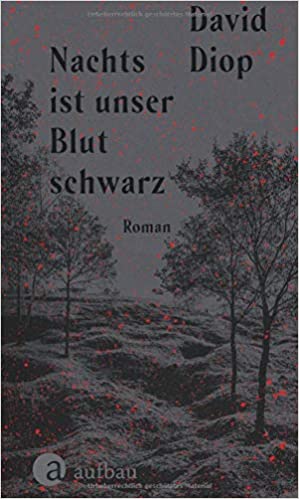
Die Senegalschützen
(UN) Ein junger Mann liegt im Schützengraben. Ein Geschoss hat ihm den Bauch zerfetzt. Keine Chance. Sein Schmerz ist unermeßlich. Immerhin, sein bester Freund ist bei ihm. Der Sterbende bittet den Lebenden, ihn zu töten, sein Leiden zu beenden. Drei Mal. Der Überlebende kann seinem Freund diesen Dienst nicht erweisen, er schafft es einfach nicht, ihm bleibt nur, dem Anderen zuzusehen, wie der langsam, qualvoll sein Leben aushaucht. Später, nach dem Tod des Freundes, wird er unerbittlich sein, kein Risiko scheuen – keine Gnade walten lassen. Mit den Feinden, die er einzeln aus ihren Schützengräben zieht, um sie ebenso grausam zu töten wie das bei seinem Freund der Fall war.
Eine so grausige wie alltägliche Geschichte, mit Blick auf den Stellungskampf im Ersten Weltkrieg. Nachts ist unser Blut schwarz ist ein Antikriegsroman, der den Wahnsinn dieses Krieges exakt fokussiert, und zwar aus konzentriert subjektiver Perspektive: Es gibt keine Chance (für die “kleinen” Männer an der Front), dem Töten und dem Sterben zu entrinnen. Das kennt man schon aus vielen anderen Romanen, allen voran dem Klassiker “Im Westen nichts Neues” von Erich Maria Remarque. Das Besondere an dieser Geschichte, für die David Diop jetzt mit dem International Booker Prize ausgezeichnet wurde, sind die Protagonisten, auf denen der Fokus speziell ruht: So genannte “Senegalschützen”, Soldaten also aus den französischen Kolonialgebieten, um die 180.000 waren es – ihnen setzt David Diop mit seinem Roman ein Denkmal.
David Diop: Nachts ist unser Blut schwarz. Übersetzt von Andreas Jandl. Aufbau Verlag, Berlin 2019. Hardcover, 160 Seiten, 18 Euro.










