Mehr als ein Kriegsfilm
Im Kino lief „Red Sniper“ Ende Februar 2016 nur in Sondervorstellungen, auf DVD aber wollte Alf Mayer sich den Film nicht entgehen lassen, kommt die Heldin doch in seiner achtteiligen CM-Serie „Kulturgeschichte des Scharfschützen“ vor und war ihm als interessantes Detail bekannt, dass Woody Guthrie der Russin 1942 einen eigenen Song gewidmet hat: „Miss Pavilichenko“ (die lyrics gibt es ganz unten am Ende).
Dieser Film hat mich überrascht. Ich hatte von „Red Sniper“ Martialisches erwartet. Etwas in Richtung von Clint Eastwoods grottigem Propagandaschinken „American Sniper“, dem erfolgreichsten Kriegsfilm aller Zeiten und würdelosen Selbstbegräbnis eines großen Regisseurs (siehe meine CM-Kritik „Propaganda für den Hass“). Bei „American Sniper“ ging es um einen Marine mit den meisten „confirmed kills“ der US-Militärgeschichte, „Red Sniper“ hat die tödlichste Scharfschützin der Roten Armee im Mittelpunkt. Irak 2004 mit 160 „confirmed kills“ gegen Russland 1941 mit 309 Kills. Aber weder bei den Einspielergebnissen noch bei der Inhaltsanalyse sind die Schnittmengen groß. Der Systemvergleich lohnt höchstens bei Schärfe und Verblendungsgrad der vorgetragenen Ideologien. Da ist und bleibt „American Sniper“ ein Tiefpunkt an dumpfem (männlichem) Feindbildeifer. „Red Sniper“, zwar von einem Männerteam gemacht, nimmt eine halbwegs weibliche Perspektive auf den Krieg und auf Konfliktlösungen ein, beschwichtigt aber in keiner Weise, dass seine Heldin 309 „Nazi-Okkupanten“ erschossen hat. Empfohlene Parallel-Lektüre: das Buch der Nobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch, „Der Krieg hat kein weibliches Gesicht“ (Suhrkamp TB, 2015). 800.000 Soldatinnen kämpften während des Zweiten Weltkrieges in der Roten Armee.
 Echt wahr: Eine junge Russin im Weißen Haus
Echt wahr: Eine junge Russin im Weißen Haus
Die ukrainisch-russische Co-Produktion aus dem Jahr 2015 – ja, Sie lesen richtig – schlägt bei aller Kriegs- und Anti-Nazi-Rhetorik differenzierte Töne an und hat gar – auch dies im Jahr 2015 keine Selbstverständlichkeit – die amerikanische Präsidentengattin Eleanor Roosevelt zur Erzählerin. Die kommt, so die Rahmenhandlung, 1947 als von Regierungschef Chruschtschow eingeladene Witwe nach Moskau und begehrt von dem sie abholenden Diplomaten, als Erstes zu einer bestimmten Frau gefahren zu werden, nämlich zu Ljudmila Pawlitschenko, Genosse Chruschtschow könne warten. In der Diplomatenlimousine erzählt Eleanor (großartig gespielt von der Britin Joan Blackham) ihrem Gegenüber Ljudmillas Geschichte: „Nun, dann sollte ich Sie mit dieser Frau bekannt machen …“, worauf sich wie bei einer russischen Puppe immer weitere Erzählungen öffnen, in denen wir „Lula“ als junge Studentin, als junge Soldatin, als Scharfschützin in der Ausbildung und dann an der Front sehen, dies immer wieder konterkariert mit der Geschichte von Eleanors und Ljudmillas Kennenlernen, eine an sich schon seltsame, aber historisch wahre Begebenheit. Ljudmilla war die erste Sowjetbürgerin, die ins Weiße Haus eingeladen wurde.

Kleiner historischer Exkurs
Die Verschachtelungen und Vor- und Rückblenden sind weniger kompliziert als es hier klingen mag, was manche Zuschauer aber möglicherweise fordert und in ihren Erwartungen an einen Kriegsfilm enttäuscht, sind die historischen Rahmensetzungen und die völkerbindenden Elemente des Films. Zu etwa einem Drittel der Filmzeit nämlich hält Ljudmilla sich im September 1942 (!) in den USA auf, zuerst als Delegationsmitglied der Internationalen Studentenversammlung (wie die deutsche Fassung das nennt, es ist die heute noch aktive International Student Assembly, siehe unten die Anm.), wo die jungen Russen das ihre tun, um Amerika zum aktiven Eingreifen in den Zweiten Weltkrieg zu bewegen. Zur Erinnerung: Erst mit der „Operation Overlord“, der Landung der Westalliierten in Nordfrankreich am 6. Juni 1944, eröffnete sich die von der Sowjetunion zur Entlastung ihrer Roten Armee seit langem gewünschte zweite Front gegen Nazi-Deutschland.
Die Kriegshandlungen in „Red Sniper“ ereigneten sich historisch deutlich früher, nämlich mit dem „Unternehmen Barbarossa“, dem von Anfang an als Vernichtungskrieg angelegten Angriff des Deutschen Reiches auf die Sowjetunion, der am 22. Juni 1941 begann, bald die Ukraine erreichte (zur deutsch-ukrainischen Geschichte lohnt ein Blick in Wikipedia) und im November 1941 die Krim erreichte. Die Schlacht um den befestigten Seehafen Sewastopol währte von November 1941 bis Mai 1942, hatte eine kurze Pause, und wurde dann Juni/Juli 1942 von den Deutschen entschieden. Die Rote Armee wurde vernichtend geschlagen, die deutsche Besetzung der gesamten Krim war am 4. Juli 1942 vollzogen. Diese Kriegsgeschichte wird in „Red Sniper“ erzählt, der im Original „Bitva za Sevastopol“ heißt, was der englische Titel „Battle for Sevastopol“ wiedergibt. In dieser Zeit war Ljudmilla an der Front und erzielte ihre 309 verbürgten Abschüsse.
 „Du bist keine Frau! Du bist Soldat!“
„Du bist keine Frau! Du bist Soldat!“
Ljudmila Pawlitschenko war Ukrainerin und die beste Schützin der sowjetischen Schwarzmeerflotte (also auch ein Marine wie Clint Eastwoods Chris Kyle), die Schlacht um Sewastopol ist eine der großen, tragischen und heroischen Widerstandserzählungen des „Großen Vaterländischen Krieges“, den die Russen „Welikaja Otetschestwennaja woina“ nennen. Wenn, kann man sich wundern, dass Ljudmilas Geschichte erst jetzt erzählt worden ist und quasi zu einem Kollateralschaden des Ukraine-Konflikts wurde. Es hat gewiss – was der Film oft thematisiert – mit der Rolle der Frau im Krieg zu tun. „Du bist keine Frau! Du bist ein sowjetischer Soldat!“, wird Lula einmal angeherrscht.
Die Russische Revolution von 1917 brachte den Frauen zwar formale Gleichberechtigung, in der Praxis hieß das oft nur, dass sie genauso hart arbeiten durften wie die Männer, dazu weiterhin aber Haushalt und Kinder zu versorgen hatten. Noch nach der Nazi-Invasion der „Operation Barbarossa“ wurden viele junge Frauen abgewiesen, die sich beim Militär einschreiben wollten. Man sagte ihnen, sie sollten in den Fabriken arbeiten oder als Krankenschwestern. Die Rote Armee aber erlitt in den ersten Monaten des deutschen Angriffs derart heftige Verluste, dass sogar Stalin einwilligte, patriarchale Strukturen aufzuweichen. Schießunterricht für Jungs und Mädchen an der Grundschule gab es bereits seit 1931, für junge Frauen entstanden Schützinnen-Clubs.
Anka (gespielt von Varvara Myasnikova), eine Maschinengewehrschützin aus dem im Bürgerkrieg spielenden Film „Chapaev“, wurde zu einem Rollenmodell.
Eine zentrale Scharfschützen-Schule für Frauen wurde im März 1942 in Wischniaki nahe Moskau eingerichtet, Direktorin war Nora P. Chegodayeva, Absolventin der berühmten Frunze-Militärakademie, die im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft hatte. Frauen galten als gute Sniper, weil sie Stress und Kälte besser als Männer ertragen und für den perfekten Schuss mehr Geduld aufbringen konnten. Die Rote Armee hatte aus dem Winterfeldzug gegen Finnland gelernt, wo ihnen finnische Scharfschützen, viele von ihnen einfache Jäger und Bauern, hohe Verluste zugefügt hatten. Der Finne Simo Häyha gilt mit 505 „confirmed kills“ bis heute als der tödlichste Sniper aller Zeiten. Die Rote Armee bildete während des Zweiten Weltkrieges insgesamt 428.335 Scharfschützen und Scharfschützinnen aus. Alleine 1942 waren es 55.000 Frauen. Die Propaganda-Aufmerksamkeit blieb jedoch weit mehr auf den Männern, etwa auf Wassili Saizew. Stephen Hunters Roman „Sniper’s Honor“ (unten dazu mehr) handelt von der Suche nach einer nach dem Krieg spurlos verschwundenen, berühmten Scharfschützin.
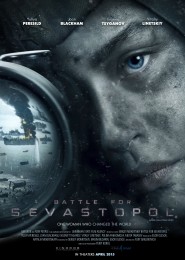 Weibliche Scharfschützen („Flintenweiber“) blieben eher in der Anonymität, aber waren eine effektive Bedrohung der deutschen Soldaten. „Wir müssen jedem deutschen Soldaten das Gefühl geben, dass in der die Mündung eines russischen Gewehrs blickt“, hatte General Wassili Tschuikow, Befehlshaber der 62. Armee, als Parole ausgegeben. In der deutschen Propaganda wurden russische Sniper als feige Heckenschützen dargestellt – freilich hatten sie etwas zu verteidigen, nämlich ihre Heimat.
Weibliche Scharfschützen („Flintenweiber“) blieben eher in der Anonymität, aber waren eine effektive Bedrohung der deutschen Soldaten. „Wir müssen jedem deutschen Soldaten das Gefühl geben, dass in der die Mündung eines russischen Gewehrs blickt“, hatte General Wassili Tschuikow, Befehlshaber der 62. Armee, als Parole ausgegeben. In der deutschen Propaganda wurden russische Sniper als feige Heckenschützen dargestellt – freilich hatten sie etwas zu verteidigen, nämlich ihre Heimat.
Ich selbst habe 1995 in der russischen Pampa die Begegnung russischer und deutscher Kriegsveteranen erlebt, eine überaus herzliche Veranstaltung unter Männern. Als dann aber eine Frau dazu stieß, imposant und grauhaarig, die Jacke voller Orden, erstarb den Deutschen das Wort auf den Lippen, sie erbleichten förmlich und die alte Angst stand ihnen wieder im Gesicht. „Eine Scharfschützin, ein Flintenweib“, flüsterte mir einer von ihnen zu. Die Frau blieb isoliert, die alten Wehrmachtssoldaten hielten mehr als respektvollen Abstand.
Ein Mosin-Nagant ist proletarisch schlicht
Insofern ist „Red Sniper“ also eine Annäherung an kämpfende Frauen im Krieg. Julija Peressild, die Darstellerin der Hauptfigur, gibt hier alles, in den USA würde man das eine Oscar-reife Leistung nennen, beim Filmfestival in Peking erhielt sie denn auch den Darstellerpreis. Ästhetisch ist der Film gespalten: in den Zivilszenen eher konventionell, in den Kriegsszenen oft ein visuell interessanter Schwarz-Weiß-Film, zwei Lieder lang sogar ein interessant montiertes Musikvideo, in den computergenerierten Kolossalfilmszenen ein Hollywood-Blockbuster. (Was man, anders als der Verleih es glauben machen mag, eher weniger braucht. Augenhöhe mit „Enemy at the Gates“ beweist der Film in den stillen und kleinen Momenten, nicht im Bombast.)
Die CGI-Momente freilich sind verschmerzbar, auch die eine Szene, in der die Kamera mit der abgefeuerten Kugel über das Schlachtfeld saust, oder die in einem Kriegsfilm obligat herumliegenden Gliedmaßen. Grandios gefilmt ist die Flucht von Lula und ihrem Spotter durch eine große Streuobstwiese, in der Dutzende von Minen explodieren. Waffenfetischismus wird karg gehalten, auch das Scharfschützengewehr, ein Mosin-Nagant, ist proletarisch schlicht, Ausbildungs- und Gefechtsszenen sind visuell eindrucksvoll erfasst und ökonomisch montiert. Immer wieder ist man froh, nicht dem immer gleichen, von Michael Bay („Transformers“ et alia) und Pentagon-Überunterstützung geprägten US-Waffen-Porno ausgeliefert zu sein.
Der keineswegs überlange Film lässt sich immer wieder Zeit, lässt sich auch Zeit zwischen den Frauen. Dezent bleibt Eleanor Roosevelts sagen wir liberale Haltung gegenüber lesbischen Frauen, aber eine solche Beziehung kann durchaus in den Umgang von Ljudmilla und Eleanor hineingelesen werden. Auch dies für einen russischen Film des Jahres 2015 gewiss eine Besonderheit. Die junge starke Frau und ihren Sohn wolle sie treffen, sagt Eleanor am Anfang, weil sie alle ihre Kriege gewonnen habe, als Frau, in der Armee, als Wissenschaftlerin und als Mutter. Und so sitzen sie am Filmende, zwei unterschiedlich alte Frauen und ein Junge, in der Oper, und wir hören die Ouvertüre von „La Traviata“. Was ja „Die vom Wege Abgekommene“ bedeutet und auf der „Kameliendame“ von Alexandre Dumas dem Jüngeren beruht.
Im sehr interessanten Bonus-Material, im „Making Of“, sitzt Regisseur Sergei Mokritskiy, der sich sehr lebendig äußerst, am Ende des Interviews auf seinem Stuhl, und fasst die ganze Geschichte und seinen Film noch einmal zusammen:
„25 Jahre alt, eine schöne Frau, die zwischen den Leichen deutscher Soldaten liegt, die von ihr getötet wurden. So – nun fragen Sie: Worum geht es in diesem Film?“
Alf Mayer
Zu seiner Kulturgeschichte des Scharfschützen geht es hier.
 „Red Sniper – Die Todesschützin“ (Bitva za Sevastopol / Battle for Sevastopol; Ukrainisch: Незламна (Unzerstörbar), Russisch: Битва за Севастополь). Ukraine/ Russland 2015; Regie: Sergueï Mokritskiy; Kamera: Yuriy Korol; Musik: Evgueni Galperine: mit: Julija Peressild, Joan Blackham, Evgeniy Tsyganov, Anatoliy Kot, Oleg Vasilkov, Nikita Tarasov; Länge: 110 Min.; FSK: frei ab 16. DVD/ BluRay/ VOD: Meteor Film. Russische OV, UT, und deutsche Synchronfassung.
„Red Sniper – Die Todesschützin“ (Bitva za Sevastopol / Battle for Sevastopol; Ukrainisch: Незламна (Unzerstörbar), Russisch: Битва за Севастополь). Ukraine/ Russland 2015; Regie: Sergueï Mokritskiy; Kamera: Yuriy Korol; Musik: Evgueni Galperine: mit: Julija Peressild, Joan Blackham, Evgeniy Tsyganov, Anatoliy Kot, Oleg Vasilkov, Nikita Tarasov; Länge: 110 Min.; FSK: frei ab 16. DVD/ BluRay/ VOD: Meteor Film. Russische OV, UT, und deutsche Synchronfassung.
Ein Kinoleben hatte der Film in Deutschland nur sehr kurz direkt vor dem DVD-Start: als Event in den Kinoketten CinemaxX, Kinopolis, Cineplex, Cinestar und UCI.
PS. Ich empfehle, den Film in der russischen Originalfassung mit deutschen Untertiteln zu sehen. Es hört sich einfach toll an, enthält auch die amerikanischen Passagen und das gelegentliche Deutsch. Schließlich war der Zweite Weltkrieg eine Sache mehrerer Völker und keineswegs nur deutsch synchronisiert. Gefilmt wurde auf der Krim, in Sewastopol und Balaklava, Kiew, Odessa und Kamjanez-Podilskyj in der West-Ukraine. Grünes Licht für das Projekt gab es 2012 vom Filmkomitee der Ukraine, dann wurde daraus ein joint venture zwischen Kinorob und der renommierten russischen Independent-Firma New People Film, mit dem in Moskau lebenden Ukrainer Sergueï Mokritskiy als Regisseur, bisher eher als Kameramann bekannt. Währen der Dreharbeiten verschärften sich die russisch-ukrainischen Beziehungen, der Film aber wurde am gleichen Tag in beiden Ländern gestartet, in Russland auf 2000 Leinwänden. Den Auslandsvertrieb hat 20th Century Fox.
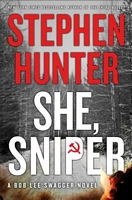 PPS. Stephen Hunter, der weltbeste Thrillerautor in Sachen Sniper, konnte sich natürlich eine Figur wie Ljudmila Pawlitschenko nicht entgehen lassen. Er fiktionalisiert sie in seinem aktuellsten, dem siebten Bob Lee Swagger-Buch, in „Sniper’s Honor“ von 2014 (Arbeitstitel She, Sniper), in Deutschland nicht erschienen. (Ein mehrteiliges CM-Porträt von Stephen Hunter weitete sich zu einer achtteiligen „Kulturgeschichte des Scharfschützen“ aus, bester Zugang vom achten Teil aus.) Stephen Hunter geht – anders als der Film – in die „gun details“. Der Film macht kein Aufheben daraus, als Ljudmilla als Auszeichnung ein nagelneues halbautomatisches Tokarev SVT-40 Scharfschützengewehr erhält. Das verfeuert zwar die gleichen 7.62 x 54mm Patronen wie das 1932er Mosin-Nagant, die herkömmliche Waffe der sowjetischen Sniperinnen in der Standardvariante M1891/30 mit verlängertem Kammerstängel und einem Zielfernrohr von Typ PE oder PU, aber hat ein Zehn-Patronen-Magazin. „Kein Gewehr, eine Kugelspritze“, heißt es bei Hunter abfällig. Sniper sind stolz auf den „einen“ Schuss, das unterscheidet sie von normalen Infantristen.
PPS. Stephen Hunter, der weltbeste Thrillerautor in Sachen Sniper, konnte sich natürlich eine Figur wie Ljudmila Pawlitschenko nicht entgehen lassen. Er fiktionalisiert sie in seinem aktuellsten, dem siebten Bob Lee Swagger-Buch, in „Sniper’s Honor“ von 2014 (Arbeitstitel She, Sniper), in Deutschland nicht erschienen. (Ein mehrteiliges CM-Porträt von Stephen Hunter weitete sich zu einer achtteiligen „Kulturgeschichte des Scharfschützen“ aus, bester Zugang vom achten Teil aus.) Stephen Hunter geht – anders als der Film – in die „gun details“. Der Film macht kein Aufheben daraus, als Ljudmilla als Auszeichnung ein nagelneues halbautomatisches Tokarev SVT-40 Scharfschützengewehr erhält. Das verfeuert zwar die gleichen 7.62 x 54mm Patronen wie das 1932er Mosin-Nagant, die herkömmliche Waffe der sowjetischen Sniperinnen in der Standardvariante M1891/30 mit verlängertem Kammerstängel und einem Zielfernrohr von Typ PE oder PU, aber hat ein Zehn-Patronen-Magazin. „Kein Gewehr, eine Kugelspritze“, heißt es bei Hunter abfällig. Sniper sind stolz auf den „einen“ Schuss, das unterscheidet sie von normalen Infantristen.
PPPS. Zur Internationalen Studentenversammlung im September 1942 in Washington, bei der die amerikanische Präsidentengattin und die russische Scharfschützin sich kennenlernten, erschienen Delegationen aus England, Ägypten, Schweden, Indien, Afrika, Kanada, Polen, Australien, Afghanistan, Neuseeland, Schottland, Korea, Syrien, Haiti, Island, Südamerika, Ostindien, aus den Philippinen, den Niederlanden, der UdSSR, der Türkei und des Freien Frankreich.
PPPS. Was ich seit meinen Recherchen zu Ljudmila Pawlitschenko wusste und für eine gelegentliche Befassung beiseitegelegt hatte, wird in „Red Sniper“ zu einer relativ breit ausgespielten Episode. Während ihrer USA-Reise wird Ljudmila vom Folksänger Woody Guthrie angesprochen und in seine Garderobe gebeten. Er hat ihr nämlich einen Song geschrieben, den er ihr auf seiner rotlackierten Gitarre (Aufschrift: „This Guitar Kills Nazis“) auch vorträgt.
Heute zugänglich auf dem Album „Hard Travelin‘: The Ash Recordings, Vol 3 (1998), lautet der Text von „Miss Pavilichenko“ so:
Miss Pavilichenko’s well known to fame;
Russia’s your country, fighting is your game;
The whole world will love her for a long time to come,
For more than three hundred nazis fell by your gun.
Fell by your gun, yes,
Fell by your gun
For more than three hundred nazis fell by your gun.
Miss Pavlichenko’s well known to fame;
Russia’s your country, fighting is your game;
Your smile shines as bright as any new morning sun.
But more than three hundred nazidogs fell by your gun.
Fell by your gun, yes,
Fell by your gun
For more than three hundred nazis fell by your gun.
In your mountains and canyons quiet as the deer.
Down in your bigtrees knowing no fear.
You lift up your sight. And down comes a hun.
And more than three hundred nazidogs fell by your gun.
Fell by your gun, yes,
Fell by your gun
For more than three hundred nazis fell by your gun.
In your hot summer’s heat, in your cold wintery snow,
In all kinds of weather you track down your foe;
This world will love your sweet face the same way I’ve done,
‚Cause more than three hundred nazzy hound fell by your gun.
Fell by your gun, yes,
Fell by your gun
For more than three hundred nazis fell by your gun.
I’d hate to drop in a parachute and land an enemy in your land.
If your Soviet people make it so hard on invadin‘ men;
I wouldn’t crave to meet that wrong end of such a pretty lady’s gun
If her name was Pavlichenko, and mine Three O One.
CHORUS















