 Grenzerfahrungen
Grenzerfahrungen
Die Country Polar-Romane von Benjamin Whitmer, Matthew F. Jones und Jon Bassoff
Von Alexander Roth
Donald Trump ist Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Eine Tatsache, die für viele Menschen überraschend kam, aber eine Tatsache, der wir uns wohl oder übel stellen müssen. Hierbei gilt wie so oft: Wer Krimis liest, ist klar im Vorteil. In Zeiten, in denen Wählerumfragen an Aussagekraft verlieren, lohnt es sich, gut sortierte Buchhandlungen nach Antworten zu durchforsten – man findet sie dort zuhauf. Nehmen wir beispielsweise den Country Noir. Alleine beim Hamburger Polar Verlag sind im letzten Jahr drei, wenn nicht gar vier Bücher erschienen, die sich dieser Unterströmung der Kriminalliteratur zurechnen lassen, und aus denen sich vieles über die gesellschaftlichen Gegebenheiten in den USA lernen lässt. Bücher, die sich der amerikanischen Realität zwar auf unterschiedlichste Art und Weise, aber alle über die individuelle Ebene annähern, und somit zumindest ein paar Teile des großen Puzzles liefern können, an dem sich die Welt gerade die Zähne ausbeißt. Man muss sie nur aufschlagen.
„Die Autoren des Country Noir bewahren sich eine Distanz zu der Gesellschaft und führen ihre Leser zu den dunklen Orten der Vereinigten Staaten, an denen ihre Protagonisten ohne besondere Fähigkeiten oder Ausbildung mit Gewalt und Verbrechen konfrontiert werden. Auf diese Weise deuten sie auf die moralischen, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Probleme einer ganzen Gesellschaft – und zeigen zudem ein bemerkenswertes Verständnis für die Menschheit, für ihre Fehler, ihre Betrügereien, zerstörten Träume und verlorenen Hoffnungen.“ (Sonja Hartl)
 Nehmen wir den Farmer John Moon zum Beispiel. Der Protagonist aus Matthew F. Jones‘ Roman Ein einziger Schuss krebst auf dem Flecken Erde, dem ihn sein landlord zugesteht, am Existenzminimum herum. Weil das, was er darauf anbaut, zum Leben nicht reicht, laufen ihm Frau und Kinder davon. Auf sich allein gestellt durchstreift er die Wälder und versucht ihnen das Nötigste abzutrotzen. Dabei kann er es sich nicht leisten, geltendes Recht einzuhalten. John Moon wildert und verwildert gleichermaßen, wird immer dünner und immer verzweifelter. Bis er eines Tages ausgehungert auf dem Waldboden kauert und mit seinem Gewehr aus Versehen ein junges Mädchen tötet. Das schwarze Loch in ihrer Stirn wird zum schwarzen Loch hinter seiner, in dem die Welt, die er kannte, nach und nach verschwindet.
Nehmen wir den Farmer John Moon zum Beispiel. Der Protagonist aus Matthew F. Jones‘ Roman Ein einziger Schuss krebst auf dem Flecken Erde, dem ihn sein landlord zugesteht, am Existenzminimum herum. Weil das, was er darauf anbaut, zum Leben nicht reicht, laufen ihm Frau und Kinder davon. Auf sich allein gestellt durchstreift er die Wälder und versucht ihnen das Nötigste abzutrotzen. Dabei kann er es sich nicht leisten, geltendes Recht einzuhalten. John Moon wildert und verwildert gleichermaßen, wird immer dünner und immer verzweifelter. Bis er eines Tages ausgehungert auf dem Waldboden kauert und mit seinem Gewehr aus Versehen ein junges Mädchen tötet. Das schwarze Loch in ihrer Stirn wird zum schwarzen Loch hinter seiner, in dem die Welt, die er kannte, nach und nach verschwindet.
Versucht man die Strömung des country noir politisch zu betrachten, stößt man schnell auf den american dream. Für viele bildet dieses Subgenre der amerikanischen Kriminalliteratur nämlich vor allem die Enttäuschung von Millionen ab, die den Heilsversprechen einer Gesellschaft, die auf den Säulen einer Ideologie immerwährenden Wachstums erbaut wurde, auf den Leim gegangen sind. From rags to riches. Und sicher: Die Autoren stellen in ihren Büchern jene Menschen in den Mittelpunkt, die es vielleicht irgendwann einmal vom Tellerwäscher zum Millionär schaffen wollten, mittlerweile aber völlig desillusioniert vor dem Spülbecken stehen und sich beim Blick auf ihre schwieligen Hände fragen, an welchen Punkt der Traum zum Alptraum wurde. Aber das ist nicht alles. Und das ist auch nicht neu. Will man verstehen, wo der Country Noir seinen Ursprung nahm, will man verstehen was da in den USA über die Jahrzehnte hinweg vor sich hin brodelte, will man zu den Wurzeln dessen vordringen, was uns heute blüht, muss man tiefer graben.
Zugegeben: John Moon wirkt auf den ersten Blick wie Forrest (in seinem Fall wahrscheinlich eher Forest) Gump – irgendwie einfältig, aber auch auf bemitleidenswerte Art liebenswürdig. Der Inbegriff eines Verlierers der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen in seinem Heimatland eben. Doch da ist noch mehr. John Moon, der sich mit seinem Gewehr selbst versorgt, der sich die Natur untertan macht, wirkt über weite Strecken des Romans wie die abgehalfterte Version eines einst glorreichen frontiersman. Damit verortet Matthew F. Jones seine Erzählung in unmittelbarer Nachbarschaft zum frontier-Mythos, dem vielleicht bedeutendsten aller amerikanischen Gründungsmythen, der nicht nur über die Jahrhunderte hinweg, sondern auch heute noch immer wieder neu erzählt und gedeutet wird. Aktuell zum Beispiel Streamig-Giganten Netflix.
„Anders als die meisten Völker der Welt sind die US-Amerikaner nicht allmählich in das Bewusstsein ihrer nationalen Identität hineingewachsen, sondern haben sich in einem revolutionären Befreiungsakt als Nation selbst erfunden.“ (Hans-Dieter Gelfert)
Kaum ein Begriff der amerikanischen Sprache ist so schwer zu fassen wie „frontier“. Zum einen bezeichnet er eine sich spätestens ab dem 18. Jahrhundert immer weiter nach Westen verschiebende Grenze, die jene Gebiete, die unter der Kontrolle der Siedler lagen, von denen der Ureinwohner trennte. Manchmal wird der Begriff jedoch weniger für die räumliche Grenze selbst, als vielmehr für die Tugenden verwendet, die ihre Bezwingung dem amerikanischen Volk abverlangten: Risikobereitschaft, Tatkraft, aus der Not geborener Erfindergeist und jede Menge Optimismus. Klassischerweise ist mit dem Begriff jedoch ein ganz bestimmtes Gebiet zu einer ganz bestimmten Zeit gemeint, das von den Appalachen bis zum Mississippi reicht. Farmer, Kaufleute und Jäger bevölkerten diese Region von etwa 1763-1820 – und stießen auf allerlei Widerstände. Da waren die Ureinwohner, welche ihnen die Gebiete jenseits der Grenze nicht kampflos überlassen wollten, und natürlich die Natur, die sich ihren Zivilisationsversuchen entschlossen entgegenstemmte. Unzählige starben in diesen turbulenten Jahren, einige wurden wiederum zur Legende und gelten heute als Gallionsfiguren der sogenannten pioneer experience.
“American social development has been continually beginning over again on the frontier. This perennial rebirth, this fluidity of American life, this expansion westward with its new opportunities, its continuous touch with the simplicity of primitive society, furnish the forces dominating American character.” (Frederick Jackson Turner)
Aber zurück zu weniger schillernden Persönlichkeiten. John Moon ist nämlich plötzlich nicht nur mit der Leiche der jungen Frau konfrontiert, sondern auch mit einer Tasche voller Geld, die er in ihrer Nähe findet. Es scheint, als hätte sie auf jemanden gewartet. Moon ist nicht scharf darauf herauszufinden auf wen, deshalb schafft er Leiche und Tasche hastig in sein karges Zuhause. Was folgt ist eine äußert gelungene Variation von Cormac McCarthys Ein Kind Gottes: Der Außenseiter Moon versucht den Mord irgendwie zu verkraften und entwickelt dabei eine emotionale Bindung zu der Leiche. Er verbringt einsame Tage mit dem kalten Körper, erzählt ihm seine Sorgen, streichelt und begehrt ihn. Ihren Höhepunkt findet diese Entwicklung in einer Szene, in der Moon mit einer anderen Frau Oralverkehr hat und sich im Moment der Ejakulation vorstellt, wie die Kugel, die zu seinem Verhängnis wurde, in den Kopf seines Opfers eindrang. Glücklicherweise – aus Sicht der Leserinnen und Leser – bleibt ihm keine Zeit, diesen Gedanken weiter nachzuhängen, denn John Moon wird vom Besitzer der Tasche gejagt. Während sich die Realität also gewaltsam zwischen ihn und das tote Mädchen drängt, klammert er sich wie ein kleines Kind an die Hoffnung, alles könne sich noch irgendwie zum Guten wenden. In seinen wenigen klaren Momenten verpufft diese Illusion jedoch. Letzten Endes, denkt John, läuft doch alles auf Geld und Tod hinaus.
Wie die Geschichte John Moons, so endet auch irgendwann die der historischen frontier. Nachdem die Siedler den Pazifik erreicht hatten, gab es vorerst keinen Westen mehr, in den man die Grenze hätte verschieben können, nur das weite, endlos scheinende Meer. Also half man sich mit neuen Grenzen aus. Man führte Kriege auf anderen Kontinenten, flutete die Welt mit US-amerikanischen Produkten und landete schließlich sogar auf dem Mond. „Sky is the limit“? Mitnichten. Die frontier blieb den USA also erhalten – oder, wie es Jost Bauch 2014 in seinem Buch Mythos und Entzauberung formulierte: „Der Problemhorizont der modernen Gesellschaft verlagert sich von der Bewältigung naturhafter Phänomene hin zur Bewältigung der ‚zweiten Natur‘, einer Natur, die der Mensch selbst geschaffen hat.“ Benjamin Whitmer zeigt in Nach mir die Nacht, dass es nicht unbedingt einfacher ist, in dieser zu überleben.
„Die CO-159 ist wohl mit eine der geradesten Straßen, die es gibt. Sie verläuft durch das San Luis Valley und schlägt eine Schneise durch die flache Talsohle, als sei sie mit einer Machete in die Landschaft geschnitten worden. Es ist die Art Highway, die es einem schwer macht, sich ans Tempolimit zu halten, und wenn der graue Himmel knapp drei Meter über dem Boden hängt, die Sonne ihre Strahlen wie gelbe Lichtlanzen durch Nadellöcher im Firmament feuert und Regentropfen allmählich die Staubschicht auf der Windschutzscheibe durchlöchern, dann wird es praktisch unmöglich, sich beim Fahren nicht zu betrinken.“
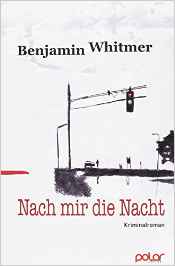 Whitmer nimmt uns mit ins San-Luis-Valley, einst ein Paradies für Goldgräber, jetzt eine trostlose Gegend im ökonomischen Ödland des Mittleren Westens. Sein Protagonist Patterson Wells befreit eine gefesselte Frau aus der Badewanne eines Meth-Süchtigen und beschwört damit eine schwarze Wolke herauf, die sich im gegen Ende des Romans in einem brachialen Gewalt-Gewitter über ihm entlädt. Es ist ihm schlicht egal. Seit dem Tod seines Sohnes, dem er in rührenden Briefen seine Gefühlswelt offenbart, hat Patterson das Vergessen zur höchsten Tugend erhoben. Er gießt jede Menge Dosenbier auf all seine Erinnerungen und taumelt taub durch Klein- und Großstadtkaschemmen, in denen sich kaputte Biographien am Tresen tummeln, deren Lebenslicht langsam an den spitzen Enden ihrer Zigaretten verglüht. Junior, der Sohn seines Freundes Henry, wirkt dabei als Brandbeschleuniger. Wie lebensmüde Versionen von Sal Paradise und Dean Moriarty in Kerouacs On the Road rasen sie durchs Land, saufen sich besinnungslos, prügeln sich in der Gosse, wachen mit wenigen Zähnen und noch weniger Selbstachtung verkatert irgendwo wieder auf und wünschen sich nichts sehnlicher, als das Ende ihrer sinnlosen Existenz.
Whitmer nimmt uns mit ins San-Luis-Valley, einst ein Paradies für Goldgräber, jetzt eine trostlose Gegend im ökonomischen Ödland des Mittleren Westens. Sein Protagonist Patterson Wells befreit eine gefesselte Frau aus der Badewanne eines Meth-Süchtigen und beschwört damit eine schwarze Wolke herauf, die sich im gegen Ende des Romans in einem brachialen Gewalt-Gewitter über ihm entlädt. Es ist ihm schlicht egal. Seit dem Tod seines Sohnes, dem er in rührenden Briefen seine Gefühlswelt offenbart, hat Patterson das Vergessen zur höchsten Tugend erhoben. Er gießt jede Menge Dosenbier auf all seine Erinnerungen und taumelt taub durch Klein- und Großstadtkaschemmen, in denen sich kaputte Biographien am Tresen tummeln, deren Lebenslicht langsam an den spitzen Enden ihrer Zigaretten verglüht. Junior, der Sohn seines Freundes Henry, wirkt dabei als Brandbeschleuniger. Wie lebensmüde Versionen von Sal Paradise und Dean Moriarty in Kerouacs On the Road rasen sie durchs Land, saufen sich besinnungslos, prügeln sich in der Gosse, wachen mit wenigen Zähnen und noch weniger Selbstachtung verkatert irgendwo wieder auf und wünschen sich nichts sehnlicher, als das Ende ihrer sinnlosen Existenz.
Nach mir die Nacht handelt aber auch von dem, was Vätern ihren Söhnen antun, und wie diese damit umgehen. Der Roman legt eine Spirale aus Schuldzuweisungen und Selbstmitleid offen, aus der es kein Entrinnen gibt. „Nichts schürt den Selbsthass so sehr wie ein eigenes Kind.“ Seine Figuren versuchen dennoch, dem zu entkommen – jede auf ihre Art. Patterson meint, er könne ein einfaches Leben in einer einsamen Hütte leben, fernab vom Rest der Gesellschaft wie einst Henry David Thoreau. Er testet aber auch Juniors Ansatz, der wiederum versucht, sich mit offenen Augen und ausgeschaltetem Verstand direkt ins Zentrum der Bestie, ins größtmögliche Chaos zu stürzen, und dadurch den eigenen Gedanken ein Schnippchen zu schlagen. Unnötig zu erwähnen, dass sie beide auf ihre Art scheitern.
„Ich denke, dass es um Verlust geht. Dass ein Loch in dir entsteht, wenn du einen Menschen oder eine Sache, die dir wichtig ist, verlierst. Genau an der Stelle, wo das Verlorene einmal in dir gelebt hat. […]. Es ist, als ob alle […] ein bodenloses Loch in sich hätten, aber niemanden davon erzählen können, also erfinden sie Geschichten, die genauso schrecklich und beängstigend sind wie ihr Loch. Diese Geschichten schmeißen sie dann hinein und hoffen, dass es sich so wieder füllen lässt.“
Beide Romane, Whitmers Nach mir die Nacht und Jones‘ Ein einziger Schuss, sind, auch wenn sie zuweilen an Werke aus anderen Bereichen der Literatur erinnern, fest in der Tradition des Country Noir verwurzelt. Sie variieren bekannte Motive und Themen auf neue, aufregende Weise, ohne sich dabei allzu weit von den Konventionen des Subgenres zu entfernen. Nicht so Zerrüttung von Jon Bassoff, das – wenn man mich fragt – beeindruckendste Buch, das man letztes Jahr aus den Regalen ausgewählter Buchhandlungen hervorziehen konnte. Auch hier lassen sich zwar Vergleiche finden – zu Jim Thompsons Schilderung amerikanischer Kleinstädte (nicht umsonst heißt eine Stadt im Buch „Thompsonville“) und seiner Art, Geschichten immer weiter Richtung Horror zu verdrehen beispielsweise –, doch die Eigenständigkeit von Bassoffs düsterer Version überstrahlt sie alle. Ein dunkles Evangelium, das vom Untergang kündet.
 Joseph Downs Gemütszustand steht ihm ins Gesicht geschrieben. Vernarbt ist es, zerschrammt, von einer Splitterbombe im Irak in Fetzen gehauen. Nun hat es ihn in einer kleinen Stadt, die überall in den USA liegen könnte, verschlagen, wo er stumm vor seinem Bier sitzt und darauf wartet, dass das Schicksal erneut mit ihm Flipper spielt. Es offenbart sich ihm in Gestalt von Lilith, einer Frau, die ähnlich viele Wunden vorzuweisen hat wie Joseph selbst. Er lässt sich von ihr ziehen und zerren, spielt ihre Spielchen, wagt ab und an sogar zu Träumen, sich in der Illusion, die sie ihm anbietet, zu verlieren. Doch im Grunde genommen macht er sich nichts vor: Für Lilith ist er nur Mittel zum Zweck. Sie bentuzt ihn, um ihren gewalttätigen Mann loszuwerden. Am Ende gibt Joseph ihr die Bestie, die sie in ihm sieht – er kann nicht anders. Oder, um es mit seinen Worten zu sagen: „Wir werden schon schuldig geboren, und was Gott eigentlich tun sollte, ist zu verhindern, dass wir dann noch so richtig Fahrt aufnehmen.“
Joseph Downs Gemütszustand steht ihm ins Gesicht geschrieben. Vernarbt ist es, zerschrammt, von einer Splitterbombe im Irak in Fetzen gehauen. Nun hat es ihn in einer kleinen Stadt, die überall in den USA liegen könnte, verschlagen, wo er stumm vor seinem Bier sitzt und darauf wartet, dass das Schicksal erneut mit ihm Flipper spielt. Es offenbart sich ihm in Gestalt von Lilith, einer Frau, die ähnlich viele Wunden vorzuweisen hat wie Joseph selbst. Er lässt sich von ihr ziehen und zerren, spielt ihre Spielchen, wagt ab und an sogar zu Träumen, sich in der Illusion, die sie ihm anbietet, zu verlieren. Doch im Grunde genommen macht er sich nichts vor: Für Lilith ist er nur Mittel zum Zweck. Sie bentuzt ihn, um ihren gewalttätigen Mann loszuwerden. Am Ende gibt Joseph ihr die Bestie, die sie in ihm sieht – er kann nicht anders. Oder, um es mit seinen Worten zu sagen: „Wir werden schon schuldig geboren, und was Gott eigentlich tun sollte, ist zu verhindern, dass wir dann noch so richtig Fahrt aufnehmen.“
Dann ist da noch Benton Faulk, ein abgemagerter, manischer Teenager, der unter lebensunwürdigen Umständen haust, und letztlich davor flieht – in die Fantasiewelt seiner Comics und Schundromane. Seine Persönlichkeit splittert, sein Realitätssinn verdreht sich bis zur Unkenntlichkeit, verheddert sich im Gefühlschaos, formt aus ihm einen unberechenbaren, zwischen Grausamkeit und Liebe hin- und hergerissenen Menschen. Man möchte ihn in den Arm nehmen. Man möchte kotzen. In seiner Manie packt er sich eine hilflose Frau und hält sie sich wie einen Hund. Die Düsternis streckt ihre Klauen aus, und zieht Leserinnen und Leser in die trostloseste aller Welten. Benton entkommt ihr letztlich auf ungewöhnliche Weise, während wir, die wir immer verstörter seinen Gedanken lauschen, uns fragen, was wir eigentlich noch glauben können.
„Es war ein kalter Winter, es hörte nicht mehr auf zu schneien und es wurde immer früher dunkel, bis es schließlich überhaupt nicht mehr Tag zu werden schien. Und es gab Augenblicke voll Glück, Augenblicke, in denen ich überzeugt war, dass alles gut werden würde, aber diese Augenblicke verschwanden wie Tränen in der Dunkelheit, und das Elend kroch durch einen Spalt im Fenster und setzte sich in einer Ecke der Hütte auf seinen fetten Arsch und glotzte mich zufrieden und grimmig an.“
 Wenn die zuvor erwähnten Romane einen rationalen Zugang zu früheren und aktuellen (Fehl-)Entwicklungen in den USA ermöglichen, so lässt sich Bassoffs Werk vielleicht als abstraktes Stimmungsbild, als eine Art Thermofotografie der emotionalen Verfasstheit des Landes beschreiben. Und wenn sich in Ein einziger Schuss und Nach mir die Nacht noch Fragmente des klassischen frontier-Mythos finden lassen, so findet sich in Zerrüttung die Antithese: Der Roman erzählt von Menschen, deren Grenzerfahrungen sie einholen, zurückrollen und letzten Endes vollständig zerstören. Jeder Optimismus verpufft im Staub der wüsten Geschichte, und es gibt nichts, was noch erstrebenswert wäre. Und dann ist da noch etwas an diesem Buch, das sich jeder Beschreibung entzieht. Etwas Unfassbares. Der irische Krimiautor Ken Bruen macht seiner Ratlosigkeit gar in dem Vorschlag Luft, für Zerrüttung (im Orignal: Corrosion) ein neues Subgenre zu schaffen: Den corrosive noir. Vielleicht gelingt es uns aber auch eines Tages, die Welt, von der Bassoff erzählt, wieder zusammenzusetzen.
Wenn die zuvor erwähnten Romane einen rationalen Zugang zu früheren und aktuellen (Fehl-)Entwicklungen in den USA ermöglichen, so lässt sich Bassoffs Werk vielleicht als abstraktes Stimmungsbild, als eine Art Thermofotografie der emotionalen Verfasstheit des Landes beschreiben. Und wenn sich in Ein einziger Schuss und Nach mir die Nacht noch Fragmente des klassischen frontier-Mythos finden lassen, so findet sich in Zerrüttung die Antithese: Der Roman erzählt von Menschen, deren Grenzerfahrungen sie einholen, zurückrollen und letzten Endes vollständig zerstören. Jeder Optimismus verpufft im Staub der wüsten Geschichte, und es gibt nichts, was noch erstrebenswert wäre. Und dann ist da noch etwas an diesem Buch, das sich jeder Beschreibung entzieht. Etwas Unfassbares. Der irische Krimiautor Ken Bruen macht seiner Ratlosigkeit gar in dem Vorschlag Luft, für Zerrüttung (im Orignal: Corrosion) ein neues Subgenre zu schaffen: Den corrosive noir. Vielleicht gelingt es uns aber auch eines Tages, die Welt, von der Bassoff erzählt, wieder zusammenzusetzen.
Bis es soweit ist, können wir nur versuchen zu verstehen. Erzählungen können uns dabei helfen. Nicht umsonst findet sich 1984 gerade auf den Bestsellerlisten wieder, nicht umsonst hat Crime Mag immer wieder amerikanische Autoren wie Thomas Adcock und Joe R. Lansdale zu Wort kommen lassen. Lesen Sie. Nehmen Sie eines der vorgestellten Bücher zur Hand. Greifen Sie zu Ross Thomas, oder zu Fear and Loathing on the Campaign Trail von Hunter S. Thompson, wenn Sie wissen möchten, wie das politische System dort drüben tickt. Entdecken Sie, wie Alf Mayer es bereits im Oktober 2013 vorschlug, Alexis de Tocqueville wieder, der wie kein Zweiter über die Verbindung von Politik und der Beschaffenheit des Landes geschrieben hat. Oder Ambrose Bierce, den vielleicht bissigsten Kommentator der amerikanischen Literaturgeschichte, der Wahlen einst als „instrument and symbol of a freeman’s power to make a fool of himself and a wreck of his country“ bezeichnete. Es sind Erzählungen, die unsere Welt erfahrbar machen, und es sind Erzählungen, die sie zusammenhalten. Lassen Sie nicht zu, dass alles auseinanderfällt. Lesen Sie.
Alexander Roth
Jon Bassoff: Zerrüttung. Kriminalroman. Aus dem Amerikanischen von Sven Koch. Broschur. Polar Verlag, Hamburg 2016. 308 Seiten, 14,90 Euro.
Matthew F. Jones. Ein einziger Schuss. Aus dem Amerikanischen von Robert Brack. Broschur. Polar Verlag, Hamburg 2016. 274 Seiten, 14, 90 Euro.
Benjamin Whitmer: Nach mir die Nacht. Kriminalroman. Aus dem Amerikanischen von Len Wanner. Polar Verlag, Hamburg 2016. 308 Seiten, 14,90 Euro.
Weitere verwendete Literatur:
Jost Bauch: Mythos und Entzauberung. Politische Mythen der Moderne. Taschenbuch. Gerhard Hess Verlag, Bad Schussenried 2014. 192 Seiten, 16,80 Euro.
Hans-Dieter Gelfert: Typisch Amerikanisch. Wie die Amerikaner wurden, was sie sind. Taschenbuch. C.H. Beck, München 2012. 215 Seiten, 12,95 Euro.
Sonja Hart: Über Country Noir. Polar Gazette 4/2015. Nachzulesen hier.
Frederick Jackson Turner: The Significance of the Frontier in American History. Erstmals 1893 erschienen, mittlerweile kostenlos und legal bei Projekt Gutenberg abrufbar.












