 Lesen Sie heute den 2. Teil des Essays von Ulrich Baron (den ersten gibt’s hier), der sich mit Raymond Chandler und dessen Region, mit Los Angeles beschäftigt.
Lesen Sie heute den 2. Teil des Essays von Ulrich Baron (den ersten gibt’s hier), der sich mit Raymond Chandler und dessen Region, mit Los Angeles beschäftigt.
II. Kein Verbrechen in den Bergen?
Wie ein Verdikt gegen eine Regionalisierung und Provinzialisierung mutet der Titel einer Erzählung von Raymond Chandler an. Sein „No crime in the Mountains“ war 1941 aber keine hellsichtige Warnung vor einer drohenden Flut von Regio-Krimis, sondern als Ironisierung der Unschuldsvermutung gemeint, die man angesichts von Gegenden hegt, in denen die Welt noch in Ordnung zu sein scheint.
 Die Story einer fünften Kolonne der Achsenmächte in der amerikanischen Provinz zählt nicht zu Chandlers Spitzenleistungen, aber wenn man einen Detektiv aus Los Angeles herauslocken will, bedarf es wohl schon eines großen Köders – oder, wie hier angedeutet wird, einer Flaute im Ermittlungsgeschäft. So nimmt Chandlers Held hier einen Auftrag an, der ihn im Fremdenverkehrsort Puma Point in ein Wespennest stechen lässt. Nazi-Agenten haben das von Sommertouristen überlaufene und von Touristendollars überschwemmte Kaff ausgewählt, um dort unauffällig größere Mengen Falschgeld in Umlauf zu bringen und so die US-Währung zu destabilisieren. Für Kommissar Wallander zählten solche internationalen Verschwörungen schon zum Alltagsgeschäft, doch zu Chandlers Zeiten war ein Abstecher in die Weltpolitik noch die Ausnahme.
Die Story einer fünften Kolonne der Achsenmächte in der amerikanischen Provinz zählt nicht zu Chandlers Spitzenleistungen, aber wenn man einen Detektiv aus Los Angeles herauslocken will, bedarf es wohl schon eines großen Köders – oder, wie hier angedeutet wird, einer Flaute im Ermittlungsgeschäft. So nimmt Chandlers Held hier einen Auftrag an, der ihn im Fremdenverkehrsort Puma Point in ein Wespennest stechen lässt. Nazi-Agenten haben das von Sommertouristen überlaufene und von Touristendollars überschwemmte Kaff ausgewählt, um dort unauffällig größere Mengen Falschgeld in Umlauf zu bringen und so die US-Währung zu destabilisieren. Für Kommissar Wallander zählten solche internationalen Verschwörungen schon zum Alltagsgeschäft, doch zu Chandlers Zeiten war ein Abstecher in die Weltpolitik noch die Ausnahme.
Ironischerweise hat sich der Ortspolizist von Puma Point, in seinen eigenen Worten „Puma Point constable and San Berdoo deppity sheriff“ Barron, von der Feuerwehr von LA dorthin abgesetzt, weil es in den Bergen so „nice and quiet“ sein soll. Damit ist es vorbei, als ihm Chandlers Detektiv mit der Nachricht von einem Mord ins Haus fällt, und am Ende müssen selbst die Nazi-Verbrecher einsehen, dass es mit der erhofften Ruhe in den Bergen vorerst vorbei ist.
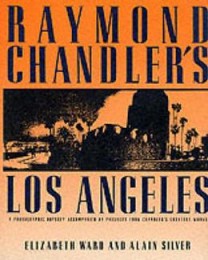 Obwohl diese Geschichte und vor allem die raumfüllende Präsenz Barrons Züge des Regio-Krimis und seiner gemütlichen Ermittler vorwegnehmen, wird von den Verteidigern dieses ausufernden Subgenres nicht auf Puma Point, sondern immer auf LA verwiesen. Natürlich, denn wenn man einen mächtigen Gewährsmann wie Chandler herbeizitieren möchte, dann begnügt man sich nicht mit einem seiner Nebenwerke. Doch Chandlers Wahl von LA war eben gerade eine Entscheidung gegen die Provinz als Schauplatz. Von der hat sein Kollege und Zeitgenosse Erskine Caldwall mit „Tobacco Road“ 1932 ein niederschmetterndes Bild gezeichnet, das Philip Marlowes Schöpfer einmal genüsslich zitiert, um einen von dessen unsympathischeren Klienten durch den Kakao zu ziehen. Er selbst aber hat sich für die Metropole entschieden, denn schließlich zählt zum Faszinosum des Krimis auch, dass er privilegierte Einblicke zu gewähren scheint – sei es in die Abgründe des modernen Großstadtlebens oder in die Villen und Landhäuser alter und neuer Oberschichten.
Obwohl diese Geschichte und vor allem die raumfüllende Präsenz Barrons Züge des Regio-Krimis und seiner gemütlichen Ermittler vorwegnehmen, wird von den Verteidigern dieses ausufernden Subgenres nicht auf Puma Point, sondern immer auf LA verwiesen. Natürlich, denn wenn man einen mächtigen Gewährsmann wie Chandler herbeizitieren möchte, dann begnügt man sich nicht mit einem seiner Nebenwerke. Doch Chandlers Wahl von LA war eben gerade eine Entscheidung gegen die Provinz als Schauplatz. Von der hat sein Kollege und Zeitgenosse Erskine Caldwall mit „Tobacco Road“ 1932 ein niederschmetterndes Bild gezeichnet, das Philip Marlowes Schöpfer einmal genüsslich zitiert, um einen von dessen unsympathischeren Klienten durch den Kakao zu ziehen. Er selbst aber hat sich für die Metropole entschieden, denn schließlich zählt zum Faszinosum des Krimis auch, dass er privilegierte Einblicke zu gewähren scheint – sei es in die Abgründe des modernen Großstadtlebens oder in die Villen und Landhäuser alter und neuer Oberschichten.
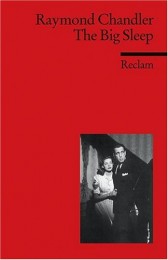 Vor einem solchen Domizil beginnt Chandlers Roman „The Big Sleep“ (1939), der sich bald zu einer Art Sightseeing-Tour kreuz und quer durch LA und Umgebung zu entwickeln scheint. Dank der großen Kleinarbeit, die Bernd Neumeyer und Klaus Degering schon 1994 für die Ausgabe in Reclams Fremdsprachentexte geleistet haben, kann man deren Realitätshaltigkeit auch ohne Promotionsstipendium und für nur 8 Euro überprüfen. Bald wird man dabei feststellen, dass auch Mankells großer Vorläufer präzise Lokalisierungen nur vorgaukelt. Chandler geizt zwar nicht mit Ortsbezeichnungen und Straßennamen und nennt selbst Haus- und Appartementnummern; bei der Überprüfung der Schauplätze aber stellte Klaus Detering fest, „dass sowohl bei Geigers als auch bei Brodys Adresse die Namen der Straßen, die unmittelbar zu den Wohnsitzen führen – Laurel Canyon Drive und Laverne Terrace bzw. Brittany Place und Randall Place – fiktiv sind.“ Allerdings gebe es in Los Angeles eine La Verne Avenue, einen Laurel Canyon Boulevard, einen Laurel Canyon Place und sogar zwei Laurel Drives, eine Brittania Street und zweimal eine Randall Street.
Vor einem solchen Domizil beginnt Chandlers Roman „The Big Sleep“ (1939), der sich bald zu einer Art Sightseeing-Tour kreuz und quer durch LA und Umgebung zu entwickeln scheint. Dank der großen Kleinarbeit, die Bernd Neumeyer und Klaus Degering schon 1994 für die Ausgabe in Reclams Fremdsprachentexte geleistet haben, kann man deren Realitätshaltigkeit auch ohne Promotionsstipendium und für nur 8 Euro überprüfen. Bald wird man dabei feststellen, dass auch Mankells großer Vorläufer präzise Lokalisierungen nur vorgaukelt. Chandler geizt zwar nicht mit Ortsbezeichnungen und Straßennamen und nennt selbst Haus- und Appartementnummern; bei der Überprüfung der Schauplätze aber stellte Klaus Detering fest, „dass sowohl bei Geigers als auch bei Brodys Adresse die Namen der Straßen, die unmittelbar zu den Wohnsitzen führen – Laurel Canyon Drive und Laverne Terrace bzw. Brittany Place und Randall Place – fiktiv sind.“ Allerdings gebe es in Los Angeles eine La Verne Avenue, einen Laurel Canyon Boulevard, einen Laurel Canyon Place und sogar zwei Laurel Drives, eine Brittania Street und zweimal eine Randall Street.
Sowohl deutsche Leser als auch Mitte der 1930er Jahre dort Ansässige können sich also in Chandlers LA heimisch fühlen, obwohl es sich eindeutig um fiction handelt, die der Verfasser natürlich dort lokalisiert hat, wo krimimäßig am meisten zu holen war – in einer kalifornischen Metropole, in der Ölmagnaten, Erpresser, Glückspieler und Kasinobetreiber große Räder drehten, zwischen denen kleine Ganoven und Privatschnüffler zerrieben wurden.
 Chandlers LA ist eben nicht irgendein Ort, sondern der Ort, an dem all die schlimmen Dinge passierten, von denen man in der deutschen Provinz immer nur lesen kann. Dass viele Ortsangaben authentisch sind oder authentisch klingen, sollte seine Romane jedoch nicht als Reiseführer qualifizieren, sondern zählt zur Grundausstattung realistischer Prosa, zur Kunst des „Als ob“, die ihren Fiktionen mit solchen Anleihen Glaubwürdigkeit verleiht. Wo solche Anleihen aber überhand nehmen, wächst der Verdacht, dass hier außer dem Schauplatz rein gar nichts stimmt, dass es hier nur auf die Ausstattung ankommt, auf Folklore, Situationskomik und Wiedererkennungseffekte, aber nicht auf die Story. Um einen Krimi zum Mitschunkeln gewissermaßen, doch zum richtigen Krimi zählt auch jene Prise Gift, die jeglicher Gemütlichkeitsduselei den Garaus macht: „A night like this“, sagt Barron am Ende angesichts seines verlorenen Provinzparadieses und angesichts von etwas, was dunkler ist als die Nacht, „and it’s got to be full of death.“
Chandlers LA ist eben nicht irgendein Ort, sondern der Ort, an dem all die schlimmen Dinge passierten, von denen man in der deutschen Provinz immer nur lesen kann. Dass viele Ortsangaben authentisch sind oder authentisch klingen, sollte seine Romane jedoch nicht als Reiseführer qualifizieren, sondern zählt zur Grundausstattung realistischer Prosa, zur Kunst des „Als ob“, die ihren Fiktionen mit solchen Anleihen Glaubwürdigkeit verleiht. Wo solche Anleihen aber überhand nehmen, wächst der Verdacht, dass hier außer dem Schauplatz rein gar nichts stimmt, dass es hier nur auf die Ausstattung ankommt, auf Folklore, Situationskomik und Wiedererkennungseffekte, aber nicht auf die Story. Um einen Krimi zum Mitschunkeln gewissermaßen, doch zum richtigen Krimi zählt auch jene Prise Gift, die jeglicher Gemütlichkeitsduselei den Garaus macht: „A night like this“, sagt Barron am Ende angesichts seines verlorenen Provinzparadieses und angesichts von etwas, was dunkler ist als die Nacht, „and it’s got to be full of death.“
http://www.youtube.com/watch?v=LIbFzcdOKUo
Ulrich Baron
Ulrich Baron, Jahrgang 1959, war Literatur- und Sachbuchredakteur in Bonn und Berlin, schreibt Rezensionen, Kritiken, Essays und Texte aller Art, findet Kriminalliteratur umso unterhaltsamer, je ernsthafter man sich über sie unterhalten kann, und mag keine Ersatz- und Füllstoffe im Krimi und anderswo.
Links zur Debatte: Klaus-Peter Wolfs Artikel zum Regiokrimi, Carlo Schäfers Regiokrimiwettbewerb, Thomas Wörtches Einschätzung, daraufhin wieder Carlos und Dirk Schmidt. Ein Artikel zum Thema von Christine Lehmann.











