Essay und Rezension
Es handelt sich um drei voluminöse Bände mit Anhängen: Cixin Liu: Die Drei Sonnen (591 Seiten)[1], Der Dunkle Wald (815 Seiten)[2] und Jenseits der Zeit (990 Seiten)[3]. Der Inhalt: In unserem, ehemals mehrdimensionalen Universum herrscht ein Krieg aller gegen alle. Diese Romane sind absolut phantastisch. Diese Romane sind eine Variationenreihe zum Thema Übersetzung, nicht nur aus dem Chinesischen. Diese Romane beschreiben die immer wieder verzögerte Auslöschung der Menschheit bzw. des Sonnensystems.
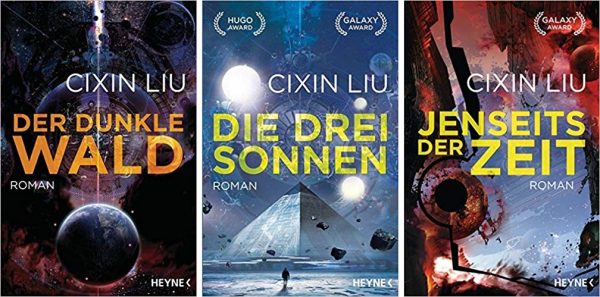
Erster Band: Das Andere, die Anderen, die Trisolarier nämlich in ihrem gravitationsmäßig herausfordernden Dreifachsonnensystem und ihre evolutionär daran angepasste Kultur und Technologie sind für die Menschen nur als Übersetzung/Repräsentation erfassbar: „Anstelle ihrer unsichtbar bleibenden Körper treten menschenähnliche Selbstbilder in einem virtuellen Spiel namens ‚Three Body‘, in dem menschliche Spieler in Gestalt realer historischer Figuren wie […] Kopernikus, Newton und John von Neumann allmählich die Realität der Trisolarier und das Geheimnis ihrer von Gesetzlosigkeit und Formlosigkeit bestimmten Welt zu begreifen lernen.“[4]

Der zweite Band lebt von der Metapher bzw. der Allegorie des dunklen Waldes – eine grundlegende, und zwar soziologische Verfasstheit des Kosmos. In einer von Leben übervollen Galaxie gilt es, entweder sich vor der Zerstörung durch andere Konkurrenten zu verstecken oder andere Zivilisationen, da eine potentielle Gefährdung, zu zerstören. Spontan musste ich an das berühmte Heraklit-Zitat denken, das keineswegs naiven Militarismus propagiert, sondern eine bittere antike Realität reflektiert: „Krieg ist von allem der Vater, von allem der König, denn die einen hat er zu Göttern, die anderen zu Menschen, die einen zu Sklaven, die anderen zu Freien gemacht.“[5] Der dunkle Wald hat tatsächlich die einen zu kosmischen Göttern, die anderen zu Sklaven der Angst vor der Vernichtung gemacht:
„‘Das Universum ist ein dunkler Wald. Jede Zivilisation ist ein bewaffneter Jäger, der wie ein Geist zwischen den Bäumen umherstreift, vorsichtig störende Zweige aus dem Weg schiebt und versucht, geräuschlos aufzutreten und so leise wie möglich zu atmen. Der Jäger muss vorsichtig sein, denn überall im Wald lauern andere Jäger wie er. Stößt er auf anderes Leben, egal ob es sich dabei um einen anderen Jäger, einen Engel oder einen Teufel, ein neugeborenes Baby oder einen alten Tattergreis, eine Fee oder einen Waldgeist handelt, bleibt ihm nichts anderes übrig, als es auszuschalten. In diesem Wald sind die Hölle die anderen Lebewesen. Es herrscht das ungeschriebene Gesetz, dass jedes Leben, das sich einem anderen offenbart, umgehend eliminiert werden muss. Das ist das Bild der kosmischen Zivilisationen. Das erklärt das Fermi-Paradox.‘“[6]
Der dritte Band inszeniert Strategien der Abschreckung zwischen Trisolaris und der Erde – eine Mimesis des Kalten Krieges: Es wird nämlich mit der Möglichkeit gedroht, den Standort des jeweils anderen preiszugeben. Aber beinahe bringen die Trisolarier die Menschheit sogar an den Rand der Auslöschung, nachdem sie diese geschickt ausgetrickst haben; die Erdbevölkerung wird nach Australien deportiert, um dort in einer Art Reservat weiter zu vegetieren. Die Vertriebenen sollen sich gegenseitig als Nahrung auf dem überbevölkerten Kontinent dienen, so der Plan. Eine Erinnerung an das Britische Empire oder die Vernichtung der Indianer. Doch im letzten Moment, durch Zufall, wird die Position von Trisolaris im dunklen Wald bekannt gegeben, was zu dessen Zerstörung führt. Die Menschheit entwickelt daraufhin einen Bunkerplan: sich in Weltraumstädten hinter den Gasriesen des System zu verstecken, falls die Sonne zerstört würde.

Auch wenn die meisten Akteure vor allem aus China stammen: die Perspektive ist immer die der Menschheit. Die literarische Umsetzung physikalisch-kosmologischer Ideen ist purer Genuss, grandios, verrückt die humane Arroganz an den Rand der Bedeutungslosigkeit. Die Handlung, obwohl stringent, gleicht einer wahnwitzigen Achterbahnfahrt; und auf der nächsten Seite lauert die nächste atemraubende Überraschung. Was hat mich besonders berührt? In Band 1 war es das Trauma einer Hauptfigur, das aus der Kulturrevolution Maos herrührte und das zur Kontaktaufnahme mit Trisolaris und damit fast zur Zerstörung der Erde führte. Im Band 2 waren es die in den Handlungsgang eingeflochtenen Meditationen zu dem, was Literatur vermag, die bei einer der Hauptfiguren zu einem gespenstischen und zugleich romantischen Hin-und-Her aus Fiktion und Realität führten (wobei diese Grenzziehung sich ohnehin auflöst …). Und es war die Verschiebung in Richtung einer Gesellschaftstheorie des Kosmos; eine physikalische Darstellung wird so durch eine soziologische ergänzt. In Band 3 beeindruckte mich das Märchen Des Königs neuer Maler/ Das Vielfraßmeer/ Prinz Tiefes Wasser[7], gefolgt von einer mehrstufigen Metapherntheorie zu seiner Dekodierung. Der Hintergrund: Das Gehirn (!) – anders war es technisch nicht möglich – von Yun Tianming schickte man zur trisolarischen Flotte; dort lebend, wurde es/er zu einer Simulation, der die Trisolarier ein einziges Mal erlaubten, unter strengen Auflagen mit Cheng Xin, einer der Hauptfiguren, zu reden. Und indem es/er ein Märchen erzählt, erhalten die Menschen nach mühseligen Interpretationsversuchen wichtige Informationen, z.B. über die Folgen eines Fluges mit Lichtgeschwindigkeit. Das Märchen übersetzt Physik, die wieder rückübersetzt wird in die folgenden Ereignisse. Ein böser Maler vermag z.B. den dreidimensionalen König auf ein zweidimensionales Blatt Papier zu bannen. Wie kündigt sich die Zerstörung des Sonnensystems an? Durch einen Papierfetzen! Diese Waffe faltet nämlich alles in zwei Dimensionen zusammen. Die unaufhaltsame Reduktion des Sonnensystems zu einem Bild wird erschreckend schön in epischer Breite geschildert, zelebriert. Der Erzähler (Wer ist das in diesem Roman überhaupt? Die Erzählerin? Oder viele Erzähler?) geht auch dann an die Grenzen menschlicher Ausdrucksmöglichkeiten, um zu imaginieren, was passieren könnte, wenn ein Raumschiff auf vierdimensionale Fragmente trifft. Natürlich nur Phantasie, aber bei Cixin Liu klingt das fast schon unheimlich so, als wäre er dabei gewesen …

Yun Tianming, unheilbarer Romantiker, der er ist, schenkte Cheng Xin zuerst einen Stern und dann eine Art Mini-Universum (Nr. 647!), damit sie und Guan Yifan, als letzte Menschen (?), als neue Eva und neuer Adam, in dieser Arche überleben können. Aus meinem Forschungsinteresse heraus – das Verhältnis von Religion und Science Fiction – musste ich feststellen, das Cixin Liu fast ohne Gott/Götter/Theologie auskommt. Ab und zu wird eher beiläufig betont, dass neue Erkenntnisse über den Kosmos die Religionen fast an den Rand des Zusammenbruchs führten, diese aber in Krisenzeit absurde Revivals feierten. Doch am Ende des 3. Bandes findet sich ein theologisch-mythologischer Gedanke: das Universum wäre anfänglich ein Paradies gewesen, das nun verloren gegangen sei, in das einige Zivilisationen aber nun wieder zurückwollen. Paradies? Gewiss nur eine Hypothese aus der Sicht einer Figur des Romans, ein plausibler Deutungsrahmen. Der allwissende (?) Erzähler (?) gibt uns Lesern und Leserinnen einen Hinweis: Auf den Seiten 743-755 erhalten wir Einblick in das quasi bürokratische Verfahren, mit der die richtige Zerstörungswaffe für das Aufräumen (!) unseres Sonnensystems ausgesucht werden soll. Man gibt sich dabei Mühe. Gottgleiche Wesen – irgendwie. Doch nicht ohne Ironie: ein untergeordneter Angestellter (?) muss erst seinen Chef (?) um Erlaubnis für die Verwendung der Zweivektorenfolie fragen.
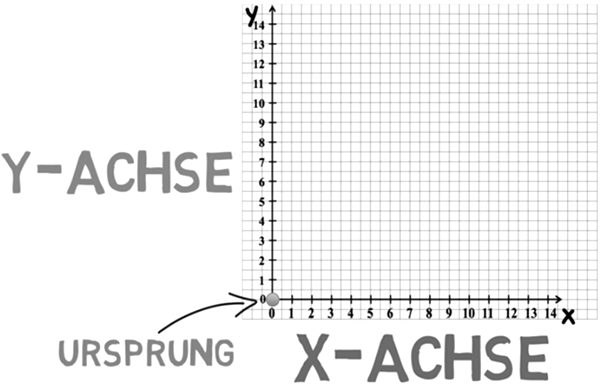
Für Guan Yifan stellt sich die kosmische Situation noch deprimierender dar: „‘[…] Wenn Sie sich das Universum als ein großes Schlachtfeld vorstellen, dann sind Dunkler-Wald-Angriffe eine Nebensächlichkeit, so als würden Scharfschützen die Unvorsichtigen der anderen Seite abschießen […]. Aber erleben sie erst einmal einen richtigen Krieg der Sterne.‘“[8] In diesem Star Wars würden, so Guan Yifans Befürchtung, sogar die Gesetze der Physik und Mathematik zu Waffen umfunktioniert – mit autodestruktiven Folgen aber auch für die Angreifer. Und: „‘Die Dimensionsangriffe führen dazu, dass ein wachsender Teil des Universums zweidimensional wird, bis eines Tages das ganze Universum so weit ist.‘“[9] (Nebenbei bemerkt: Wie oft falten jetzt schon Menschen Dreidimensionales – und es ist mehr als nur dies, sondern auch Licht, Duft, Gefühl und Stimmung, Einmaligkeit, Unverfügbarkeit – mit ihren Handys auf zwei Dimensionen herunter, um was auch immer dann vermeintlich beliebig wiederholen, beherrschen zu können?)
Was ich hier geschrieben habe, ist nur der Bruchteil eines Fetzens einer Ahnung von einem Fragment eines winzigen Splitters, der diese Roman-Trilogie ausmacht. Im Grunde setzt sie konsequent den Titel eines Aufsatzes des Autors um: Cixin Liu: Beyond Narcissism: What Science Fiction Can Offer Literature.[10] Oder aus dem Nachwort von Die Drei Sonnen:
„Die Schöpfungsmythen der verschiedenen Völker und Religionen unserer Welt verblassen angesichts der Pracht des Urknalls. Die drei Milliarden Jahre lange Geschichte der Evolution des Lebens von sich selbst vervielfältigenden Molekülen bis hin zur Zivilisation ist reicher an Überraschungen und romantischen Momenten als jeder Mythos und jedes Epos. Und dann ist da noch die poetische Vision von Raum und Zeit in der Relativität, von der seltsamen subatomaren Welt der Quantenmechanik … Diese wundersamen Geschichten der Wissenschaft verfügen alle über eine unwiderstehliche Anziehungskraft. Durch das Medium der SF-Literatur möchte ich einzig und allein mit der Kraft der Fantasie meine eigenen Welten erschaffen und in ihnen die Poesie der Natur vermitteln, die romantischen Legenden erzählen, die sich zwischen dem Menschen und dem Universum entfalten.“[11]

Jenes Trisolaris-Universum gleicht einem Wunder und einem Albtraum zugleich. Am Ende, wirklich am Ende von allem arbeiten die einstigen Gegner zusammen. Was Cheng Xin auszeichnet, jene Erlöserfigur, die sie nicht sein möchte?[12] Aus Liebe zum Leben hat sie die Geschichte von der irdischen Evolution gerettet und aus Verantwortung heraus verzichtet sie auf ihr Mini-Universum-jenseits-der-Zeit, um den Kollaps des Großen Kosmos zu ermöglichen – anstelle seiner unendlichen Ausdehnung. Ein neuer Urknall könnte ein neues Paradies bedeuten. Vielleicht. Cixin Liu: ein kosmischer Poet, ein kosmischer Epiker. Das Unvorstellbare erzählen – wäre das nicht auch Romantik?
„Das zweidimensionale Bild ist ein überzeugendes Symbol für Lius literarische Methode in der Science-Fiction, die aus kleinsten Details eine fantastische Welt voller Erhabenheit entstehen lässt. […] Die Trilogie endet in einem Erstaunen, das die Science-Fiction weit über Determinismus oder politische Allegorien auf die Lage der Nation (und alles andere in Gewissheit Verwurzelte) hinaushebt in ein fiktives, transzendentales Reich, in dem Möglichkeiten und Wahrnehmungen jenseits der empirischen Realität offenstehen.“[13] Zu diesem experimentellen Charakter könnte ergänzt werden, „[…] dass Science Fiction ein sprachliches Abbild der Realität schafft, und zwar in einer Art hypermimetischem Verfahren, in dem das Metaphorische, Symbolische und Poetische als das im Wortsinn zu Verstehende erscheinen.“[14]
So kann uns z.B. der Newton in „Three Body“ sichtbar machen, was es heißt, auf Trisolaris zu leben – wir werden aber nie in der Lage sein, uns in die Existenzform eines Trisolariers zu übersetzen.[15] Autor wie Leserschaft sind an eine solche Hypermimesis gebunden, deren Poesie Realität ist. Besonders wird das Grenzhaftige dieses Verfahrens bei der Schilderung von Zwei- und Vierdimensionalität deutlich. Oder anders: das Poetische mancher Science Fiction-Filme bzw. -Romane ist zugleich real und transzendent. Nennen wir dies poetischen Realismus – und es könnte nun aufgezeigt werden, dass damit dieses Repräsentationskonzept von Science Fiction in der (Welt)Literaturgeschichte nicht wirklich singulär dastehen würde. Das nimmt aber keinesfalls etwas von seinem Zauber.
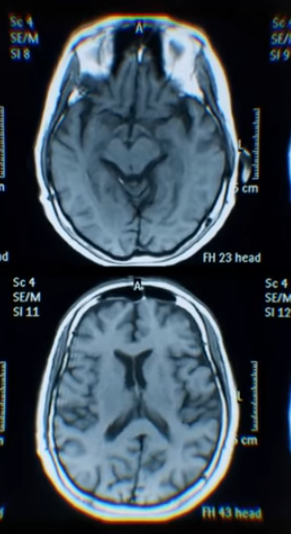
Yun Tianming, zuerst ein todkranker Mann; dann reduziert auf sein Gehirn; dann seine Auferstehung als Simulacrum. Seine körperlich nie erfüllbare Liebe zu Cheng Xin wird zu einer großen, kosmischen Sehnsucht, die sie verstehen und lieben lernt. Und auch eine letzte Begegnung bleibt ihnen versagt, bevor sie in den Tiefen der Zeit versinken. Dennoch … Und Cheng Xin? Sie durchläuft einen ethischen Bildungsroman: „Und jetzt habe ich den Gipfel der Verantwortung erreicht: Das Schicksal des ganzen Universums liegt in meinen Händen.“[16]

Und noch einen Schritt weiter: ich wage zu behaupten, diese Trilogie ist nicht geschlossen, sondern nur ein dreigliedriges Romanfragment einer fiktiven Unendlichkeit. Cixin Liu scheint mir zutiefst ein Romantiker zu sein. Ein Essay darf vor allem eines: freestyle. Darum, los geht’s! Thomas Nipperdey schrieb meiner Meinung nach eine der besten Zusammenfassung von der Epoche der Romantik. Ein kürzeres Zitat daraus: „Das fühlende Ich, seine Welterwartung und -vorstellung ist ‚poetisch‘; in den typisch romantischen Erlebnissen der Natur, der Liebe, der Kunst, des Abenteuers, des Wunderbaren stimmen Gefühl und Erfahrung zusammen. Aber die Wirklichkeit der Welt ist ‚prosaisch‘.“[17]

Es würde sich auch lohnen, die vielen literarischen Untergattungen in den Trisolaris-Romanen zu untersuchen, aber es geht mir um etwas Grundsätzlicheres. Der Kosmos und die Zivilisationen darin sind wesentlich zeichenhaft: sie werden als Zeichen sichtbar und somit deutbar. Die physikalische Natur wird nur durch Repräsentationen zur Anschauung gebracht (Passiv). Die Wesen in diesem Kosmos schaffen ständig Zeichen (Aktiv), die entziffert werden müssen – mit dem Risiko einer fehlerhaften oder fast zu spät kommenden richtigen Auslegung. Um das Nipperdey-Zitat zu variieren: das fühlende Ich von Cheng Xin nähert sich erst dem Schicksal der Menschheit, dann des Universums an. Ihre Welthaltung ist poetisch, von Liebe geprägt. Leonardo da Vinci und van Gogh kommen eine wichtige Rolle zu (wie auch Gedichten und Märchen). Was soll aus dem auf Pluto liegenden Grabmonument der Erde gerettet werden? Kunst eben. Über Abenteuer brauchen wir hier gar nicht weiter zu schreiben; und die Romane sind ein Zauberkästchen des Wunderbaren. Doch die Gefährdung der Romantik, ihre dunkle Seite, zeigt sich in der Prosa der gesellschaftlichen Verfasstheit kosmischer Zivilisationen: ein ewiger Krieg bis zur Vernichtung des Universums. Die Gründe? Was war der Sündenfall? Leerstellen …
Epilog I
„Wir wissen heute, dass dieser Weg für jede Zivilisation der gleiche ist: Wir erwachen in einer kleinen Wiege, dann purzeln wir heraus und fliegen davon, fliegen immer höher und weiter, und irgendwann, irgendwann ist unser kleines Schicksal das Schicksal des ganzen Universums. Jedes intelligente Wesen strebt danach, einmal so groß zu werden wie seine Gedanken.“[18]
Epilog II (Werkstattbericht – eine Montage)
Alf Mayer: „Also ich hätt’ gern mal was von Ihnen zu Trisolaris!“ Markus Pohlmeyer: „Unmöglich. Zu gigantisch. Darüber muss eine Monographie geschrieben werden! ‚Röchel.‘[19]“ Thomas Wörtche: „Ihnen fällt da sicher etwas ein.“ Markus Pohlmeyer: „Umpf.“ (Nachdenk … Nachdenk … Schreib …)
Markus Pohlmeyer lehrt an der Europa-Universität Flensburg.
Seine Texte bei CulturMag hier.
[1] Cixin Liu: Die Drei Sonnen. Roman, übers. v. M. Hasse, München (HEYNE) 2017.
[2] Cixin Liu: Der Dunkle Wald. Roman, übers. v. K. Betz, München (HEYNE) 2018.
[3] Cixin Liu: Jenseits der Zeit. Roman, übers. v. K. Betz, München (HEYNE) 2019.
[4] M. Song: Die Poesie des Unsichtbaren. Verborgene Dimensionen im chinesischen Science-Fiction-Kino, in K. Jaspers u.a. (Hrsg.): Future Worlds. Science. Fiction. Film, Berlin 2017, 122-137 , hier 132 f.
[5] Heraklit, in: Die Vorsokratiker, gr./dt., hg. v. J. Mansfeld – O. Primavesi, Stuttgart 2012, 265.
[6] Cixin Liu: Der Dunkle Wald. Roman, übers. v. K. Betz, München (HEYNE) 2018, 745.
[7] Cixin Liu: Jenseits der Zeit. Roman, übers. v. K. Betz, München (HEYNE) 2019, ab Seite 496.
[8] Cixin Liu: Jenseits der Zeit. Roman, übers. v. K. Betz, München (HEYNE) 2019, 891.
[9] Cixin Liu: Jenseits der Zeit. Roman, übers. v. K. Betz, München (HEYNE) 2019, 895.
[10] Cixin, Liu: Beyond Narcissism: What Science Fiction Can Offer Literature.in: Science fiction studies, übers. v. H. Nahm – G. Ascher, Bd. 40, 2013, 22-32.
[11] Liu Cixin: Nachwort des Autors, in: Cixin Liu: Die Drei Sonnen. Roman, übers. v. M. Hasse, München (HEYNE) 2017, 549-556, hier 553.
[12] Siehe dazu Cixin Liu: Jenseits der Zeit. Roman, übers. v. K. Betz, München (HEYNE) 2019, 956.
[13] M. Song: Die Poesie des Unsichtbaren. Verborgene Dimensionen im chinesischen Science-Fiction-Kino, in K. Jaspers u.a. (Hrsg.): Future Worlds. Science. Fiction. Film, Berlin 2017, 122-137, hier 134. Transzendental und Erhabenheit weisen stark auf Motive Kantischer Ästhetik hin.
[14] M. Song: Die Poesie des Unsichtbaren. Verborgene Dimensionen im chinesischen Science-Fiction-Kino, in K. Jaspers u.a. (Hrsg.): Future Worlds. Science. Fiction. Film, Berlin 2017, 122-137, hier 129.
[15] Siehe dazu auch T. Nagel: What Is It Like to Be a Bat? Wie ist es, eine Fledermaus zu sein? Engl./Dt., übers. u. hg. v. U. Diehl, Stuttgart 2016.
[16] Cixin Liu: Jenseits. Roman, übers. v. K. Betz, München (HEYNE) 2019, 956.
[17] T. Nipperdey: Deutsche Geschichte. 1800-1866. Bürgerwelt und starker Staat, München 1998, 572.
[18] Cixin Liu: Jenseits. Roman, übers. v. K. Betz, München (HEYNE) 2019, 957.
[19] Zitiert nach T. Wörtche











