Thomas Mann und Joseph: im Exil – Variationen zu Sprache als Heimat

Thomas Manns biographisch-räumliches Exil[1] seit 1933 verbindet sich mit dem Anliegen, eine deutsche Kulturtradition vor den Barbaren zuhause zu retten und einen mythopoetischen Gegenentwurf durch die Variation einer (biblischen) Geschichte über einen anderen Exilierten zu erschaffen, und zwar mit den Joseph-Romanen[2]. Im Folgenden war es mir vor allem wichtig, der Stimme Thomas Manns den Vorrang zu lassen; darum auch längere Zitate, die nur einen kleinen Einblick in das umfangreiche Schaffen seiner Exilzeit geben können. In der Tat handelt es sich in mehrfacher Hinsicht um einen Autor zwischen Welten[3]. In der Joseph-Tetralogie – ausgehend von der Erfahrung des Verstoßen- und Ausgeliefertseins (Joseph wird von seinen Brüdern verkauft und für tot erklärt!) und der Notwendigkeit eines Sich-Aneignen-Müssens der ägyptischen Kultur und ihrer Sprache – entsteht ein Mit- und Ineinander von Joseph/Israel und Ägypten/Pharao: hin zu einem neuen humanistischen und pragmatischen Gebilde, das nur gemeinschaftlich die drohende Katastrophe einer Hungersnot meistern kann.

„Die Ernährerfigur des vierten Bandes wird als Idealgestalt inszeniert, die Geist und Leben, Politik und Künstlertum verbindet. Joseph kombiniert Kronpolitik und Sozialismus, er vereint eine korrigierte Version der Weimarer Republik mit dem New Deal Roosevelts, der Amerika ebenso aus dem wirtschaftlichen Dämmerzustand holte – so zumindest die werbewirksame Selbstdarstellung des Präsidenten – wie Josephs Politik das fiktive Ägypten. In der Josephsfigur werden zudem die weltlichen Segensträger und demokratischen Pragmatiker Roosevelt und Goethe zusammengebracht. Joseph verbindet die Qualitäten der alten und der neuen Heimat, die Dauer des kulturellen Gedächtnisses Israels und die Fortschrittlichkeit des Gastlandes. Das Ägypten des vierten Bandes bildet weder Weimar noch die USA mimetisch ab, sondern ist ein fiktiver Ort, an dem politische Konstellationen als Ideal konstruiert werden.“[4]
Thomas Mann kämpfte als politischer Künstler gegenHitler, mit dem es – im Gegensatz zur Versöhnung zwischen den Brüdern in den Joseph-Romanen – keine Versöhnung geben konnte und durfte:
„Nach seinem öffentlichen Bekenntnis zum Exil entwickelt der Autor eine unermüdliche politische Tätigkeit, zwischen 1937 und 1945 entstehen mehr als 300 politische Aufsätze, Essays, Vorträge, Festreden, Grußworte etc. […] Mann […] hält während des Krieges 58 Rundfunkansprachen (Deutsche Hörer! 1940-1945), die von der BBC als Appelle nach Deutschland übertragen werden.“[5]
Der Exilierte präsentiert „[…] im Mai 1945 nach Kriegsende die Rede Deutschland und die Deutschen in der Library of Congress. Darin analysiert er die deutsche Geschichte, die er konsequent auf das Versagen der kulturtragenden Schicht reduziert.“[6] Die vielschichtigen Entwicklungen, die schließlich zum Zweiten Weltkrieg führten, waren multifaktorieller als diese Reduktion; das muss hier nicht extra unterstrichen werden. Dennoch liefert Thomas Manns Analyse einen wichtigen Deutungsrahmen der eigenen Exilsituation, um ein barbarisches Deutschland unter dem Dritten Reich begreifen zu können.[7] Aber auch: das verzweifelt-verzweifelnde Verstehen-Wollen in den Texten von Thomas Mann aus jener Zeit – so mein Leseeindruck –, dieses Ringen und Suchen nach Worten, die zwar variantenreich, letztlich aber doch nur Schweigen und Verstummen umkreisen: in der Rekonstruktion der irrationalen Motive (mit einer gewissen Nähe zu Märchen[8] und zur Romantik; nur „verhunzt“, um ein Wort Thomas Manns zu wählen), welche zu jenen grauenhaften Ereignissen geführt haben mochten. Diese unsägliche Vernichtung von Menschenleben, Städten und Kultur, deren Ausmaß nach 1945 bekannt wurde:
„Es war nicht eine kleine Zahl von Verbrechern, es waren Hunderttausende einer sogenannten deutschen Elite, Männer, Jungen und entmenschte Weiber, die unter dem Einfluß verrückter Lehren in kranker Lust diese Untaten begangen haben. […] Man nenne es finstere Möglichkeiten der Menschennatur überhaupt, die da enthüllt werden – deutsche Menschen, hundertausende sind es nun einmal, die sie vor den Augen der Welt enthüllt haben.“[9]

Sprache und Epos werden diesem Autor imaginäres Refugium für eine große europäische Tradition, werden zu Erinnerungs- und Bewahrungsräumen, sind eine Arche für (emblematisch-exemplarisch) Goethe und Schiller als Repräsentanten einer vom Untergang bedrohten deutschen Welt-Klassik. Und aus den Fluten des Kriegschaos erhebt sich der Kosmos eines lebensbejahenden Gegen-Mythos’:
„Die grundsätzliche Frontstellung gegen die Nazis und ihre Wortführer (etwa Alfred Rosenbergs Mythus des XX. Jahrhunderts) entspricht kulturstrategischen Vorschlägen, wie sie zur gleichen Zeit etwa der marxistische Philosoph Ernst Bloch […] vorgebracht hatte. Ihre besondere Pointe findet jene Konfrontation in den Joseph-Romanen aber darin, dass es die jüdische Urgeschichte ist, die in diesem aufklärerischen Sinne mythisiert und als Urgrund europäischer Kultur, wenn nicht sogar als Grundwerte der Menschheit, freigelegt wird […].“[10]
Und zu diesem Urgrund Europas gehörte, jeden nationalistischen Eurozentrismus transzendierend, neben Israel auch Ägypten.[11] Dazu die mythopoetischen Potentiale der Antike und des Christentums. Das ‚Vorspiel: Höllenfahrt‘[12], gewissermaßen eine hermeneutische Standortvermessung des Erzählers/der vielen Erzähler (?), inszeniert diesen Joseph als nur eine Geschichte aus einer Vielzahl von Josephsgeschichten. Es wird ein Erzählkosmos aufgespannt und entworfen, der geographisch eben keineswegs auf den Alten Orient beschränkt wäre und der noch weiter, viel weiter zurückreicht – via Atlantis – hinab in geradezu geologische Zeitalter. Und ‚Europa‘ als transnationales, humanisierendes Projekt ist tief in komplexen religiösen Konzepten verankert und verwurzelt, vertreten z.B. durch Abraham und Echnaton:
„Die Wirkungsgeschichte hat also die Bibel gemacht – das ist keine Ketzerei, sondern eine philologische Tatsache. Deshalb hat Thomas Mann auch kein Bedenken, an der Bibel weiterzudichten, sie humoristisch zu korrigieren, sie zu modernisieren und in spielerischer Wissenschaftlichkeit ihre Ungenauigkeiten philologisch zu erklären und psychologisch plausibel zu machen.“[13]
Darum spielt dieser universale Roman auch mit der Frage, ob nun Gott existiere oder nicht,[14] ob Gott monistisch-panentheistisch alles umfasse oder nur eine Fiktion Abrahams darstelle, ein Abraham, der, modern gesprochen und aus dem Narrativ abstrahiert, apriorisch die Bedingung der Möglichkeit eines Gottgedankens mit der Vernunft ausmessen möchte – geradezu ein poetischer Kant. Dieser Abraham überschreitet wie Kant ebenfalls die vorläufigen Grenzziehungen der Vernunft in Richtung Ethik, weil eben jener Gott (oder dessen Fingierung bzw. Eruierung) existentielle Folgen für ein sehr konkretes Leben hat.

Jenes imaginiert-utopische Ägypten, das Thomas Mann im Joseph re- und de-konstruiert als Präfiguration einer humanen Zukunft für alle Völker, wird in der realen Historie durch ein kulturvernichtendes Nazi-Deutschland – ja sogar durch die angestrebte systematische Vernichtung des Volkes selbst, das immer noch als Stimme aus der tiefen Vergangenheit (Ägypten ist ja längst untergegangen!) eine Humanisierung des Göttlichen und Menschlichen repräsentiert –, jenes Bildungs- und Kultur-Europa wird durch eine barbarische Ideologie und ihre Vernichtungsmaschinerie in Auflösung gebracht. Dieses andere Europa kann nur im Exil, d.h. im Text überleben, vorerst. Wie sehr wünscht sich Thomas Mann, dass seine Texte politische Folgen haben könnten, vor allem mit Blick auf Roosevelt und auf ein Deutschland, das sich immer noch selbst von diesem Wahnsinn befreien möge! Dem Hauptakteur dieser europäischen Tragödie schreibt Thomas Mann wahrlich keine großartigen Eigenschaften zu: diesem
„[…] tristen Faulpelz, tatsächlichen Nichtskönner und ‚Träumer‘ fünften Ranges, dem blöden Hasser der sozialen Revolution, dem duckmäuserischen Sadisten […]. Ich sprach von europäischer Verhunzung. Und wirklich, unserer Zeit gelang es, so vieles zu verhunzen: Das Nationale, den Sozialismus – den Mythos […].“[15]
Im Kontext des Zusammenbruchs der europäischen Nationalstaaten entsteht aber etwas Neues:
„Das Exil ist etwas ganz anderes geworden, als es in früheren Zeiten war. Es ist kein Wartezustand, den man auf Heimkehr abstellt, sondern spielt schon auf eine Auflösung des Nationalen an und auf die Vereinheitlichung der Welt. Alles Nationale ist schon längst Provinz geworden.“[16]
Das Exil transformiert sich zu einer Präfiguration eines noch ausstehenden, visionären Kosmopolitismus, weil Nation als Referenzrahmen kollabiert ist: „Tief sinkt die nationale Idee, die Idee des ‚engern Raumes‘ ins Gestrige ab. Von ihr aus, jeder fühlt es, ist kein Problem, kein politisches, ökonomisches, geistiges mehr zu lösen.“[17] Für Deutschland selbst sieht Thomas Mann folgende Alternativen: „Aus ‚Deutsch-Europa‘ ist nichts geworden und durfte nichts werden. Aber das deutsche Empfinden muss europäisch sein, damit Europa werde.“[18] Und fast schon visionär:
„Uns ist nicht bange, daß die wirkende Zeit nicht ein geeintes Europa bringen wird mit einem wiedervereinigten Deutschland in seiner Mitte […]: ein Deutschland als selbstbewusst dienendes Glied eines in Selbstbewusstsein geeinten Europa, – nicht etwa als sein Herr und Meister.“[19]
Das folgende Zitat regt zur Frage an, wer denn nun wirklich emigriert sei. Da gibt es zum einen den amerikanischen Thomas Mann und zum anderen den deutschen Schriftsteller: der eine an einem konkreten Ort, der andere ort-los (u-topisch), aber in einem Universum der Sprache, seiner Sprache beheimatet, die er vorfindet, die er weiterbildet:
„Nie ist es mir in den Sinn gekommen, auch als Schriftsteller zu emigrieren und etwa, wie mancher es von mir erwartete, ja forderte, eine Arbeit gleich auf englisch herzustellen, da es ein deutsches Publikum für sie ja nicht gab. […] Im Gegenteil wurde mir in der Fremde […] mein Tun gerade in diesen Jahren mehr und mehr zum bewußten Sprachwerk, zur versuchenden Lust, alle Register des herrlichen Orgelwerks unserer Sprache zu ziehen, zu einem Bestreben nach Rekapitulation zugleich und Vorwärtstreibung deutscher Sprachzustände und Ausdrucksmöglichkeiten deutscher Prosa.“[20]

Dies klingt wie die Stimme aus dem Gedicht „Mein Eigentum“ eines anderen Heimatlosen, eine Stimme, die, bedroht durch das kontingente Phänomen des Wandels, für sich in der dichterische Fiktion – Buchstabe, Strophe, Metrik und Vers sind Zeugnisse, Spuren dieser Incarmination[21] – eine „bleibende Stätte“, etwas Unbedingtes zu finden sucht, es auch gefunden hat, einen Sprach-Ort durchaus mit Zügen des Paradieses, der Zeitlosigkeit, des Absoluten (des Los-Gelösten). Solch eine imaginierte Utopie kann sich in einem konkreten Gedicht realisieren – eine Spur: als Trost, als Rettung, als Sicherheit. Was dem Dichter gehört, das hören wir, auch wenn wir es nur still lesen:
Aus „Mein Eigentum“ von F. Hölderlin:
„Und daß mir auch, zu retten mein sterblich Herz,
Wie andern eine bleibende Stätte sei,
Und heimatlos die Seele mir nicht
Über das Leben hinweg sich sehne,
Sei du, Gesang, mein freundlich Asyl! sei du
Beglückender! mit sorgender Liebe mir
Gepflegt, der Garten, wo ich, wandelnd
Unter den Blüten, den immerjungen
In sichrer Einfalt wohne, wenn draußen mir
Mit ihren Wellen allen die mächtge Zeit
Die Wandelbare fern rauscht und die
Stillere Sonne mein Wirken fördert.“[22]
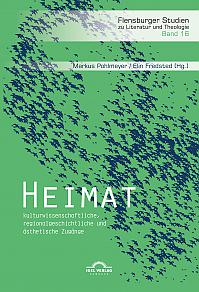
(Dieser Aufsatz ist die veränderte Fassung von: Markus Pohlmeyer: Scrivere nuovi mondi. T. Mann in esilio: la domanda su chi è l’emigrato e il seno della patria, in: Il Regno – Attualità 8/2018, 219-221. Mit freundlicher Genehmigung von ‚Il Regno‘ zur Verwendung in dem vorliegenden Buch.)
Mit freundlicher Genehmigung des Verlages entnommen aus:
Heimat: kulturwissenschaftliche, regionalgeschichtliche und ästhetische Zugänge, hg. v. Elin Fredsted und Markus Pohlmeyer, Flensburger Studien zu Literatur und Theologie Band 16, Igel Verlag, Hamburg 2019, S. 133-140.
CulturMag-Rezension dazu hier (etwas scrollen).
Markus Pohlmeyers Essays bei CulturMag. Dies ist sein 80. Beitrag. Bravo!
[1] „Der Exodus von weit über 2000 im weiteren Sinn literarisch Tätigen aus Deutschland, darunter die meisten international renommierten Autoren, beginnt mit den Verfolgungen nach dem Reichstagsbrand (27.2.1933). Das Exil versetzt die geflohenen Schriftsteller in eine zwiespältige Situation. Einerseits macht ihnen der Verlust des Publikums und vor allem der eigentlichen sprachlichen Lebenswelt zu schaffen, den Döblin einer ‚Amputation‘ gleichsetzt. Andererseits verstehen sie das Exil als einen politisch-literarischen Auftrag, den sie jedoch unterschiedlich interpretieren.“ B. Spies: Exilliteratur, in: Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, hg. v. K. Weimar, Bd. I, Berlin 2007, 537-541, hier 538. Vgl. dazu die Situation von Thomas Mann: „Tatsächlich trennte ihn einiges von der Emigration. Er war nie arm – der Nobelpreis von 1929 war zum Teil im Ausland angelegt worden. Er hatte im Gegensatz zu den meisten anderen deutschen Emigranten ein internationales Publikum, das ihm auch dann noch Honorare einbrachte, als ihm die deutschen Publikationsmedien verlorengegangen waren […].“ H. Kurzke: Thomas Mann. Epoche – Werk – Wirkung, 4. Aufl., München 2010, 36.
[2] Siehe dazu Markus Pohlmeyer: „Er war nicht das Gute, sondern das Ganze.“ – Transtextuelle Lektüre von Thomas Manns Joseph-Roman, in: Literatur in Wissenschaft und Unterricht XLVI·1·2013 (erschienen 2015), 23-31.
[3] Dies ist einer der zentralen Forschungsschwerpunkte des Centro Studi Sara Valesio in Bologna, dessen Mitglied der Autor ist.
[4] J. Schöll: Joseph im Exil. Zur Identitätskonstruktion in Thomas Manns Exil-Tagebüchern und -Briefen sowie im Roman Joseph und seine Brüder, Würzburg 2004, 343.
[5] J. Schöll: Exil, in: Thomas Mann. Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, hg. v. A. Blödorn – F. Marx, Stuttgart 2015, 243-244, hier 243. Vgl. dazu auch H. Kurzke: Bewundern, nicht kritisieren. Thomas Mann und die Politik, in: Der Kanon. Die deutsche Literatur. Bd. 5: Essays. Max Frisch bis Durs Grünbein, Frankfurt am Main – Leipzig 2006, 824-834.
[6] T. Lörke: Deutschland, in: Thomas Mann. Handbuch. Leben – Werk – Wirkung, hg. v. A. Blödorn – F. Marx, Stuttgart 2015, 241- 242, hier 241 f.
[7] Siehe dazu auch beispielsweise zur Situation der deutschen Universitäten im Dritten Reich H.-M. Koch: Die Universität. Geschichte einer Institution, Darmstadt 2008, 200-210. (Mit Einblick u.a. in die ‚causa‘ Heidegger.)
[8] Siehe dazu auch M. Maar: Geister und Kunst. Neuigkeiten aus dem Zauberberg, München – Wien 1995.
[9] Thomas Mann: Die deutschen KZ (1945), in: Thomas Mann: Fragile Republik. Thomas Mann und Nachkriegsdeutschland, hg. v. S. Stachorski, Frankfurt am Main 1999, 21.
[10] H. Ridley – J. Vogt: Thomas Mann, Paderborn 2009, 61.
[11] Siehe dazu: Markus Pohlmeyer: Die Huld(a) auf dem Felde oder: Ein arroganter Engel, ein irrender Held und ein impliziter Esel. Gedanken – weitab vom Wege – zu Thomas Manns Joseph und seine Brüder, in: M. Pohlmeyer: Zwischen Welten verstrickt IV. Weltraum, Wildwest und allerlei wunderliche Wege, Hamburg 2017, 81-90. Und Ders.: Narrare è creare. Come Echnaton e Thomas Mann inventarono Dio, in Il Regno, 16/2106, 475-478.
[12] Siehe dazu Th. Mann: Joseph und seine Brüder, Frankfurt am Main 2007.
[13] H. Kurzke: Der gläubige Thomas. Glaube und Sprache bei Thomas Mann, in: Schriften des Ortsvereins Bonn-Köln der Deutschen Thomas Mann-Gesellschaft e.V., Bd. 1, Bonn 2009, 14.
[14] Vgl. dazu Kurzke: Thomas (s. Anm. 13), 7. Siehe dazu auch Thomas Mann: Joseph und seine Brüder I, Kommentar, hg. v. J. Assmann – D. Borchmeyer – S. Stachorski, unter Mitwirkung v. P. Huber, Frankfurt am Main 2018, 805 ff.
[15] Thomas Mann: Bruder Hitler (1939), in: Ders.: Politische Schriften und Reden 3, hg. v. H. Bürgin, Frankfurt am Main – Hamburg 1968, 58.
[16] Thomas Mann: ‚Man gönne mir mein Weltdeutschtum‘, in: Fragile Republik (s. Anm. 9), 42. Schriftbild von mir geändert.
[17] Thomas Mann: aus einem Schiller-Vortrag 1955, in: Fragile Republik (s. Anm. 9), 237.
[18] Thomas Mann: [Die Aufgabe des Schriftstellers] (1947) , in: Ders.: Schriften (s. Anm. 15), 306.
[19] Thomas Mann: [Ansprache vor Hamburger Studenten] (1953) , in: Ders.: Schriften (s. Anm. 15) 359.
[20] Thomas Mann: Ansprache im Goethe-Jahr (1949), in: Fragile Republik (s. Anm. 9), 78.
[21] Vgl. dazu den latein. Plural: carmina (Lieder, Gedichte).
[22] F. Hölderlin: (aus) Mein Eigentum, in: Ders.: Gedichte, hg. G. Kurz, Stuttgart 2000, 187.











