 Einen Scharfschützen zum Leben zu erwecken
Einen Scharfschützen zum Leben zu erwecken
Stephen Hunter über seine Lieblingsfigur.
Übersetzt von Susanna Mende
Bob Lee Swagger ist mir zum ersten Mal irgendwann neunzehnhundertneunzig, vielleicht auch einundneunzig, begegnet. Wenn ich mich richtig erinnere, saß ich am Küchentisch und spielte Plotideen durch, genauer gesagt, zwei Plotideen, von denen im Grunde nur eine von mir stammte. Das zweite Buch eines Vertrags über zwei Titel für Bantam war fällig, und es fehlte an Ideen – Schriftsteller wissen bestimmt, wovon ich rede.
 Es war Abend; die junge Familie (ich muss wohl auch jung gewesen sein) schlief. Bob tauchte allerdings nicht plötzlich auf. Ich hörte keine Stimme, sah kein Gesicht, las keine Körpersprache. Nur kam in beiden Plots jemand vor, der ein wenig Ahnung davon hatte, wie man ein Gewehr abfeuert, und der mit ansehen konnte, wie jemand zu Boden geht.
Es war Abend; die junge Familie (ich muss wohl auch jung gewesen sein) schlief. Bob tauchte allerdings nicht plötzlich auf. Ich hörte keine Stimme, sah kein Gesicht, las keine Körpersprache. Nur kam in beiden Plots jemand vor, der ein wenig Ahnung davon hatte, wie man ein Gewehr abfeuert, und der mit ansehen konnte, wie jemand zu Boden geht.
Der erste Plot war – eiskalt und heimtückisch – aus einem Buch mit dem Titel Death of a Thin-Skinned Animal gestohlen, das ich nie gelesen habe, weil ich sonst mehr als diese Prämisse gestohlen hätte. Irgendein Brite hatte es geschrieben, und die Prämisse war brillant – eigenständig, überzeugend, voller interessanter Dinge wie Vergeltung und echter Gewalt. Ein britischer Scharfschütze bei der Armee erhält den Auftrag, in Afrika einen besonders schlimmen und widerwärtigen Diktator auszuschalten. Nach seiner Entsendung strebt Whitehall auf einmal eine Einigung mit dem schlimmen Diktator an. Weil nichts unternommen werden kann, um den Scharfschützen zurückzuholen, wird er verraten. Er wird gefangen genommen und verschwindet in dem kleinen, brutalen Gefängnissystem des Diktators, wo ihm bis zur Hinrichtung wahrscheinlich eine schreckliche Behandlung zuteil wird. Realpolitik eben.
 Fünf Jahre später kommt der Diktator, inzwischen ein stolzer britischer Verbündeter, zu einem Staatsbesuch nach London. Eines Abends erreicht eine fünf Jahre alte, codierte Nachricht das Hauptquartier des britischen Geheimdienstes. Nach der Dechiffrierung stellt sich heraus, dass sie von dem verratenen Scharfschützen stammt. Ich werde meinen Auftrag ausführen, teilt er mit. Was zu Komplikationen führt.
Fünf Jahre später kommt der Diktator, inzwischen ein stolzer britischer Verbündeter, zu einem Staatsbesuch nach London. Eines Abends erreicht eine fünf Jahre alte, codierte Nachricht das Hauptquartier des britischen Geheimdienstes. Nach der Dechiffrierung stellt sich heraus, dass sie von dem verratenen Scharfschützen stammt. Ich werde meinen Auftrag ausführen, teilt er mit. Was zu Komplikationen führt.
Ich verlegte die Geschichte in die USA, nach Washington, mit einem alten Vietnam-Sniper, in der Wolle gefärbter Marinesoldat, ein leichtes Opfer. Ich sah es genau vor mir: ein unwilliger Kollege wird dazu verdonnert, ihn aus dem Verkehr zu ziehen, doch der Ältere ist jedesmal schlauer, schneller und einfallsreicher. Tatsächlich ist die Geschichte so gut, dass ich sie machen möchte, nur dass der ältere Bob der Verfolger und nicht der Schütze ist. Der ist ein junger Mann nach drei Einsätzen im Irak, zwei davon bei den Marines und einer für einen privaten Auftraggeber. Diesmal besitze ich hoffentlich die moralische Stärke, eine Beteiligung für den gestohlenen Geniestreich zu offerieren.
 Der andere Plot, über den ich nachdachte, war vager, doch wenigstens war es mein eigener. Er war inspiriert von einer neuen Theorie über die Kennedy-Ermordung, die im Baltimore Sun Magazin veröffentlicht worden war, von einem erfahrenen Reporter namens Ralph Reppert. Wie so viele dieser Theorien war auch diese falsch, doch der Artikel hatte ein eindringliches Bild vermittelt. Ein Schütze steht auf einer Plattform in einer trostlosen, verlassenen Gegend (wie es Repperts Protagonisten im H.B. White Ballistics Laboratory in Maryland geschehen war). In seinem Sichtfeld, in einer bestimmten Distanz und einem bestimmten Winkel, befindet sich ein Cabrio, das mit einer vorgegebenen Geschwindigkeit fährt. Auf dem Rücksitz sind vier Dummies arrangiert, die menschliche Ziele darstellen sollen. Er muss in sechs Komma drei Sekunden drei Schüsse abfeuern und das Ziel rechts am Hinterkopf treffen. Natürlich wusste Repperts Protagonist, dass er Lee Harvey Oswald nachstellte, doch meine Fantasie löste sich von der Vorstellung, dass der Schütze dazu überredet worden war, auf den Turm zu klettern, und allein wegen des Winkels und der Geschwindigkeit und der Schussproblematik, vor der er stand, wurde ihm klar, dass er für die Rolle von Oswald ausgesucht worden war.
Der andere Plot, über den ich nachdachte, war vager, doch wenigstens war es mein eigener. Er war inspiriert von einer neuen Theorie über die Kennedy-Ermordung, die im Baltimore Sun Magazin veröffentlicht worden war, von einem erfahrenen Reporter namens Ralph Reppert. Wie so viele dieser Theorien war auch diese falsch, doch der Artikel hatte ein eindringliches Bild vermittelt. Ein Schütze steht auf einer Plattform in einer trostlosen, verlassenen Gegend (wie es Repperts Protagonisten im H.B. White Ballistics Laboratory in Maryland geschehen war). In seinem Sichtfeld, in einer bestimmten Distanz und einem bestimmten Winkel, befindet sich ein Cabrio, das mit einer vorgegebenen Geschwindigkeit fährt. Auf dem Rücksitz sind vier Dummies arrangiert, die menschliche Ziele darstellen sollen. Er muss in sechs Komma drei Sekunden drei Schüsse abfeuern und das Ziel rechts am Hinterkopf treffen. Natürlich wusste Repperts Protagonist, dass er Lee Harvey Oswald nachstellte, doch meine Fantasie löste sich von der Vorstellung, dass der Schütze dazu überredet worden war, auf den Turm zu klettern, und allein wegen des Winkels und der Geschwindigkeit und der Schussproblematik, vor der er stand, wurde ihm klar, dass er für die Rolle von Oswald ausgesucht worden war.
Schließlich entschied ich mich für diese Variante, wenn auch nur, weil es meine Idee war. Ich fing an zu tippen, und jedes Mal, wenn ich feststeckte, dachte ich mir eine Schießerei oder einen neuen, wichtigen Charakter aus. Ich hatte keine Ahnung, dass das mein Leben vollkommen verändern würde, und ein paar Jahre lang sah es so aus, als wäre es der Fehler meines Lebens gewesen.
 Im Fadenkreuz der Angst war ein schwieriger Stoff – so viele Kuckucke waren zu verstecken, und sie mussten genau zum richtigen Zeitpunkt in Erscheinung treten. Das Buch wurde immer schlechter. Ich schrieb eine Sequenz von zweihundert Seiten, die in den Bayous von Lousiana spielte, und mir wurde klar, dass sie völlig losgelöst von allem war. Ich warf sie raus. Weg damit. Weil ich von Geburt faul bin, war es extrem niederschmetternd, so viel Arbeit im Papierkorb landen zu sehen. Ich weiß nicht, wie ich auf Nick Memphis kam; er stand in keinem Entwurf und auf keinem Notizzettel, bevor er im Buch auftauchte. Ich weiß nicht einmal, woher der Name kommt, und ich habe keine Ahnung, wo sich der Name „Memphis“ herleiten ließ. Ist er Ägypter oder ein Bewohner Tennessees? Ich weiß es nicht. Er tauchte einfach an einem besonders quälerischen Abend auf, drängte sich ins Buch und wollte nicht mehr verschwinden. Was auch sein Gutes hatte.
Im Fadenkreuz der Angst war ein schwieriger Stoff – so viele Kuckucke waren zu verstecken, und sie mussten genau zum richtigen Zeitpunkt in Erscheinung treten. Das Buch wurde immer schlechter. Ich schrieb eine Sequenz von zweihundert Seiten, die in den Bayous von Lousiana spielte, und mir wurde klar, dass sie völlig losgelöst von allem war. Ich warf sie raus. Weg damit. Weil ich von Geburt faul bin, war es extrem niederschmetternd, so viel Arbeit im Papierkorb landen zu sehen. Ich weiß nicht, wie ich auf Nick Memphis kam; er stand in keinem Entwurf und auf keinem Notizzettel, bevor er im Buch auftauchte. Ich weiß nicht einmal, woher der Name kommt, und ich habe keine Ahnung, wo sich der Name „Memphis“ herleiten ließ. Ist er Ägypter oder ein Bewohner Tennessees? Ich weiß es nicht. Er tauchte einfach an einem besonders quälerischen Abend auf, drängte sich ins Buch und wollte nicht mehr verschwinden. Was auch sein Gutes hatte.
Die Lektorin des Romans, ein echter Profi bei Bantam namens Ann Harris, beichtete mir später, dass sie von den ersten hundert Seiten oder so nicht besonders beeindruckt gewesen sei, bis schließlich Nick auftauchte. Dann erst, bemerkte sie, habe die Handlung Fahrt aufgenommen, sei zielgerichteter geworden, prägnanter im Stil. Überall wo Nick auftauchte, funktionierte das Buch; überall wo er nicht auftauchte, nicht, ZZZZZZZ.
Und ich weiß, weshalb ZZZZZZZ die passende Antwort war. Es war allein Bob Lee Swaggers Fehler.
Bob Lee kam irgendwie von Charles Hendersons Roman Marine Sniper herbeigeweht, der die Geschichte des herausragenden Marine-Scharfschützen Carlos Hathcock erzählt. Hendersons Buch ist natürlich gut und fesselnd geschrieben, doch es ist mehr als das; es vermittelt irgendwie die psychologische Last – man könnte auch spirituelle Last sagen -, die ein Scharfschütze mit sich 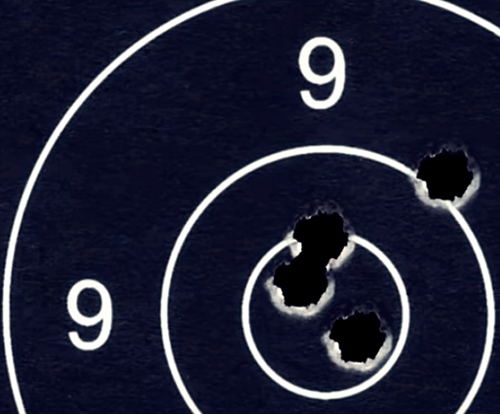 herumträgt. Schließlich ist er nicht der designierte Schütze, sondern der designierte Killer. Er ist es, der durch ein zehnfaches Vergrößerungsglas den Einschlag von 168 Metallsplittern sieht, die null Komma sechs Kilometer pro Sekunde schnell sind; das kleine Loch, das das Geschoss beim Eindringen schlägt, und den Dammbruch, den es auslöst, wenn es wieder austritt, gefolgt von einem langsamen, uneleganten Sturz. Ich war fasziniert von diesem Vorgang, und gleichzeitig graute mir davor, doch am meisten graute mir davor, dass ich davon fasziniert war.
herumträgt. Schließlich ist er nicht der designierte Schütze, sondern der designierte Killer. Er ist es, der durch ein zehnfaches Vergrößerungsglas den Einschlag von 168 Metallsplittern sieht, die null Komma sechs Kilometer pro Sekunde schnell sind; das kleine Loch, das das Geschoss beim Eindringen schlägt, und den Dammbruch, den es auslöst, wenn es wieder austritt, gefolgt von einem langsamen, uneleganten Sturz. Ich war fasziniert von diesem Vorgang, und gleichzeitig graute mir davor, doch am meisten graute mir davor, dass ich davon fasziniert war.
Die Fakten über Carlos Hathcock waren simpel:
Offiziersanwärter bei den Marines aus Arkansas, zwei Einsätze in Vietnam, den ersten als MP. Erst beim zweiten Einsatz, nachdem er den Wimbledon-Cup gewonnen hatte (das ist ein nationaler Schießwettkampf über eine Entfernung von etwas über 900 Metern), wurde er Scharfschütze und bracht es auf neunhundertdreizehn Tötungen. Er wurde als der führende Scharfschütze in Vietnam bekannt (viel später erst stellte sich heraus, dass er das nicht war); laut Henderson führte er auch ein paar Sondereinsätze durch, wie zum Beispiel einen Vietkong-General zu beseitigen, und einmal eine ganze Vietkong-Einheit in einen Hinterhalt zu führen und jeden einzelnen zu töten, beides brillante Waffentaten. Doch wurde er während seiner Menschenjagd zweimal schwer verwundet. Das erste Mal war psychologisch: Er verlor einen seiner talentiertesten Spotter, einen jungen Mann namens Johnny Burke. Dann erlitt er selbst schwere Verbrennungen, als der Wagen, in dem er saß, auf eine Mine fuhr. Heroisch half er dabei, Männer aus dem zertrümmerten und lodernden Ding zu retten, obwohl er selbst verwundet war. Später – wieso eigentlich später? Aber das ist eine andere Geschichte – wurde ihm dafür ein Silver Star verliehen.
 Da war also Bobby Lee: aus Arkansas, Offiziersanwärter bei den Marines, ein ausgesprochen mutiger und tüchtiger Scharfschütze mit ein paar Heldentaten, die zur Legende wurden, dann schwer verwundet an Seele – der Verlust seines Spotters – und Körper – die Verbrennungen. Ich sah ihn in einem düsteren Exil, allein und unnahbar, ein trockener Alkoholiker, und ich wusste, das die emotionale Entwicklung des Romans seine Rückkehr in die Gesellschaft sein würde, seine Entdeckung der Liebe, sein Engagement, seine Erkenntnis, dass es noch immer Dinge gab, für die es sich zu kämpfen lohnte. All das stand im ersten, zusammengeschusterten Entwurf.
Da war also Bobby Lee: aus Arkansas, Offiziersanwärter bei den Marines, ein ausgesprochen mutiger und tüchtiger Scharfschütze mit ein paar Heldentaten, die zur Legende wurden, dann schwer verwundet an Seele – der Verlust seines Spotters – und Körper – die Verbrennungen. Ich sah ihn in einem düsteren Exil, allein und unnahbar, ein trockener Alkoholiker, und ich wusste, das die emotionale Entwicklung des Romans seine Rückkehr in die Gesellschaft sein würde, seine Entdeckung der Liebe, sein Engagement, seine Erkenntnis, dass es noch immer Dinge gab, für die es sich zu kämpfen lohnte. All das stand im ersten, zusammengeschusterten Entwurf.
Und es war furchtbar.
Bob war einfach nicht lebendig.
Das Problem, wurde mir schließlich klar, hatte mit dem zu tun, was Künstler die „living line“ im Gegensatz zur „dead line“ nennen. Eine „dead line“ ist eine Art Vorzeichnung. Sie liefert einen brauchbaren Umriss einer Sache, der jedoch nicht der Vorstellungskraft des Künstlers bedarf. Er ist nicht spontan oder überraschend. Er ist einfach nur stumm vorhanden; das ist alles. Und genau das hatte ich, eine grobe Skizze von Carlos Hathcock, mühsam aus ausufernden tausend Seiten Manuskript zusammengetragen. (Ich erspare Ihnen die Details meiner handwerklichen Strapazen und meines Unglücks mit der Disk, die ich in Gelee tauchte, als ich mich durch mein erstes, auf dem Computer verfasstes Buch kämpfte). Die Eckdaten von Bobby Lee entsprachen denen von Carlos, doch er war so kalt und langweilig wie ein Stein.
 Die Leute sagten zu mir: „Bob Lee Swagger? Carlos Hathcock, stimmt’s?“ Nun, ja und nein. Als Schlüssel zu Bob Lee Swagger erwiesen sich nicht die Bereiche, die eine Schnittmenge mit Carlos Hancock bildeten, sondern diejenigen, die sich nicht trafen. Indem ich mich von Carlos Hathcock löste, entstand das eigenständige Portrait eines komplexen Wesens, das es wert und dazu in der Lage war, einer durchdachten Erzählung standzuhalten.
Die Leute sagten zu mir: „Bob Lee Swagger? Carlos Hathcock, stimmt’s?“ Nun, ja und nein. Als Schlüssel zu Bob Lee Swagger erwiesen sich nicht die Bereiche, die eine Schnittmenge mit Carlos Hancock bildeten, sondern diejenigen, die sich nicht trafen. Indem ich mich von Carlos Hathcock löste, entstand das eigenständige Portrait eines komplexen Wesens, das es wert und dazu in der Lage war, einer durchdachten Erzählung standzuhalten.
Es entstand eine Figur, die Carlos Hathcock wahrscheinlich nicht erkannt hätte. Ich sah ihn als eine Art faustischen Intellektuellen des Krieges. Er hatte Dinge gesehen und getan und erfahren wie vor ihm noch kein Mensch. Doch er zahlte einen hohen Preis dafür: Sein Rückzug aus der Gesellschaft, seine erstarrte Seele. Ich gab ihm die Gelegenheit, diesen inneren Aufruhr nach außen zu tragen; ich machte aus ihm einen trockenen Alkoholiker, und seine Trunkenheit (ich kenne mich ein wenig aus damit) war nicht von der fröhlichen, charmanten Sorte voller Bonmots und Trinksprüche und sprühendem Geist; nein, sie war dunkel, mürrisch, gewalttätig, selbstzerfleischend, vielleicht sogar tödlich. Und sein größter Sieg war nicht der über die Nordvietnamesen (ich gab ihm eine Trefferzahl von siebenundachtzig, denn ich wollte ihn nicht „besser“ machen als Carlos), sondern der über sich selbst, indem er das Trinken aufgab.

Ich wollte auch, dass er verarbeitet hatte, was ihm widerfahren war, dass er intensiv darüber nachgedacht hatte, versucht hatte, darin irgendeinen Sinn zu erkennen. Im Wesentlichen ließ ich ihn durch eifrige Lektüre sich selbst neu erfinden. In seinem Trailer draußen in Ouachitas begann er Bücher über Vietnam zu lesen und machte weiter mit Lektüre über den Krieg im Allgemeinen, fraß sich durch Homers Ilias und Thukydides’ Der Peloponnesische Krieg, bis hin zu Hemingway, Mailer und anderen Autoren unserer Zeit. Er hungerte nach Kontext, und er rettete sich damit vor den selbstzerstörerischen Impulsen aus dem dunklen Teil seiner Seele, indem er die Reflexionen und Erfahrungen anderer Krieger zwischen sich und die schwarzen Hunde der Depression, des Selbstzweifels und der Wut und Einsamkeit stellte.
Dann war da noch Arkansas. Ich wusste nichts darüber, absolut gar nichts, außer dass ein Politiker von dort unten versuchte, Präsident zu werden. Ich hatte noch nie von ihm und kaum von dem Bundesstaat gehört.
 Ich habe Swagger in der Gegend um Berryville platziert, im nordöstlichen Arkansas, nicht weit von Branson in Missouri und den Ozarks. Ich entschied mich für Berryville, weil ich über Arkansas als Einziges wusste, dass ein Waffenschmied namens Bill Wilson auf Wunsch seiner Kunden einen Waffenladen dort eröffnet hatte, was Barryville in gewisser Weise zur Hauptstadt der Waffenkultur machte. Also bin ich runtergefahren, und noch nie ist ein Mensch mit romantischeren Vorstellungen nach Arkansas aufgebrochen. Doch ich muss sagen, ich war enttäuscht, als ich dort ankam. Berryville war in Ordnung, doch es lag inmitten von etwas, das schlimmer war als das Nirgendwo: es war das Irgendwo. Dieses Irgendwo wurde „country
Ich habe Swagger in der Gegend um Berryville platziert, im nordöstlichen Arkansas, nicht weit von Branson in Missouri und den Ozarks. Ich entschied mich für Berryville, weil ich über Arkansas als Einziges wusste, dass ein Waffenschmied namens Bill Wilson auf Wunsch seiner Kunden einen Waffenladen dort eröffnet hatte, was Barryville in gewisser Weise zur Hauptstadt der Waffenkultur machte. Also bin ich runtergefahren, und noch nie ist ein Mensch mit romantischeren Vorstellungen nach Arkansas aufgebrochen. Doch ich muss sagen, ich war enttäuscht, als ich dort ankam. Berryville war in Ordnung, doch es lag inmitten von etwas, das schlimmer war als das Nirgendwo: es war das Irgendwo. Dieses Irgendwo wurde „country  musicville“ genannt. Es war laut und volkstümlich; das Arkansas, das ich kennenlernte, war banalisiert und gefühlsduselig und, was am schlimmsten war, idyllisch und hübsch. Ich konnte darin nicht den Geburtsort eines Kriegers erkennen.
musicville“ genannt. Es war laut und volkstümlich; das Arkansas, das ich kennenlernte, war banalisiert und gefühlsduselig und, was am schlimmsten war, idyllisch und hübsch. Ich konnte darin nicht den Geburtsort eines Kriegers erkennen.
Niedergeschlagen fuhr ich die 71 entlang. Mein Ziel war Dallas, wo ich ein paar Recherchen in Sachen JFK anstellen wollte, weil zu diesem Zeitpunkt die Ermordung von JFK Teil des Romans war. Plötzlich und völlig unerwartet kam ich in die Ouachitas, eine beeindruckende Berglandschaft, die sich von Osten nach Westen durch Polk County und Oklahoma zieht. Ich wusste nicht, dass Charles Portis in diesen Bergen seinen großartigen Roman True Grit angesiedelt hatte, doch hier war endlich die Landschaft, die zu meinem Mann passte.
An dieser Stelle möchte ich noch auf zwei andere Elemente hinweisen.
So diskret wie möglich sollte ich erwähnen, dass ich auf der Fahrt nicht allein war. Ich war mit einer Frau unterwegs, die später meine Ehefrau werden sollte, und das Thema, dass ein Mann durch die Liebe einer guten Frau aus seiner Enttäuschung und Einsamkeit und Verzweiflung befreit wird, war etwas, das ich wirklich empfand, und das mir mit einer Hoffnung und Lebensfreude erfüllte, von denen ich nicht mehr zu träumen gewagt hatte. Ich versuchte auch das in dem Buch unterzubringen, in der Beziehung zwischen Bob und seiner Retterin Julie.
Ich lasse das, ein wenig verlegen, einfach mal so stehen und wende mich einer anderen Liebe zu: den Gewehren. Ich wollte, dass das ein Buch der Gewehre wird. Ich war – wie die Leser bestimmt bereits wissen – ein Waffennarr. Oder gefällt Ihnen Waffenfan, Waffenliebhaber, Waffenverrückter besser? Mr. Saturday Nicht Special oder so ähnlich. Nun, nennen Sie es, wie Sie wollen, doch die Wahrheit ist, ein Waffe war immer, ausnahmslos, die beste Anregung für meine Fantasie. Ich weiß sogar noch, wann es begann. Es muss neunzehnhundertvierundfünfzig gewesen sein; ich war unerlaubterweise noch wach, um Dragnet zu schauen. Mein Vater war unterwegs, um in trunkenem Zustand zweifellos etwas Dummes und Schändliches zu tun. Meine Mutter war aufgebracht und bedauerte sich selbst, und ich sah Joe Friday und Ben Smith dabei zu, wie sie einen Killer im San Fernando Valley jagten. Vielleicht war es  auch woanders; ich weiß es nicht: irgendein Reihenhaus in einer trostlosen, abgelegenen Vorstadt von LA. Doch ich erinnere mich noch daran, wie Joe und Ben den Verdächtigen aufstöberten und Ben auf Joes Anweisung hin beim Polizeirevier Meldung macht. Joe sagte zu Ben: „Und sag ihnen, sie sollen genug 45er-Patronen für die Maschinengewehre mitbringen. Wie’s aussieht, will er bis zum bitteren Ende kämpfen.“
auch woanders; ich weiß es nicht: irgendein Reihenhaus in einer trostlosen, abgelegenen Vorstadt von LA. Doch ich erinnere mich noch daran, wie Joe und Ben den Verdächtigen aufstöberten und Ben auf Joes Anweisung hin beim Polizeirevier Meldung macht. Joe sagte zu Ben: „Und sag ihnen, sie sollen genug 45er-Patronen für die Maschinengewehre mitbringen. Wie’s aussieht, will er bis zum bitteren Ende kämpfen.“
Er wollte bis zum bitteren Ende kämpfen. Er kam mit Funken sprühenden Pistolen aus dem Haus, wo er auf Sergeant Friday traf, diese Ikone der Rechtschaffenheit der fünfziger Jahre, mit seiner Thompson Maschinenpistole, und Joe verteidigte die Zivilisation, als er dem Kerl das Licht ausblies. Jedenfalls setzte ich mich am nächsten Tag mit Papier und Bleistift hin, hängte mich rein und hatte in einer Stunde einen annehmbaren Umriss einer Thompson Maschinenpistole vom Kaliber 50 gezeichnet, wie ich sie betitelte, und sie so größer machte als die von Joe. An diesem Punkt wurden Waffen zu einem Teil meiner Vorstellungskraft, und ich fing an über sie zu lesen, sie im Fernsehen und in Filmen bewusst wahrzunehmen, von ihnen zu träumen – und sie zu zeichnen. Sämtliche Schulbücher, die ich hatte, waren mit detaillierten Seitenansichten vollgezeichnet, die genau beschriftet waren: „Thompson Maschinengewehr M-1928, Kaliber 45“ oder „M-1 Karabiner’ oder „45er Automatik“.
 Auffällig oft wählte ich Zündplättchenpistolen, die in ihrer Darstellung akkurat waren, wenn ich allerdings eine fand, deren Modell ich nicht erkannte, suchte ich so lange danach, bis ich es gefunden hatte. Neunzehnhundertsechsundfünfzig wurde ich im Alter von zehn Jahren Abonnent des Magazins Guns und verschlang jede Ausgabe.
Auffällig oft wählte ich Zündplättchenpistolen, die in ihrer Darstellung akkurat waren, wenn ich allerdings eine fand, deren Modell ich nicht erkannte, suchte ich so lange danach, bis ich es gefunden hatte. Neunzehnhundertsechsundfünfzig wurde ich im Alter von zehn Jahren Abonnent des Magazins Guns und verschlang jede Ausgabe.
Heutzutage würde mir ein solches Verhalten meine tägliche Ritalindosis (oder etwas Stärkeres), eine Langzeitbehandlung beim Seelenklempner und einen Eintrag in der Watchlist der Schulbehörde einbringen, doch damals hielt es niemand für seltsam, und ich muss sagen: es hat einfach Spaß gemacht. Gott, es war eine Freude, wenn ich mich in den Bögen und Streben und Schrauben der verschiedenen Modelle verlieren und mir über die raffinierten Entwürfe den Kopf zerbrechen konnte. Es war wirklich skurril. Mit der Zeit wurde ich ein ganz passabler Zeichner von Feuerwaffen aus der Neunzig-Grad-Perspektive, und manchmal habe ich sie sogar um fünfundvierzig Grad gekippt, um Gewicht und Solidität zu suggerieren. Ich konnte alles zeichnen, bis auf einen Colt Peacemaker – was bis heute gilt. Aus irgendeinem Grund erschloss sich mir das Genie von Colonel Colt nicht: Ich schaffte es einfach nicht, die Nuancen der Bögen einzufangen, der subtilen Unterschiede zwischen dem Schwung des Knaufs, des Verschlussgehäuses und des Abzugbügels.
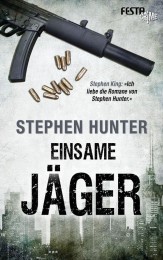 Davon abgesehen blieb mir die Liebe zu den Waffen erhalten, bis auf ein kurze, wahnhafte Phase in den frühen Siebzigern, in der ich mich selbst als Liberalen bezeichnete und glaubte, einer Waffenkultur überlegen zu sein. Doch sie lockte mich immer wieder, und tief in meinem Innern wusste ich, dass es meine wahre Leidenschaft und eins der Dinge war, die mich vom schreiben wollen zum tatsächlichen Schreiben animieren würde, und der tiefere Sinn von Waffen meiner Vorstellungskraft den stärksten Ausdruck verleihen würde. Trotzdem habe ich nie viel geschossen und auch erst vor ein paar Jahren eine Waffe gekauft, als ich an Titan zu arbeiten begann.
Davon abgesehen blieb mir die Liebe zu den Waffen erhalten, bis auf ein kurze, wahnhafte Phase in den frühen Siebzigern, in der ich mich selbst als Liberalen bezeichnete und glaubte, einer Waffenkultur überlegen zu sein. Doch sie lockte mich immer wieder, und tief in meinem Innern wusste ich, dass es meine wahre Leidenschaft und eins der Dinge war, die mich vom schreiben wollen zum tatsächlichen Schreiben animieren würde, und der tiefere Sinn von Waffen meiner Vorstellungskraft den stärksten Ausdruck verleihen würde. Trotzdem habe ich nie viel geschossen und auch erst vor ein paar Jahren eine Waffe gekauft, als ich an Titan zu arbeiten begann.
Um einen Scharfschützen zum Leben zu erwecken, musste ich auch seine Waffe zum Leben erwecken, und um die Waffe zum Leben zu erwecken, musste ich sie abfeuern, reinigen, auseinandernehmen, mit mir herumtragen, sie zu einem Teil meines Lebens machen. Also kaufte ich eine Waffe, die dem Scharfschützengewehr eines Marine am nächsten kam. Es war eine Remington 700 Kaliber .308, das Polizeimodell mit schwerem Lauf, das in seiner Schlichtheit recht plump und ohne jeden Anspruch auf Stil oder Schönheit war. (Auch hierin unterschied ich mich sichtbar von Carlos Hathcock, weil er in Vietnam die ganze Zeit eine Winchester Modell 70 benutzte). Ich rüstete sie mit einem Leupold 10X Zielfernrohr aus, wie sie die Marines in Vietnam hatten (sie hatten Redfields, doch immerhin mit einem 10X). Und ich fuhr hinaus zum Schießplatz an der Marriotsville Road, ungefähr fünf Meilen nördlich von meinem Zuhause in Columbia, und ich schoss … und schoss … und schoss. Ich begriff sofort, dass alles, was ich in Filmen gesehen hatte, falsch war. Als Erstes lernte ich, wie schwierig es war. Wie diffizil, wie man sowohl die Kraft als auch die Geschmeidigkeit haben musste, um seinen Körper vollkommen zu kontrollieren, an manchen Stellen angespannt und an anderen locker zu sein, und man musste die Kontrolle über seine Atmung übernehmen. Man musste seinen Verstand und sein Herz beherrschen; wenn einem das nicht gelänge, wäre man niemals gut darin.
Ich war niemals wirklich gut darin, wenn auch nach einiger Zeit ganz passabel. Doch die Freude darüber, es zu lernen, verwandelte mein Schreiben in etwas Authentischeres. Mir war bewusst, dass dieser Vorgang noch nie präzise in einem Buch beschrieben worden war, und ich dachte, wenn ich das richtig hinbekomme, hätte ich zumindest etwas anderes.
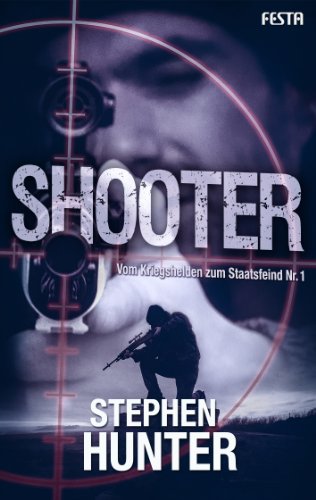
 Und dann war da noch der Mut. Ich wusste, das Bob mutig wäre. Er wäre einer der wenigen Männer (ganz anders als ich, möchte ich hastig hinzufügen), der feindlichem Feuer stoisch begegnen würde, es als eine Sache des Kalküls verstand, um rasch und geschickt zu handeln. Nicht dass er keine Angst gehabt hätte; er hatte mit Angst umzugehen gelernt, oder er hatte ein Motiv, das so stark war, das es seine Angst besiegte. Doch welches Motiv wäre das?
Und dann war da noch der Mut. Ich wusste, das Bob mutig wäre. Er wäre einer der wenigen Männer (ganz anders als ich, möchte ich hastig hinzufügen), der feindlichem Feuer stoisch begegnen würde, es als eine Sache des Kalküls verstand, um rasch und geschickt zu handeln. Nicht dass er keine Angst gehabt hätte; er hatte mit Angst umzugehen gelernt, oder er hatte ein Motiv, das so stark war, das es seine Angst besiegte. Doch welches Motiv wäre das?
Ich las die Biographien von Kriegshelden, um herauszufinden, was sie so mutig machte. Im Falle von Offizieren (also Anführern), war es der Glaube an die Sache und das System, die Angst, andere im Stich zu lassen, Verantwortungsgefühl. Doch das ist es nicht, was einen Scharfschützen ausmacht. Er ist allein, auf sich gestellt, draußen auf fremdem Terrain. Keiner weiß, ob er mutig ist oder nicht; er ist nur sich selbst gegenüber Rechenschaft schuldig. Was treibt ihn an? Ich musste es herausfinden, weil ich entschlossen war, den gesamten Menschen zu kreieren, und ich wollte ihn nicht nur als mutig bezeichnen und es dabei belassen, wie es häufig in zweitklassigen Filmen und Romanen geschieht.
Schließlich bin ich auf eine weitere Figur von enormer Willenskraft und Können gestoßen, der allerdings schwierig und sogar abstoßend war. Ich bin auf Tyrus Raymond Cobb gestoßen. Zum Teil liegt es an meiner Faszination für schwierige Charaktere, dass ich Ty Cobb mag. Ja, ich weiß: rassistisch, sexistisch, gewalttätig, völliger Außenseiter, grausam, rachsüchtig, unbarmherzig, unsympathisch, von allen verschmäht. Doch seine Hintergrundgeschichte ist sehr interessant. Als er neunzehn Jahr alt war und gerade seinen ersten Vertrag als Profi-Baseballspieler unterschrieben hatte, erschoss seine Mutter seinen Vater im Schlafzimmer mit einer Schrotflinte. Ihr Liebhaber war bei ihr im Bett gewesen. Ty Cobb liebte seinen Vater, einen prominenten Rechtsanwalt aus Georgia, der von allen als ein freundlicher, brillanter, gerechter Mann angesehen wurde. Er fühlte sich schrecklich betrogen, weil ihn sein Vater niemals als Profi spielen sehen würde, und er war von den zwielichtigen Umständen, unter denen sein Vater zu Tode gekommen war, und die so gar nicht seinem Ruf entsprachen, am Boden zerstört. Trotzdem kam er finanziell für die Verteidigung seiner Mutter auf und erlebte mit, wie sie straffrei davonkam, nachdem sie angeführt hatte, dass sie ihn für einen Einbrecher gehalten hatte.
 Ich beschloss, Bob mit einer ähnlichen Triebkraft zu versehen – ein brillanter Vater, den er unter schwierigen Umständen früh verliert, die den Verdiensten des Mannes nicht entsprachen, so dass der gequälte Sohn seinen Vater sehr vermissen und ein Leben lang versuchen würde, der Brillanz des Mannes zu entsprechen. Er war ein Mann, der seinen Vater idealisierte, weil er nie gelernt hatte, dass sein Vater auch nur ein Mensch war, mit Fehlern und Schwächen.
Ich beschloss, Bob mit einer ähnlichen Triebkraft zu versehen – ein brillanter Vater, den er unter schwierigen Umständen früh verliert, die den Verdiensten des Mannes nicht entsprachen, so dass der gequälte Sohn seinen Vater sehr vermissen und ein Leben lang versuchen würde, der Brillanz des Mannes zu entsprechen. Er war ein Mann, der seinen Vater idealisierte, weil er nie gelernt hatte, dass sein Vater auch nur ein Mensch war, mit Fehlern und Schwächen.
 Ich erinnere mich, wie ich eines Abends in meinem Haus in Columbia einen Absatz tippte. Ich habe keine Ahnung, woher das gekommen war. Ich schrieb über – hmm, welcher Name klingt nach dem Süden? – oh ja, Earl, ja, das ist es. Earl. Machen wir aus Earl ebenfalls einen Marine, und, oh, ich weiß, das ist cool, verleihen wir ihm eine Medal of Honor für Iwojima; er soll sich seinen Weg durch den Pazifik kämpfen, Insel für blöde Insel, Killer, Held, Marine, Legende. Oh, dann kommt er zurück und wird Polizeibeamter. Zehn Jahre später wird er dann in einem verwahrlosten Maisfeld von zwei White-Trash-Typen getötet, mit diesen typischen Namen, wie sie in Dog of the South vorkommen, ich weiß, wir nennen sie Jimmy und Bub Pye; da haben wir’s. Achilles, ermordet von zwei Yocums, oder Snopeses. Oh ja.
Ich erinnere mich, wie ich eines Abends in meinem Haus in Columbia einen Absatz tippte. Ich habe keine Ahnung, woher das gekommen war. Ich schrieb über – hmm, welcher Name klingt nach dem Süden? – oh ja, Earl, ja, das ist es. Earl. Machen wir aus Earl ebenfalls einen Marine, und, oh, ich weiß, das ist cool, verleihen wir ihm eine Medal of Honor für Iwojima; er soll sich seinen Weg durch den Pazifik kämpfen, Insel für blöde Insel, Killer, Held, Marine, Legende. Oh, dann kommt er zurück und wird Polizeibeamter. Zehn Jahre später wird er dann in einem verwahrlosten Maisfeld von zwei White-Trash-Typen getötet, mit diesen typischen Namen, wie sie in Dog of the South vorkommen, ich weiß, wir nennen sie Jimmy und Bub Pye; da haben wir’s. Achilles, ermordet von zwei Yocums, oder Snopeses. Oh ja.
Ich tippte es zu Ende und vergaß es wieder.
Doch als ich damit fertig war – Jahre später, wie es schien -, blieb es irgendwie haften. Achilles, niedergestreckt im Maisfeld, von zwei nichtsnutzigen Punks, die sich noch damit brüsten. Es war so traurig: Ich musste einfach mehr erfahren, und die einzige Möglichkeit hierfür war, es zu schreiben. Und genau das tat ich. Was Bob Lee und Im Fadenkreuz der Angst betrifft, gibt es nicht viel mehr zu erzählen. Sobald ich ihn hatte, hatte ich das Buch. Alles andere passierte ungefähr zu der Zeit, zu der es passieren sollte. Es gab eine letzte, verzweifelte Neufassung, in der ich ein weiteres erzählerisches Problem löste, indem ich aus einer Verbrechergestalt zwei machte, einmal Colonel Ray Shreck, ehemaliger Green Beret, und Hugh Meachum, CIA-Mitarbeiter und Spionage-Industrieller der Extraklasse. (Sie wurden in der Verfilmung von Danny Glover und Ned Beatty gespielt. Sieh an.)
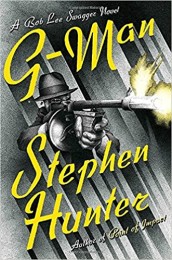 Doch als der Roman fertig war, gute Kritiken bekam, sich aber schlecht verkaufte, stellte ich fest, dass Bob und sein Vater Earl nicht verschwinden wollten. Ich versuchte sie zu verscheuchen, weil meine Handwerksehre es eigentlich nicht erlaubte, dass ich mich wiederholte. Doch sie wollten nicht verschwinden, und ich musste das nächste Buch schreiben. Und dann noch eins. Und noch eins … Ich hatte meine Lebensaufgabe gefunden, und ich war der Letzte, der es mitbekam.
Doch als der Roman fertig war, gute Kritiken bekam, sich aber schlecht verkaufte, stellte ich fest, dass Bob und sein Vater Earl nicht verschwinden wollten. Ich versuchte sie zu verscheuchen, weil meine Handwerksehre es eigentlich nicht erlaubte, dass ich mich wiederholte. Doch sie wollten nicht verschwinden, und ich musste das nächste Buch schreiben. Und dann noch eins. Und noch eins … Ich hatte meine Lebensaufgabe gefunden, und ich war der Letzte, der es mitbekam.
Stephen Hunter im CrimeMag-Jahresrückblick 2017 hier. Seine aktuellste Bob-Lee-Swagger-Buch, „G-Man“, bei CrimeMag ausführlich hier. Aus einem zweiteiligen CrimeMag-Porträt Alf Mayers von Stephen Hunter (hier und hier) entwickelte sich eine achtteilige „Kulturgeschichte des Scharfschützen“ (Links am Ende des Textes). Stephen Hunter wird im deutschsprachigen Raum derzeit vom Festa-Verlag präsent gehalten, nachdem er lange unübersetzt geblieben war.
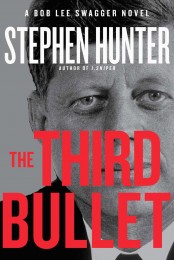 Folgende Bob-Lee-Swagger-Romane sind derzeit auf Deutsch erhältlich:
Folgende Bob-Lee-Swagger-Romane sind derzeit auf Deutsch erhältlich:
Shooter – Point of Impact (1993, Festa Verlag 2014)
Nachtsicht – Black Light (1996, Festa Verlag 2014)
Einsame Jäger – Time to Hunt (1998, Festa Verlag 2016)
Der 47. Samuari – The 47th Samurai (2007, Festa Verlag 2017, CrimeMag-Kritik hier)
Night of Thunder (2008)
I, Sniper (2009)
Dead Zero (2010)
The Third Bullet (2013)
Sniper’s Honor (2014)
G-Man (2017, CrimeMag-Kritik hier)
 Zum von Susanna Mende übersetzten Text: Einundzwanzig berühmten Krimiautoren mit Detectives als Serienhelden hat Otto Penzler, ausgewiesener New Yorker Krimiexperte und Betreiber des Mysterious Bookshop, die gleiche Frage gestellt: Wie ist Dein Held eigentlich entstanden? Die einundzwanzig Antworten darauf sind 2009 in Form von Essays in dem lesenswerten und erhellenden Band „The Lineup – The World’s Greatest Crime Writers Tell the Inside Story of Their Greatest Detectives“ erschienen. Zu den Autoren, die diese Frage beantwortet haben, gehört auch Stephen Hunter. Er hat uns diese exklusive deutsche Veröffentlichung sehr freundlich genehmigt.
Zum von Susanna Mende übersetzten Text: Einundzwanzig berühmten Krimiautoren mit Detectives als Serienhelden hat Otto Penzler, ausgewiesener New Yorker Krimiexperte und Betreiber des Mysterious Bookshop, die gleiche Frage gestellt: Wie ist Dein Held eigentlich entstanden? Die einundzwanzig Antworten darauf sind 2009 in Form von Essays in dem lesenswerten und erhellenden Band „The Lineup – The World’s Greatest Crime Writers Tell the Inside Story of Their Greatest Detectives“ erschienen. Zu den Autoren, die diese Frage beantwortet haben, gehört auch Stephen Hunter. Er hat uns diese exklusive deutsche Veröffentlichung sehr freundlich genehmigt.
In dieser Reihe exklusiv – und jeweils übersetzt von Susanna Mende – bereits bei CrimeMag:
John Harvey über Charlie Resnick
Ken Bruen über Jack Taylor
Ian Rankin über John Rebus
Michael Connelly über Harry Bosch
Lee Child über Jack Reacher











