Über Kate Alice Marshall Ich lebe noch und Marlen Haushofer Die Wand
Berichte aus der größtmöglichen social distance
Ich bin allein. Ich habe nicht viel zu essen. Die Temperatur fällt. Niemand kommt mich holen. Bald wird es Winter und hier draußen kann man auf so viele Arten sterben. Wenn mich nicht die Kälte erledigt, dann der Hunger. (…) Aber ich bin noch nicht tot und das sollte jemand erfahren. Irgendjemand sollte erfahren, was passiert ist. Deshalb schreibe ich es auf, so gut ich kann. In Bruchstücken, denn auch in meinem Kopf ist alles völlig verworren. (Anfang „Ich lebe noch“)
Heute, am fünften November, beginne ich mit meinem Bericht. Ich werde alles so genau aufschreiben, wie es mir möglich ist. (…) Ich schreibe nicht aus Freude am Schreiben; es hat sich eben so ergeben, daß ich schreiben muß, wenn ich nicht den Verstand verlieren will. Es ist ja keiner da, der für mich denken und sorgen könnte. Ich bin ganz allein, und ich muß versuchen, die langen dunklen Wintermonate zu überstehen. (Anfang „Die Wand“)
Die beiden Protagonistinnen in „Ich lebe noch“ und „Die Wand“ sind komplett isoliert und viel ärmer dran als die meisten von uns im Moment.

Jess überlebt einen Autounfall, bei dem ihre Mutter stirbt, mit vielen Verletzungen und einem dauerhaft schmerzenden Bein. Nach langer Reha und einem kurzen Aufenthalt in einer Pflegefamilie reist sie zu ihrem Vater in die kanadische Wildnis. Sie kennt ihn so gut wie gar nicht, da er die Familie verlassen hat, als sie noch ein Kleinkind war. Vater und Tochter haben nicht viel Zeit, sich kennenzulernen, denn bald kommen zwielichtige Gestalten mit dem Flugzeug und töten den Vater, was Jess mit ansehen muss. Sie kann sich verstecken. Die Männer verlassen den Ort des Geschehens, brennen allerdings vorher die Hütte nieder. Fortan ist Jess auf sich allein gestellt. Sie hat nichts, kein Dach über dem Kopf und keinen Kontakt zur Außenwelt. Hier, in der schroffen, feindlichen Wildnis, lebt kein anderes menschliches Wesen, und ihr einziger Gefährte ist Bo, der Hund des Vaters.
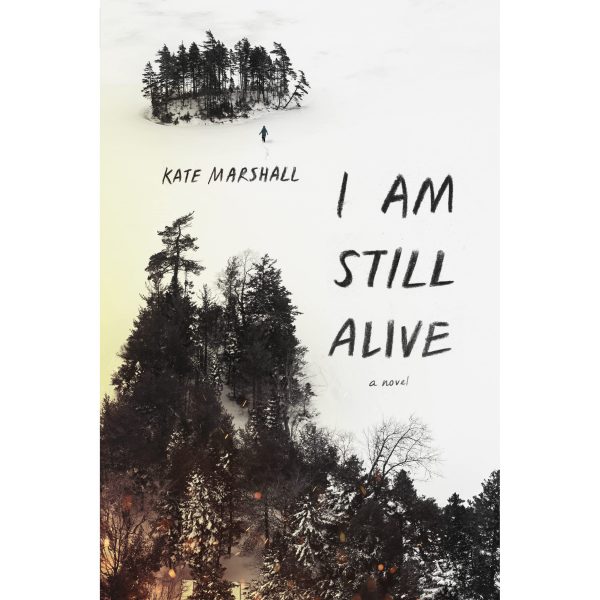
„Ich lebe noch“ ist furios und so spannend, dass man es streckenweise fast nicht aushält. Jess kämpft im wahrsten Sinne des Wortes um ihr Leben, sie steht stets kurz vor dem Hunger- oder dem Erfrierungstod – ganz zu schweigen von ihrer Verzweiflung und Angst –, und alles wird immer noch schlimmer statt besser. Das macht die Autorin sehr, sehr gut und glaubwürdig. Marshall gönnt den Lesern keine Atempause und keine Schonung, denn sie macht vor nichts Halt (im Unterschied übrigens zu anderen Autoren und Autorinnen, die sich selbst bremsen und das Allerschlimmste dann doch nicht geschehen lassen). Alles, wovon wir mit Schrecken befürchten, dass es nun eintritt – nein, o Gott, jetzt wird doch nicht auch noch …? –, passiert dann tatsächlich. Beim Fischfang, den sie als Stadtkind natürlich erst lernen muss, kippt sie mit dem Kanu um und fällt ins eiskalte Wasser. Sie schafft es zwar bis ans Ufer, kann sich aber nirgendwo aufwärmen, weil sie keinen Unterschlupf und kaum noch trockene Kleidung hat. Feuermachen gelingt ihr auch nicht auf Anhieb. Später fackelt sie ihren mühsam erbauten Verschlag versehentlich selbst ab und steht schon wieder ohne Schutz im Freien. Und bald ist Winter. Sie muss die halb verweste Leiche ihres Vaters ausgraben (detailreich beschrieben). Und jederzeit befürchtet sie, dass die bösen Männer, die ihren Vater ermordet haben, wiederkehren (wozu sie auch allen Grund hat).
Jess ist ständig kurz davor, aufzugeben und sich dem Sterben zu überlassen. So viele Fehlversuche beim Feuermachen. Irgendwann nimmt sie einen bei der Anreise im Flughafenshop gekauften schlechten Krimi zur Hilfe (was bei einer Krimi-Autorin schon sehr komisch ist):
Ich reiße die Titelseite und die erste Seite des Prologs heraus (in dem eine Frau in einem roten Kleid ermordet wird, um aufzuzeigen, dass der Hauptbösewicht böse ist) und zerrupfe sie.
Es ist ein schreckliches Buch und bisher habe ich es vier Mal gelesen. Jedes Mal ist es kürzer, weil ich immer wieder Teile davon verbrenne, aber nicht besser.
(Nein, ich sage jetzt nicht, wozu man den schlechten Krimi in der Not auch noch verwenden könnte.)

„Ich lebe noch“ hat mich schon auf den ersten Seiten an Marlen Haushofers „Die Wand“ erinnert, eins meiner Lieblingsbücher. Viele Jahre nach Haushofers Tod war „Die Wand“ zu späten Ehren gekommen, besonders durch die legendäre Literatursendung im Fernsehen mit Elke Heidenreich, wenn ich mich recht entsinne. Es gab die Verfilmung mit Martina Gedeck und unzählige Deutungen – die bekannteste wohl die, das Buch beschreibe eine Depression und die daraus resultierende Abkapselung von der Welt. Neben vielem anderen mag ich an der „Wand“ – ein Roman übrigens, der ganz ohne Kapitel und sogar ohne Absätze (Leerzeilen) auskommt, ein fortlaufender, durch nichts unterbrochener Albtraum –, dass man sie auch wie einen Survival-Roman konsumieren kann (bei mir immer verbunden mit der Frage, ob ich zu all diesen Überlebenspraktiken in der Lage wäre).

Die jugendliche Jess hat es weitaus härter getroffen als die mittelalte, namenlose Frau in der „Wand“. Ihr schmerzendes Bein behindert sie, und über weite Strecken fehlt ihr selbst die primitivste Behausung (im Unterschied zu der Frau in der „Wand“ mit einer vergleichsweise luxuriösen Jagdhütte). Beide meistern das Überleben, wenn auch mit vielen Rückschlägen. Sie werden im Laufe der Zeit zäher, dünner, ledriger und verwildern immer mehr, einem Tier ähnlicher als einem Menschen, wie sie selbst sagen. Mangels anderer Menschen sprechen sie mit sich selbst und mit ihrem jeweiligen Hund. Geboren aus der Isolation schreiben beide eine Art Tagebuch, einen Bericht (= der Roman). Ohne jede menschliche Kommunikation vergewissern sie sich auf diese Weise ihrer eigenen Existenz. Die Frau in der „Wand“ verwendet dafür auch noch das letzte Stück Papier, das sie in der Jagdhütte finden kann, Jess in „Ich lebe noch“ ein rosafarbenes Mädchennotizbuch mit tanzenden Ponys vorne drauf.
Jess und die namenlose Frau müssen zusehen, wie sie an Nahrung kommen, und können sich nicht mal mit anderen Kunden um die letzte Packung Nudeln oder die letzte Dose gehackte Tomaten im Supermarkt prügeln. Am ersten Morgen nach Verkündung bundesweiter Kontakt-Einschränkungen, am 23. März 2020, wachte ich auf und war als Erstes sehr irritiert von dieser fremden Stille mitten in Kreuzberg. Mich beeinträchtigen die derzeitigen Regelungen noch nicht so stark (in Berlin sind übrigens die Buchhandlungen auch noch geöffnet), wobei die Absage der Leipziger Messe schon einzigartig für die Buchbranche war – und dass Amazon derzeit Bücher sehr spät versendet und keine mehr nachbestellt, stattdessen Klopapier, betrifft natürlich auch mich. Dass die Preisverleihung des Stuttgarter Krimipreises, die für Ende März vorgesehen war, verschoben wurde, bekümmert mich persönlich am meisten. Bisher habe ich eine Online-Lesung „besucht“, wahrscheinlich werden es noch ein paar mehr. Gewöhnungsbedürftig, aber auch lustig, den Autoren in ihren Wohnzimmern zuzusehen. Ansonsten sitze ich an meinem nächsten Buch – was ich auch ohne Corona täte. Zwischendurch würde ich schon mal gern essen oder ein Bier trinken gehen. Aber ich muss weder Kartoffeln selbst anpflanzen („Die Wand“) noch hinaus auf den eisigen See, um Fische zu fangen, und vor allem muss ich keine Leiche ausbuddeln, weil ich dringend warme Stiefel brauche.
Regina Nössler
- Kate Alice Marshall: Ich lebe noch (I Am Still Alive, 2018). Deutsch von Marc Tannous. Festa Verlag, Leipzig 2020. Hardcover, 384 Seiten, 19,95 Euro.
- Marlen Haushofer: Die Wand. Ullstein Verlag, Berlin 2004 – ursprünglich erschienen 1963 bei Mohn, 1968 bei Claassen.
Regina Nössler ist die Autorin exzellenter Krimialromane, die bei Claudia Gerke im Konkursbuch Verlag erscheinen. Thomas Wörtche bei CrimeMag über „Schleierwolken“, jetzt im Januar mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet und auch auf unserer CrimeMag Top Ten für 2019.













