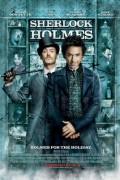 Where science would take the place of chance
Where science would take the place of chance
Noch eine Sherlock Holmes Verfilmung? Ja! Und diesmal eine, die die ganze olle Holmes-Folklore nicht wiederkäut und unter dem Rezeptionsgerümpel etwas sehr Taugliches hervorzieht. Henrike Heiland war im Kino.
Da versteh’ einer die Aufregung. Eigentlich sind es vermutlich wohl zwei Aufregungen. Einmal die Aufregung um Guy Ritchie, der jetzt ja wohl hoffentlich und bitteschön wieder gute Filme zu machen hat, wo Madonna ihn endlich in Ruhe lässt, und was macht er, Sherlock Holmes, also echt!
Dann die Aufregung um Sherlock Holmes himself, der ja wohl im Film nicht so ist, wie er sein soll, das geht ja nun überhaupt gar nicht. Riesenaufregung also, und wem Aufregen zu Neunziger ist, der sagt, dass der Film bestenfalls langweilig und streckenweise verschenkt war.
Diese Aufregung muss man wirklich erst mal irgendwie verstehen. Guy Ritchie hat nämlich einen guten Film gemacht, gut zum Beispiel im kommerziellen Sinn: Noch nie haben so viele Leute einen Guy Ritchie-Film gesehen, nie war der Mann erfolgreicher. (Okay, das zählt natürlich wieder nicht, wer will schon einen Kassenschlager toll finden.) Gut auch im „Hausaufgaben-Gemacht-Sinn“: Das da mit Jude Law als Dr. Watson und Robert Downey Jr. als Sherlock Holmes, das ist nämlich durchaus eine werksgetreue Interpretation. Da hat jemand seinen Arthur Conan Doyle ganz genau genommen. Und sich Gedanken gemacht.
Und das soll man ja wohl, sich Gedanken machen, wenn man sich schon an einen Klassiker wagt. Die Drehbuchautoren dieses Films haben nämlich getan, was der ein oder andere Rezipient (und Rezensent) schon lange nicht mehr, wenn überhaupt jemals, getan hat: Sie haben Holmes rauf und runter gelesen. Ja, gelesen. Sich Notizen gemacht. Und dann geschaut, was man damit alles anstellen kann: Holmes experimentiert mit Drogen, jaja, er boxt, wunderbar, er hat eine Schwäche für die einzige Frau, die ihm ebenbürtig ist, prima. Holmes ist nach wie vor ein kluger Geist, aber daran, dass er eben nicht die ganze Zeit mit seiner blöden Kappe rauchend im Sessel sitzt, kann sich mancher wohl nur schwer gewöhnen. Da ist von „comichaft“ die Rede, von „actionlastig“, von „unangemessener Story“, herrje, als wäre es nicht in einigen der Kurzgeschichten schon so angelegt. Über hundert Jahre einseitige Rezeptionsgeschichte kann man ruhig mal hinter sich lassen.
Ein kluges Kerlchen
Sir Arthur Conan Doyle, das sollte hinlänglich bekannt sein, war ausgesprochen nachlässig beim Schreiben seiner Holmes-Geschichten. Da kam er schon mal ein wenig mit seinen Details durcheinander, weil er vergessen hatte, wer jetzt wie welche Familienverhältnisse und welche Kriegsverletzungen hatte, und dann erforderte es ja auch die Dramaturgie, dass Holmes manchmal nur zu Hause rumsaß, manchmal in einer albernen Verkleidung irgendwo herumturnte, und manchmal tagelang in Opiumkellern versackte, worüber sich Dr. Watson entsprechend aufregte … Conan Doyle macht dabei nicht sehr viel anderes als Edgar A. Poe mit seinem Dupin: Der sitzt auch in einer Geschichte nur rum und denkt, in der nächsten schnüffelt er halbwissenschaftlich am Tatort rum, in der dritten wagt er sich direkt in die Höhle des Löwen, inklusive halbgarer Verkleidung. Es gibt im Grunde nicht den immergleichen „Somusserseintyp“. Aber beiden ist gleich, dass sie überallhin ihren vermeintlich genialen Geist mitnehmen. Holmes ist, im Original wie im Film, ein intelligenter Kerl, und – um endlich mal wieder zum Film zu kommen – Guy Ritchie setzt sehr hübsch um, wie Holmes seine Berechnungen anstellt, wie er in Sekundenbruchteilen seine nächsten Schritte und die des Gegners vorausberechnet. Und dann trifft alles genau so ein, wie es sich der Detektiv gedacht hat. Ja, warum denn nicht? Jetzt hat man die filmerzählerischen Möglichkeiten, dann sollte man es auch einfach tun.
… und ein cleveres Kerlchen
Der Film-Holmes macht also durchaus nicht sehr viel anderes als der Buch-Holmes. Manche Dinge löst er, ohne einen Finger zu rühren: Er hört zu, und weiß, was los ist. So kennt man ihn. Es werden lediglich für die eigentliche Story, den eigentlichen Fall Seiten hervorgehoben, die sonst in den Filmen zugunsten des angeblichen Gentlemans nur angedeutet wurden, wenn überhaupt. Und das tut der Figur gut, dass mal jemand sich die Mühe gemacht hat, in die Bücher zu schauen (um u.a. festzustellen, dass Holmes eben nicht die ganze Zeit diese schwachsinnige Kappe auf hat). Das tut auch der Watson-Figur gut, denn der ist endlich nicht mehr der um einiges ältere, behäbige, komplett vertrottelte Stichwortkartenhochhalter. Nein, Watson ist ein cleverer Kerl, der ganz gut weiß, dass das Zusammenspiel von Genialität und Wahn in seinem Freund Holmes nicht sein Ding ist. Mit Watson ist man im Grunde fast weiter gegangen als mit Holmes, aber auch das wird schön ordentlich erklärt, indem jemand über den Doktor urteilt, er habe ja endlich so was wie Humor dazugelernt. Und auch Holmes zeigt sich schon mal angenehm überrascht, als er die Sicherheit, mit der Watson seine Schlüsse zieht, honoriert. Offenbar hat er sich gut entwickelt in der Junggesellenzeit, in der sich die beiden eine Wohnung teilen.
Bösewichte
Ach, die Nebenfiguren: Auch sie sind das Resultat eingehender Conan Doyle-Lektüre, und Professor Moriarty als Randfigur lässt auf den Fortsetzungswillen der Produzenten schließen. Man könnte also sagen: Alte Zutaten, neu zusammengerührt. Und dabei sieht der Film auch noch ganz prima aus. Gute Schauspieler, tolle Kostüme, klasse Szenenbild, schöner Schnitt. Er hört sich auch noch gut an, die Musik ist ganz wunderbar. Aus dem Hause Zimmer, übrigens. Die Synchronisation nervt natürlich, weil viele deutsche Synchronregisseure denken, man müsse Engländer hochnäsig näseln lassen. Eine leichte Unsicherheit bei der Aussprache von gewissen Londoner Stadtteilen, okay, das ist aber auch schwer, das können auch die amerikanischen Touristen nicht.
Und was noch? Ah ja, die Story. Bösewicht Lord Blackwood, eine Mischung aus Hitler und Dracula in Wesen und Aussehen, will mithilfe eines Geheimbundes und viel schwarzer Magie so was wie die Weltherrschaft. Oder was man damals darunter verstand. Erst mal das britische Parlament unter die Fuchtel bekommen und dann diese verlorengegangenen Gebiete auf diesem Kontinent jenseits des Atlantiks wieder schön in den Schoß des British Empire zurückholen. Das ist aber der Masterplan, vorher erlegt Lord Blackwood ein paar schöne Jungfrauen, dabei wird er – gleich in den ersten fünf Minuten – von Holmes und Watson überwältigt und von einem wie immer zu spät auftauchenden Inspector Lestrade eingebuchtet. Schließlich wird Blackwood gehängt, aber dann kommt es zu einer skandalträchtigen Wiederauferstehung und dem ganzen Gedöns um die Weltherrschaft und den schwarzen Zauber.
Untypisch und eines Holmes nicht würdig, wird da geätzt. Aber Sekunde mal, Holmes hat doch dauernd mit faulen Zauberern zu tun, es geht doch immer um das vermeintlich Unmögliche, das in Wirklichkeit nur ein bisschen unwahrscheinlich ist. Genau da werden die Fähigkeiten des um die Ecke denkenden Detektivs doch gebraucht! Leichen anschauen und in CSI-Manier Maden bestimmen, soweit käme Watson auch alleine. (Sie tun es im Film übrigens, die beiden, und watschen den CSI-Fans damit dermaßen ins Gesicht, wie sie sich da schon hundert Jahre vor Anthony E. Zuikers „Massenwarendetectives“ über die Insekten beugen. Sehr niedlich.) Und Geheimbünde – als ginge es nicht auch bei Conan Doyle immer mal wieder um ein paar alte Männer aus der Oberschicht, die einen auf exklusiv machen und ihrem Club einen komischen Namen und merkwürdige Aufnahmerituale geben, vor dem Hintergrund, irgendwo in der großen Politik maßgebend mitmischen zu wollen.
Bildgewalt & Komik
Es stimmt absolut, dass die Geschichte im Film dann doch eher zur Nebensache wird. Das liegt an der Bildgewalt, das liegt an der Verspieltheit des Regisseurs, der die Prügel- und Actionszenen dann doch mal ein bisschen länger laufen lässt. Aber immer mit Humor. Gar nicht langweilig. Zwischendurch wunderbare Dialoge der beiden Junggesellen. Wobei Watson eher ein Noch-Junggeselle ist, denn er hat doch irgendwie vor, sich zu verloben, verliert aber in Freudscher Manier den Verlobungsring, will unbedingt bei Holmes ausziehen und ein unaufgeregtes Leben führen, in dem das Treffen mit den zukünftigen Schwiegereltern das Highlight des Monats ist. Er lässt den familiären Tee dann aber doch sausen, um mit Holmes ein paar Türen einzutreten. Jude Law gibt Watson dabei noch so viel Eleganz und Selbstironie, dass man alle anderen Watson-Deutungen sofort vergessen mag, um sich nie wieder an sie zu erinnern.
Ja, der spitznasige, hagere Holmes mit Hakennase, den findet man nicht. Dafür Robert Downey Jr., der das Spitzbübige mitliefert. Law und Downey Jr. sind ein herrliches Paar, auch ein gleichberechtigtes Paar, das kann man vielleicht als Referenz an die Entwicklung sehen, die die Detektivfiguren in über hundert Jahren gemacht haben. Weg vom Einzelnen, hin zum Team. Der eine kann nicht ohne den anderen. Brüder im Geiste, heißt es an einer Stelle und das Zusammenleben der beiden, das in der filmischen Gegenwart schon fast vorbei ist, lebt in Andeutungen und Rückblenden auf. Man möchte eigentlich mehr davon sehen, wie Holmes in seinem ausgefransten Morgenmantel (den es schon bei Conan Doyle gab) mit einem drogenbenebelten Kopf (den er schon bei Conan Doyle hatte) durch seine Chemieexperimente watet (die er schon bei Conan Doyle gemacht hat), während Watson ihm Vorträge hält, er solle sich doch mal zusammenreißen (wie schon …), und hat er sich je über das nächtliche Violinspiel beschwert? Nein, eben.
Spaß!!!
Der Film macht, unterm Strich, sehr viel Spaß. Lobend zu erwähnen blieben noch Eddie Marsan als dämlicher Inspector Lestrade, und William Houston als cleverer Constable Clark. Auch so ein Team, das Spaß macht, wenn auch nur zart am Rande. Wie viel Guy Ritchie nun noch übrig ist vom alten Guy Ritchie, das ist vielleicht gar nicht so wichtig, denn seine Handschrift ist unverkennbar, und schließlich heißt der Film „Sherlock Holmes“ und nicht „Guy Ritchie dreht jetzt was, ohne mit Madonna verheiratet zu sein“.
Und der Sherlock Holmes, der einem da begegnet, auf den kann man sich ruhig mal einlassen. Steht alles irgendwo in Conan Doyles Geschichten. Man muss es nur suchen. Genau wie die fürchterliche Kappe. Die kommt schließlich auch nur einmal vor, da kann man sie ruhig weglassen. Danke, Mr. Ritchie. Was Conan Doyle mit seinem Sherlock Holmes wollte, war ein Abwenden von den Zufallsentdeckungen in der bis dato gängigen Kriminalliteratur. Wissenschaftlich sollte der Detektiv vorgehen. Und was tun Wissenschaftler? Sie probieren rum. Das macht Holmes. Auch der Holmes von Ritchie. Das ist der Grundstein der Detektivliteratur, die Wissenschaft ersetzt den Zufall, „where science would take the place of chance“. Genau das zeigt Ritchie. Genau das.
Henrike Heiland
Sherlock Holmes (Sherlock Holmes). USA 2009.
R: Guy Ritchie. B: Michael Robert Johnson, Anthony Peckham, Simon Kinberg. K: Philippe Rousselot. S: James Herbert. M: Hans Zimmer. P: Silver Pictures, Joel Silver, Lionel Wigram, Susan Downey, Dan Lin. D: Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong, u.a.











