 In der Verlustzone
In der Verlustzone
Namibische Perspektiven auf die DDR und die Volksrepublik Polen – von Bruno Arich-Gerz
Der DDR und der Volksrepublik Polen trauern heute nur noch verschrobene Ostalgiker, Kommunismus-Apologeten und ehemalige Parteifunktionäre der SED oder der PZPR (der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei) nach. Als Verlust begreift außer ihnen niemand mehr das Ende der beiden von der Sowjetunion am Gängelband gehaltenen Staaten.
Könnte man meinen.
Und damit irren, denn dem gängigen Narrativ zweier in den 1980er Jahren zunehmend in die Defensive gedrängten, von Oppositionsbewegungen angefochtenen und angesichts einer defizitären Versorgungslage mit Legitimationsproblemen kämpfenden Staatsführungen entgegen steht ein kleiner Triumph in außenpolitischer Hinsicht. Die von der DDR und der Volkrepublik Polen aktiv unterstützten Befreiungsbewegungen im südlichen Afrika setzten 1974 in den ehemaligen portugiesischen Kolonien Angola und Mozambique, 1980 in Simbabwe und schließlich in Namibia freie Wahlen und damit den Wechsel hin zu nicht mehr weißen Machthabern durch.
Wegen des nicht nur doppelten (in Polen und Ostdeutschland), sondern dreifachen Wendejahres 1989 ist das Beispiel Namibia dabei besonders reizvoll, und es lohnt der Blick in die Quellen- und Forschungslage zur SED-Unterstützung oder den von der PZPR mitgetragenen Maßnahmen zugunsten der namibischen Befreiungsbewegung. Dabei scheinen die verfügbaren Quellen über die DDR reichhaltiger und auch in wissenschaftlicher Hinsicht erschlossener zu sein. Neben zahlreichen autobiografischen Zeugnissen finden sich Studien aus der Transnationalitätsforschung und archivsichtungsbasierte, bildungspolitische bzw. -historische Arbeiten zum Zusammenspiel von SED und der gegen das südafrikanische Besatzungsregime in Namibia agierenden South West Africa’s People Organisation (SWAPO). Für Polen fehlt eine detaillierte Einsichtnahme und Auswertung der Verbindungen von PZPR und SWAPO noch. Was aber vorliegt, sind die publizierten Erinnerungen von Namibiern, die sich bereits in den 1960er Jahren auf Initiative der Volksrepublik Polen im Land aufhielten und dort weiterbildeten und -qualifizierten.
Namibia und die DDR
Nach der Verabschiedung der UN-Resolution 3295 vom Dezember 1974, in der die SWAPO von der Völkergemeinschaft zum wiederholten Mal den Status als „authentic representative of the Namibian people“ zugesprochen bekam, wurde die parteiliche Zusammenarbeit von SED und SWAPO ab 1977 konkret. Auf ostdeutscher Seite setzte die Kooperation die seit 1960 bestehenden Arbeit des „Solidaritätskomitees für Afrika“ fort, das Teil des „Solidaritätskomitee der DDR“ war: einer Institution, die in Ersetzung eines eigenen Ministeriums für Entwicklungshilfe bzw. Entwicklungszusammenarbeit agierte und direkt abhängig vom ZK der SED war. Maßnahmen bestanden in der Aussendung von DDR-Fachkräften zur Unterstützung der afrikanischen Befreiungsbewegungen und zum Aufbau von Infrastrukturen, mit Blick auf Namibia zum Beispiel der Bau von Schulen und anderen Einrichtungen in Flüchtlingslagern in Sambia und Angola (dort etwa Kwanza Sul, über das Jürgen Leskien in seiner Romanreportage Shilumbu berichtet). In umgekehrte Richtung wurden junge Afrikanerinnen und Afrikaner in der DDR ausgebildet oder erhielten Studienplätze: Namibier etwa als Schlosser im Schweriner Plastmaschinenwerk.
 Die bekannteste, weil nach dem Ende der DDR von gleich mehreren Publizisten aufgegriffene Form der Zusammenarbeit war die Verbringung von namibischen Kindern nach Bellin in Mecklenburg und später Staßfurt in Sachsen-Anhalt, die im Sommer 1978 nach einem verheerenden südafrikanischen Luftangriff auf das Flüchtlingslager Cassinga in Sambia auf Initiative der SWAPO mit Vertretern des SED-Establishments eingefädelt worden war. Zwischen 1979 und 1989 gelangten insgesamt sechs Kohorten mit rund 430 Kindern in die DDR, die von namibischen Erzieherinnen begleitet wurden. Die jüngsten von ihnen waren im dritten Lebensjahr; die Älteren von ihnen wurden von ostdeutschen Lehrkräften beschult. Unterrichtssprache war Deutsch, das sich die Kinder verblüffend rasch aneigneten und in der Folge sogar eine „Geheimsprache“ entwickelten, einen Mix aus Deutsch und ihrer Muttersprache Oshiwambo, den weder die namibischen noch die DDR-Erwachsenen verstanden und dem sie im Nachhinein augenzwinkernd den Namen „Oshideutsch“ gaben.
Die bekannteste, weil nach dem Ende der DDR von gleich mehreren Publizisten aufgegriffene Form der Zusammenarbeit war die Verbringung von namibischen Kindern nach Bellin in Mecklenburg und später Staßfurt in Sachsen-Anhalt, die im Sommer 1978 nach einem verheerenden südafrikanischen Luftangriff auf das Flüchtlingslager Cassinga in Sambia auf Initiative der SWAPO mit Vertretern des SED-Establishments eingefädelt worden war. Zwischen 1979 und 1989 gelangten insgesamt sechs Kohorten mit rund 430 Kindern in die DDR, die von namibischen Erzieherinnen begleitet wurden. Die jüngsten von ihnen waren im dritten Lebensjahr; die Älteren von ihnen wurden von ostdeutschen Lehrkräften beschult. Unterrichtssprache war Deutsch, das sich die Kinder verblüffend rasch aneigneten und in der Folge sogar eine „Geheimsprache“ entwickelten, einen Mix aus Deutsch und ihrer Muttersprache Oshiwambo, den weder die namibischen noch die DDR-Erwachsenen verstanden und dem sie im Nachhinein augenzwinkernd den Namen „Oshideutsch“ gaben.
Für diese Maßnahme liegt ein genaueres Bild über die tragende Rolle staatsparteilicher Institutionen und Personen vor. Susanne Timm veröffentlichte im Jahr 2007 eine minutiöse Rekonstruktion der „Parteilichen Bildungszusammenarbeit“ von SWAPO und SED, der zehnjährigen Dauer dieser humanitär-pädagogischen Initiative und ihres Verlauf. Die Sichtung der Berichte von Informellen Mitarbeitern (die heute als Dokumente hinterlegt sind beim Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR) und von Materialien im Bundesarchiv belegt beispielsweise die Anbahnung der Zusammenarbeit. So trat am 18. April 1979 der SWAPO-Sekretär für Bildung, Linkela Kalenga, an die Ministerin für Volksbildung der DDR, Margot Honecker, heran mit dem Wunsch nach sicherer Unterbringung der Kinder in der DDR. Der Gegenbitte, dieses Anliegen möge der Einfachheit halber vom Zentralkomitee der SWAPO an das der SED herangetragen werden, kommt der SWAPO-Vorsitzende und spätere erste Staatspräsident des unabhängigen Namibia, Sam Nujoma, persönlich im Juni desselben Jahres nach. Was folgt, sind Durchleitungen des rasch herbeigeführten, entsprechenden Beschlusses an das für die Aufnahme der namibischen Kinder ausgewählte Kinderheim Bellin, dazu eilig eingefädelte Vorbereitungen pädagogischer Art, Kontrollberatungen der involvierten Kader und eine letzte Abstimmung mit der namibischen Seite in Angola. Kurz vor Weihnachten 1979 trifft die erste Kohorte afrikanischer Kinder in Bellin ein.

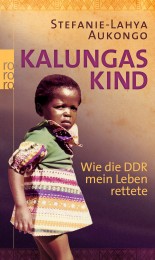 Es gibt jede Menge verschriftlichte Erinnerungen an diese Zeit. Manche sind tatsächlich verfasst von den Kindern von damals, andere wurden mit Hilfe von Ghostwritern für den nun einheitsdeutschen Buchmarkt getrimmt. Die authentischsten O-Töne finden sich bis heute in Die „DDR-Kinder“ von Namibia. Heimkehrer in ein fremdes Land von Constance Kenna aus dem Jahr 1999. Die bekanntesten Memoiren sind jedoch die von Lucia Engombe („aufgezeichnet“ von Peter Hilliges): Kind Nr. 95. Meine deutsch-afrikanische Odyssee. Beachtenswert sind auch die Erinnerungen von Stefanie Lahya Aukongo, Kalungas Kind, die nicht in Bellin und später Staßfurt beschult wurde, sondern mit ihrer schwer erkrankten Mutter in die DDR gelangte und eine Ostberliner Pflegefamilie aus dem Kadermilieu der SED fand, die ihr auch nach dem Ende der DDR verbunden geblieben ist. Es ist schwer bis unmöglich, das ebenfalls durch Hilliges‘ Filter einer „Aufzeichnung“ getriebene Hohelied Stefanie Lahya Aukongos auf die DDR (und insbesondere Margot Honecker) nicht als Ausdruck aufrichtiger Dankbarkeit für die natürlich gewollt anti-imperialistische und politisch kalkulierte, zugleich jedoch humanitäre Intervention der SED, hier als pars pro toto für die DDR, zugunsten namibischer Individuen zu lesen.
Es gibt jede Menge verschriftlichte Erinnerungen an diese Zeit. Manche sind tatsächlich verfasst von den Kindern von damals, andere wurden mit Hilfe von Ghostwritern für den nun einheitsdeutschen Buchmarkt getrimmt. Die authentischsten O-Töne finden sich bis heute in Die „DDR-Kinder“ von Namibia. Heimkehrer in ein fremdes Land von Constance Kenna aus dem Jahr 1999. Die bekanntesten Memoiren sind jedoch die von Lucia Engombe („aufgezeichnet“ von Peter Hilliges): Kind Nr. 95. Meine deutsch-afrikanische Odyssee. Beachtenswert sind auch die Erinnerungen von Stefanie Lahya Aukongo, Kalungas Kind, die nicht in Bellin und später Staßfurt beschult wurde, sondern mit ihrer schwer erkrankten Mutter in die DDR gelangte und eine Ostberliner Pflegefamilie aus dem Kadermilieu der SED fand, die ihr auch nach dem Ende der DDR verbunden geblieben ist. Es ist schwer bis unmöglich, das ebenfalls durch Hilliges‘ Filter einer „Aufzeichnung“ getriebene Hohelied Stefanie Lahya Aukongos auf die DDR (und insbesondere Margot Honecker) nicht als Ausdruck aufrichtiger Dankbarkeit für die natürlich gewollt anti-imperialistische und politisch kalkulierte, zugleich jedoch humanitäre Intervention der SED, hier als pars pro toto für die DDR, zugunsten namibischer Individuen zu lesen.
 Stefanie Lahya Aukongo (wird) inszeniert (als) Ostalgie, könnte man einwenden. Verwerflich ist das nicht: zumindest nicht für und als das Kind, das sie in der DDR war. Auch andere damals sehr junge Namibier lassen sich heute noch in T-Shirts ablichten, auf denen Hammer und Sichel zu erkennen sind: Es wirkt wie ein Versuch der nachträglichen Selbstermächtigung über die Insignien eines verlustig gegangenen Landes, nachdem zu der Zeit, als es mit eben diesem Land zu Ende ging, kaum jemand auf ihre Stimmen und Bedürfnisse Rücksicht nahm. Das Ende ihres Exils in Ostdeutschland wurde von erwachsenen Polit- und Parteivertretern über ihre Köpfe hinweg beschlossen. Auf namibischer Seite fädelten es 1990 SWAPO-Mitglieder ein, die bereits in Regierungs-Amt und –würden gesetzt waren. Auf deutscher Seite waren es die unterschriftsberechtigten Abwickler der DDR, die nur noch selten identisch waren mit den SED-Kadern von vorher.
Stefanie Lahya Aukongo (wird) inszeniert (als) Ostalgie, könnte man einwenden. Verwerflich ist das nicht: zumindest nicht für und als das Kind, das sie in der DDR war. Auch andere damals sehr junge Namibier lassen sich heute noch in T-Shirts ablichten, auf denen Hammer und Sichel zu erkennen sind: Es wirkt wie ein Versuch der nachträglichen Selbstermächtigung über die Insignien eines verlustig gegangenen Landes, nachdem zu der Zeit, als es mit eben diesem Land zu Ende ging, kaum jemand auf ihre Stimmen und Bedürfnisse Rücksicht nahm. Das Ende ihres Exils in Ostdeutschland wurde von erwachsenen Polit- und Parteivertretern über ihre Köpfe hinweg beschlossen. Auf namibischer Seite fädelten es 1990 SWAPO-Mitglieder ein, die bereits in Regierungs-Amt und –würden gesetzt waren. Auf deutscher Seite waren es die unterschriftsberechtigten Abwickler der DDR, die nur noch selten identisch waren mit den SED-Kadern von vorher.
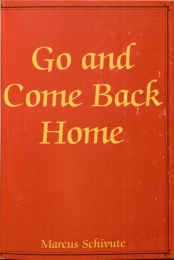 Perspektivwechsel: Namibia und die Volksrepublik Polen
Perspektivwechsel: Namibia und die Volksrepublik Polen
Eine vergleichbare Forschung zur bildungspolitischen Kooperation von SED und SWAPO gibt es für den Bereich der staatsparteilich initiierten Zusammenarbeit der Volksrepublik Polen mit den Befreiungsbewegungen im südlichen Afrika nicht. Anhaltspunkte über polnische Initiativen für namibische Individuen liefern aber zwei liberation strugglers, die nach 1990 in Ministerämter im nunmehr unabhängigen Namibia bekleideten und 1997 beziehungsweise 2012 ihre Erinnerungen an die Zeit des Befreiungskampfes verschriftlicht haben: Marcus Shivute, dessen Memoiren den programmatischen Titel Go and Come Back Home tragen, und Libertina Amathilas Making a Difference. Beide Titel erschienen in renommierten namibischen Verlagen, Gamsberg Macmillan und dem Universitätsverlag UNAM Press.
 Marcus Shivutes und Libertina Amathilas polnischen Lebensabschnitte setzen deutlich früher ein als die der namibischen „DDR-Kinder“. Beide waren von Dezember 1962 bis 1969 Studierende der Medizin in Łódż, Warschau und Kraków. Ermöglicht wurde ihnen das Studium durch „United Nations scholarships“, wie es bei Marcus Shivute heißt, was anders als bei der SED-SWAPO-Kooperation auf keinen primär parteipolitischen, sondern von der Weltorganisation initiierten Hintergrund ihres Aufenthalts in Polen schließen lässt. Die Erinnerungen beider zeichnen ein so interessantes wie aufmerksam beobachtetes Bild der damaligen Zustände und Realitäten in der Volksrepublik Polen. Zur Sprache kommen die Herausforderungen des Erwerbs der polnischen Sprache, einer conditio sine qua non für ihr erfolgreiches Studium, und der Kalte Krieg, der ihnen in ihrem besonderen Alltag als afrikanische Stipendiaten nicht verborgen bleibt (etwa wenn westafrikanische Kommilitoninnen sich auf Initiative der US-Botschaft in Warschau für einen Studienortwechsel nach West-Berlin überreden lassen). Hinzu kommen eher banale Dinge wie ihre Freizeitgestaltung: Marcus Shivute verbringt einen Winterurlaub in den Karpaten und lässt sich dort von einem Polen im Eisbärkostüm auf den Arm nehmen.
Marcus Shivutes und Libertina Amathilas polnischen Lebensabschnitte setzen deutlich früher ein als die der namibischen „DDR-Kinder“. Beide waren von Dezember 1962 bis 1969 Studierende der Medizin in Łódż, Warschau und Kraków. Ermöglicht wurde ihnen das Studium durch „United Nations scholarships“, wie es bei Marcus Shivute heißt, was anders als bei der SED-SWAPO-Kooperation auf keinen primär parteipolitischen, sondern von der Weltorganisation initiierten Hintergrund ihres Aufenthalts in Polen schließen lässt. Die Erinnerungen beider zeichnen ein so interessantes wie aufmerksam beobachtetes Bild der damaligen Zustände und Realitäten in der Volksrepublik Polen. Zur Sprache kommen die Herausforderungen des Erwerbs der polnischen Sprache, einer conditio sine qua non für ihr erfolgreiches Studium, und der Kalte Krieg, der ihnen in ihrem besonderen Alltag als afrikanische Stipendiaten nicht verborgen bleibt (etwa wenn westafrikanische Kommilitoninnen sich auf Initiative der US-Botschaft in Warschau für einen Studienortwechsel nach West-Berlin überreden lassen). Hinzu kommen eher banale Dinge wie ihre Freizeitgestaltung: Marcus Shivute verbringt einen Winterurlaub in den Karpaten und lässt sich dort von einem Polen im Eisbärkostüm auf den Arm nehmen.
 Auffällig ist ihre ausnehmend wohlwollende Einschätzung der Bevölkerung: „Poles are amongst the nicest people in Europe. I certainly became a better person living amongst them“, heißt es bei Amathila: „They treated me very well and looked after me. If I went to buy meat from the butcher I would be given an extra piece of sausage, and I began to feel at home in Poland”. Zum Alltag gehört auch Überraschendes, etwa die Benennung ihrer Sprachschule in Łódż nach Patrice Lumumba, dem 1961 ermordeten ersten Premierminister des unabhängigen Kongo. Vor allem Shivute ist es, der im Rückblick deutlich auf die ideologische Grundierung des Alltags in Polen achtet und auf Zwischentöne bei der Begegnung mit seinen polnischen Mitmenschen eingeht:
Auffällig ist ihre ausnehmend wohlwollende Einschätzung der Bevölkerung: „Poles are amongst the nicest people in Europe. I certainly became a better person living amongst them“, heißt es bei Amathila: „They treated me very well and looked after me. If I went to buy meat from the butcher I would be given an extra piece of sausage, and I began to feel at home in Poland”. Zum Alltag gehört auch Überraschendes, etwa die Benennung ihrer Sprachschule in Łódż nach Patrice Lumumba, dem 1961 ermordeten ersten Premierminister des unabhängigen Kongo. Vor allem Shivute ist es, der im Rückblick deutlich auf die ideologische Grundierung des Alltags in Polen achtet und auf Zwischentöne bei der Begegnung mit seinen polnischen Mitmenschen eingeht:
Though the communist party and its presidium (government) led by the party Secretary-General, Mr Gomulka, was loyal to socialism and the communist party in the Kremlin (Moscow), the ordinary people were anti-socialist, although they would never criticize the communist party and its government openly. No free press, free association or free movement was allowed then. However, we kept at our studies and as far a distance from politics as possible, although marxist-leninist theory and dialectics were taught to us as a compulsory subject.
Auch die vergleichsweise privilegierten namibischen Studierenden erfuhren Repressionen. Zwar nutzen sie die mit ihrem UNO-Stipendium verbundene Reisefreiheit zu Aufenthalten inklusive Studentenjobs in Westdeutschland, den Niederlanden und Skandinavien, doch eine Reise nach Kiew wird Shivute verwehrt: „I suspect that my travel documents, which revealed that I travelled extensively to Western Europe, prevented that I ever get a visa to enter the Soviet Union.“
Unterm Strich bleiben für Amathila und Shivute ihre Jahre in Polen vor allem aus einem Grund in (guter) Erinnerung: Hier erlangten sie 1969 ihre Doktortitel, Shivute in Kraków an der an der Jagiellonen-Universität, Amathila in Warschau. „This meant“, kommentiert Shivute, „that the two of us were the first SWAPO members to finish medicine and become doctors – how proud I was! The two of us were – and still are – open to challenge in the claim that we were truly the first black Namibians to complete a degree in medicine”. Dem Superlativ der ersten diplomierten schwarzen Mediziner Namibias, auf den Shivute hier stolz verweist, setzt Amathila sogar noch einen drauf, denn umgekehrt sei sie „the first African woman to graduate as a medical doctor in Poland“.
Dass damit eine Erfolgsstory auf Gegenseitigkeit geschrieben wurde, wird deutlich und informiert nicht zuletzt Amathilas ausgesprochen zugewandte Schilderung des Alltags im kommunistischen Polen der 1960er Jahre: „I was Poland’s success story“, klopft sie sich noch einmal auf die eigene Schulter, „the first black woman to qualify as a medical doctor at the prestigious Academia Medyczna Warszawa“.
Entsprechend vorsichtig sollte man bei der Beurteilung der Texte auf ihre Aussagekraft für die Bewertung der von Staatsseite ansonsten streng reglementierten Möglichkeiten des Studiums in der Volksrepublik Polen sein. Was ihre Authentizität insbesondere mit Blick auf das Alltagsleben angeht, überzeugen die Memoiren deutlich mehr: auch, weil sie einander ergänzen und damit gegenseitig Substanz und Wahrhaftigkeitsanspruch verleihen.
Statt eines Fazits: Ein deutsch-polnisch-namibisches Projekt?
Trotz aller Unterschiede, trotz der Lücken bei der Bestandsaufnahme und der Heterogenität der hier wiedergegebenen Materialien, und sozusagen als call for action: Die publizierten (vulgo „entdeckten“) Lebensgeschichten von Namibiern und das unterschiedlich intensiv gesichtete Archivmaterial zur Volksrepublik Polen und der DDR über ihre jeweiligen Engagements für die Entkolonialisierungsbewegungen im südlichen Afrika im Zeitraum von 1960 bis 1989 lassen sich zusammenführen. Das bereits erforschte, aber längst nicht zur Gänze ausgeleuchtete ostdeutsche Namibia-Engagement könnte als Vergleichsfolie für andere Verlustzonen-Recherchen zu afrikanische Alltagserfahrungen in staatsparteilich organisierten, kommunistischen Gemeinwesen wie dem der Volksrepublik Polen dienen. Formen, Formate und Fördermöglichkeiten gäbe es zur Genüge, alleine im wissenschaftlichen Bereich böten sich Kooperationen über deutsch-polnische (Wissenschafts-)Stiftungen, Akademische Auslandsdienste, Goethe- oder Poleninstitute an. Charmant wären auch andere Darstellungs- und Textsorten als die wissenschaftliche mit ihren Konventionen und einer stark gesellschaftsausschnitthaften Zielgruppe. Literarische oder filmische zum Beispiel. Mazurka, Gomułka, Medizin, Morenga, oder: Am Ende der Sonnenallee lag das unabhängige Namibia.
Bruno Arich-Gerz beschäftigt sich seit einem Dutzend Jahren mit den Kulturen, Literaturen und Sprachen Namibias. Er war DAAD-Kurzzeitdozent an der University of Zimbabwe in Harare und sitzt im Advisory Board des Journal of Namibian Studies. History – Politics – Culture (JNS). Seit 2012 schreibt er für CulturMag.











