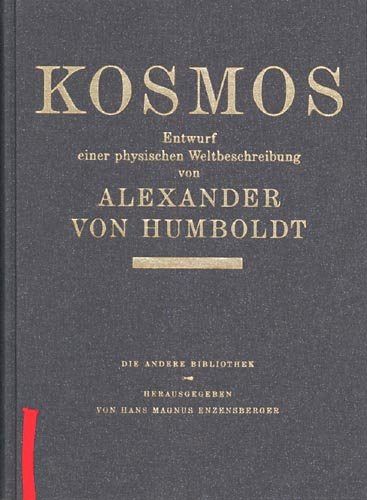
Von der Erd– zur Weltbeschreibung
Alexander von Humboldts „KOSMOS“ – Ein Essay von Markus Pohlmeyer
Lesehinweis der Redaktion: Zu Alexander von Humboldt siehe auch in „Naturbücher, kurz“ den bibliophilen Band „Tierleben“ und die Graphic Novel von Andrea Wulf und Lillian Melcher „Die Abenteuer des Alexander von Humboldt“.

In einem seiner Kosmosvorträge schilderte Alexander von Humboldt Tiere des Mesozoikums: mit Staunen und Wundern beispielsweise die Größe des Megalosaurus oder die Lebensweise von Plesiosaurus. Und hochinteressant: „Ferner schuppige Eidechsen mit Flügeln, wie die in den Steinbrüchen von Aichstedt gefundene berühmte fliegende Amphibie […].“[1] Megalosaurus war nicht wirklich groß im Vergleich zu Tyrannosaurus rex oder den gigantischen Sauropoden; Plesiosaurier lebten vermutlich anders und Archaeopteryx war keine Amphibie, sondern wäre so zu klassifizieren: „Dinosauria: Saurischia: Theropoda: Maniraptora: Avialae.“[2] Michael J. Benton stellt die wissenschaftliche Aufarbeitung dieses vielleicht berühmtesten Fossils in seinem Buch „Dinosaurs Rediscovered“ unter der Überschrift „Are birds living dinosaurs?“ vor; und es wird dabei deutlich, welch langer Weg es paläontologisch war, die Frage überhaupt zu stellen und zu diskutieren, ob unsere heutigen Vögel lebende Dinosaurier sind/seien.[3]


Was zeichnet A. v. Humboldt aus? Nicht so sehr, dass er – wie wir heute auch – an den aktuellen Stand der Wissenschaft gebunden war (diesen aber auch fortentwickelte), sondern vielmehr: „Gegen das Denken in Systemen und Schematismen, gegen eine Kultur, die ihre Fehler im System nicht einzugestehen vermag, setzte Alexander von Humboldt ein Schreiben, für das jedes Ende ein neuer Beginn ist, ein Denken, das die Fehler im System produktiv macht, und eine Bewegung, die auf das Glück setzt, niemals anzukommen. Diese Epistemologie, dieses Mobile des Wissens aber ist eine Lebenskunst.“[4] Und darum möchte ich auch hier die „Dimensionen der Humboldtschen Wissenschaft“ nach Ottmar Ette kurz zusammenfassen, die sich geradezu gegenläufig zum universitären Bologna-Prozess und seinen Modulkatalogen lesen lassen. Alexander von Humboldts Denken und Forschen, Schreiben und Vortragen könnten Modellcharakter für eine moderne Universität haben. Ette beschreibt Humboldts Wissenschaftsverständnis als transdisziplinär, interkulturell, kosmopolitisch und transareal.[5] Hinzukomme eine weltweite, netzwerkartige Briefkorrespondenz.[6] Und wissenschaftspolitisch hochbrisant: „Gerade mit Blick auf die unermüdlichen Bemühungen des Verfassers des Kosmos ließe sich sagen, daß eine Wissenschaft, die ihr Wissen nicht in die Gesellschaft schafft, ihre gesellschaftliche Verantwortung und Bringschuld verkennt und zumindest mittelfristig mit schuld ist, wenn die Gesellschaft sie um ihre Mittel bringt.“[7]Und zudem verknüpfe Humboldt „[…] Intermedialität, Transmedialität und Ästhetik auf beeindruckende Weise […]. Die Humboldtsche Wissenschaft ist eine sinnliche Wissenschaft, die noch heute das Lesepublikum in ihren Bann zu ziehen vermag.“[8] Gerne lerne ich auch immer wieder mit Humboldts graphischen Werk die Natur sehen, wie er sie gesehen hat: von einem Schmetterling hin zu Gebirgen.[9]

Und jetzt zurück zum Plesiosaurus, der so narrativ rekonstruiert wird: „[…] ein großes Krokodill mit einem Schwanenhalse, der fast die halbe Länge des Körpers ausmacht. Wir müssen uns denken, daß die gefährliche Thier am Ufer gelegen, und von da aus mit dem langen Hals seine Beute erhascht habe.“[10] Für einen Moment imaginiert uns Humboldt zurück in das Mesozoikum (Jura), so als wäre er der Expeditionsleiter durch eine vergessene, nun wieder entdeckte Welt. Und ein vorsichtiger Erzähler ist er, denn er benutzt den Konjunktiv.[11] Humboldt evoziert aber auch einen inneren Zusammenhang: Der Archaeopteryx scheint wie ein Vogel, der Plesiosaurier wie ein Krokodil mit Schwanenhals. Charles Darwins späteres Konzept von Evolution lässt sich hier schon erahnen.[12]
„Der fraktalen Geometrie der Natur entspricht bei Alexander von Humboldt eine fraktale Geometrie des Schreibens wie der wissenschaftlichen Modellbildung insgesamt. In jedem Teil ist das Ganze präsent.“[13]Dies wird schon in der Vorrede zum KOSMOS deutlich, in dem Humboldt am Beispiel einer neu und anders verstandenen Botanik seinen Weg von der Erd- zur Weltbeschreibung skizziert:
„Was mir den Hauptantrieb gewährte, war das Bestreben die Erscheinungen der körperlichen Dinge in ihrem allgemeinen Zusammenhange, die Natur als ein durch innere Kräfte belebtes und bewegtes Ganze aufzufassen. […] Die beschreibende Botanik, nicht mehr in den engen Kreis der Bestimmung von Geschlechtern und Arten festgebannt, führt den Beobachter, welcher ferne Länder und hohe Gebirge durchwandert, zu der Lehre von der geographischen Vertheilung der Pflanzen über den Erdboden nach Maaßgabe der Entfernung vom Aequator und der senkrechten Erhöhung des Standortes. Um nun wiederum die verwickelten Ursachen dieser Vertheilung aufzuklären, müssen die Gesetze der Temperatur-Verschiedenheit der Klimate wie der meteorologischen Processe im Luftkreise erspähet werden. […] Der bisher unbestimmt aufgefaßte Begriff einer physischen Erdbeschreibung ging so durch erweiterte Betrachtung, ja nach einem vielleicht allzu kühnen Plane, durch das Umfassen alles Geschaffenen im Erd- und Himmelsraume in den Begriff einer physischen Weltbeschreibung über. […] Ein Versuch, die Natur lebendig und in ihrer erhabenen Größe zu schildern, in dem wellenartig wiederkehrende Wechsel physischer Veränderlichkeit das Beharrliche aufzuspüren, wird daher auch in späteren Zeiten nicht ganz unbeachtet bleiben.“[14]
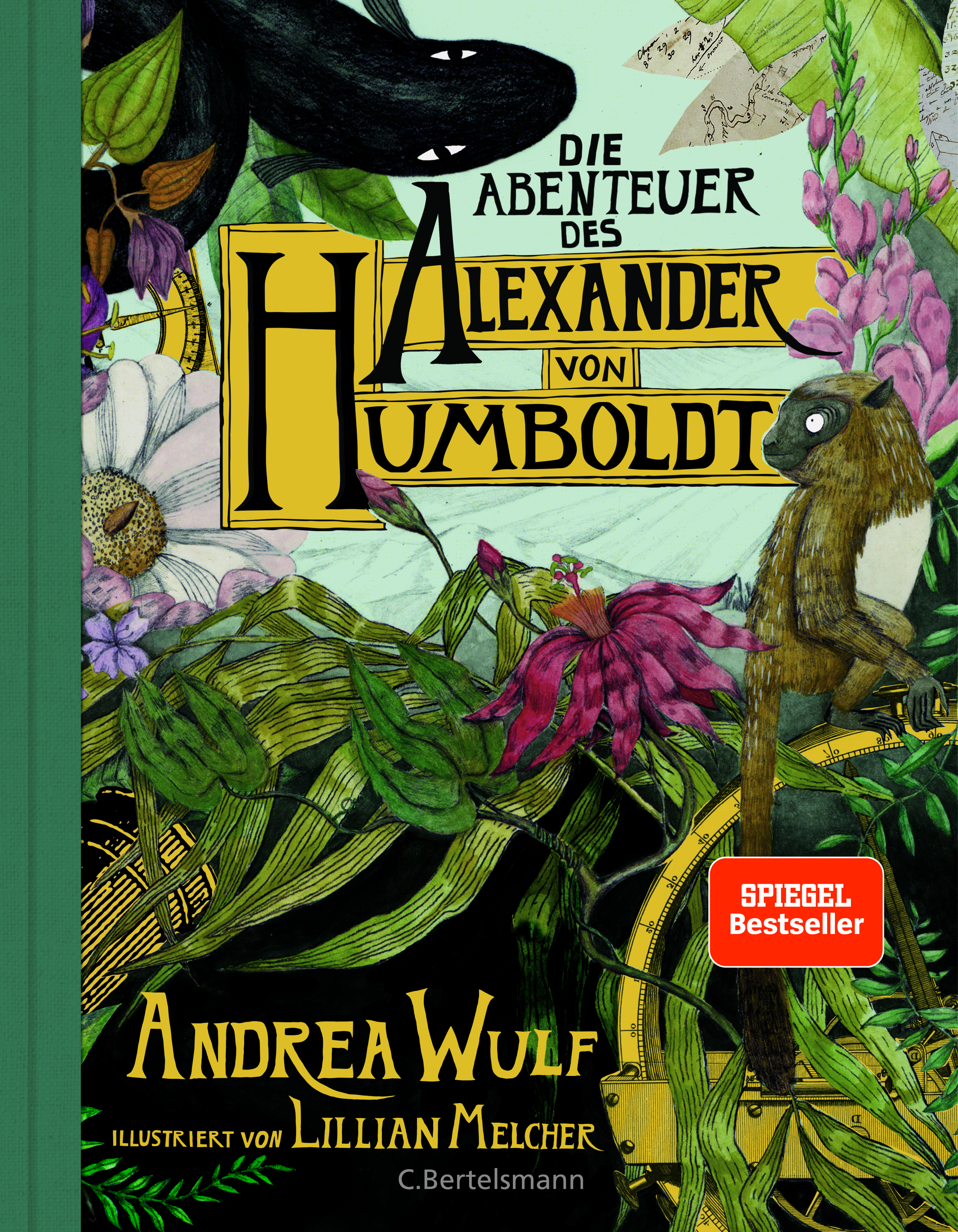
Abschließende Empfehlung
Lesen Sie bitte Humboldt einmal laut – eingedenk der rhetorischen Figuren und der rhythmischen Gestaltung. Mein Vorschlag, exemplarisch (in Klammern meine Kommentare):
Ein Versuch, (Beginn eines Hyperbatons bis wird; Bauplan für einen Essay?)
die Natur lebendig (fraktales Schreiben, gegen Schematismen)
und (syndetisch)
in ihrer erhabenen Größe zu schildern, (Einfluss von Kant?)
in dem wellenartig wiederkehrende Wechsel (asyndetisch; Alliteration)
physischer Veränderlichkeit das (Zeilensprung und Spannungspause)
Beharrliche aufzuspüren, (Antithese; lebenslanges Forschen)
wird daher auch in (Repetitio von in; antizipierte Rezeption)
späteren Zeiten nicht ganz unbeachtet bleiben.[15](Litotes und prosarhythmische Klausel: Daktylus + Trochäus + Doppelspondeus + Ditrochäus)
Markus Pohlmeyer lehrt an der Europa-Universität Flensburg. Seine vielfältigen Texte bei CulturMag hier.
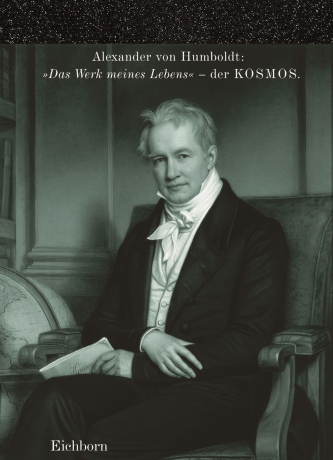
Humboldts fünfbändiges Werk Kosmos – Entwurf einer physischen Weltbeschreibung, in dem er eine Gesamtschau der wissenschaftlichen Welterforschung zu vermitteln suchte – „die Erscheinung der körperlichen Dinge in ihrem Zusammenhange, die Natur als durch innere Kräfte bewegtes und belebtes Ganzes“ – erschien 1845 bis 1862.
Herausgegeben von Hans Magnus Enzensberger, ediert und mit einem Nachwort versehen von Ottmar Ette und Oliver Lubrich, erschien eine 944seitige Ausgabe im September 2004 als Sonderband der Anderen Bibliothek – d. Red.
[1]A. v. Humboldt: Über das Universum. Die Kosmosvorträge 1827/28 in der Berliner Singakademie, hg. v. J. Hamel u.a., Frankfurt am Main u. Leipzig 1993, 82. Siehe bitte auch Markus Pohlmeyer: Theodor Fontane, die „Gräber der Humboldts“ und die Säkularisierung, in CulturMag, Okt. 2016, Zugriff am 4.10.2016.
[2]M. J. Benton: Dinosaurs Rediscovered. The Scientific Revolution in Paleontology, London 2019, 113.
[3]Siehe dazu Benton: Dinosaurs (s. Anm. 2), 110-115.
[4]O. Ette: Alexander von Humboldt und die Globalisierung. Das Mobile des Wissens, Frankfurt am Main u. Leipzig 2009, 408. Siehe dazu auch C. Rovelli: Und wenn es die Zeit nicht gäbe? Meine Suche nach den Grundlagen des Universum, übers. v. M. Niehaus, Hamburg 2018, 75: „Die größte wissenschaftliche Entdeckung des 20. Jahrhunderts ist vielleicht ganz einfach die Tatsache, dass die Wissenschaft sich ‚täuschen‘ kann. Dass die Beschreibungen der Welt, die von der Wissenschaft entwickelt werden, in einem präzisen und verifizierbaren Sinne falsch sein können. Dass es daher mehrere Lesarten der Welt geben kann und man jede Lesart nur bis zu einem gewissen Punkt für wahr halten kann.“
[5]Siehe dazu Ette: Humboldt (s. Anm. 4), 17-19.
[6]Siehe dazu Ette: Humboldt (s. Anm. 4), 19 f.
[7]Ette: Humboldt (s. Anm. 4), 20.
[8]Ette: Humboldt (s. Anm. 4), 21.
[9]Siehe dazu Alexander von Humboldt: Das graphische Gesamtwerk, hg. v. O. Lubrich, 3. Aufl., Darmstadt 2016,
[10]Humboldt: Universum (s. Anm. 1), 82.
[11]Siehe dazu A. Schöne: Aufklärung aus dem Geist der Experimentalphysik. Lichtenbergsche Konjunktive, 3. Aufl., München 1993.
[12]„Denn nicht umsonst nannte Darwin in zwei Briefen vom 25.8. und 8.10.1845 an Charles Lyell den Autor des Kosmos‚a multiple man‘, ‚a wonderful man‘.“ Ette: Humboldt (s. Anm. 4), 359.
[13]Ette: Humboldt (s. Anm. 4), 22.
[14]A. v. Humboldt: KOSMOS. Entwurf einer physischen Weltbeschreibung, ediert u. m. e. Nachwort v. O. Ette – O. Lubrich, Frankfurt am Main 2004, 3-7 (aus der „Vorrede.“).
[15]Betonte Vokale unterstrichen.











