
Naturbücher, kurz
Kurzrezensionen von Ludwig Fischer (LuF), Johannes Groschupf (JG) und Alf Mayer (AM) zu:
Otl Aicher: gehen in der wüste
Frauke Bagusche: Das blaue Wunder – Warum das Meer leuchtet …
Henry Beston: Das Haus am Rand der Welt. Ein Jahr am großen Strand von Cape Cod
Arnulf Conradi: Zen und die Kunst der Vogelbeobachtung
Ludwig Fischer: Brennnesseln. Ein Portrait
Esther Gonstalla: Das Klimabuch. Alles, was man wissen muss, in 50 Grafiken
Karl-Heinz Göttert: Als die Natur noch sprach. Mensch, Tier und Pflanze vor der Moderne
Karl-Heinz Göttert (Hg.): „Es flüstern und sprechen die Blumen“
Jan Haft: Die Wiese
Sammy Hart: Ocean of Clouds
Chloe Hooper: the arsonist. A Mind on Fire
Alexander von Humboldt: Tierleben
Hygiene-Museum Dresden: Von Pflanzen und Menschen
Christopher Kemp: Die verlorenen Arten
John Lewis-Stempel: Ein Stück Land. Mein Leben mit Pflanzen und Tieren
John Lewis-Stempel: Mein Jahr als Jäger und Sammler
Barry Lopez: Horizon
Rita Mielke: Im Wald – Eine Wortwanderung durch die Natur
Julia Numßen: Handbuch Jägersprache
Rudi Palla: Unter Bäumen
Rebecca Solnit: Wanderlust. Eine Geschichte des Gehens
Horst Stern, Ernst Kullmann: Leben am seidenen Faden. Die rätselvolle Welt der Spinnen
David Wallace-Wells: Die unbewohnbare Erde. Leben nach der Erderwärmung
Don Watson: The Bush: Travels in the Heart of Australia
Andrea Wulf, Lillian Melcher: Die Abenteuer des Alexander von Humboldt
Henning Ziebtritzki: Vogelwerk.
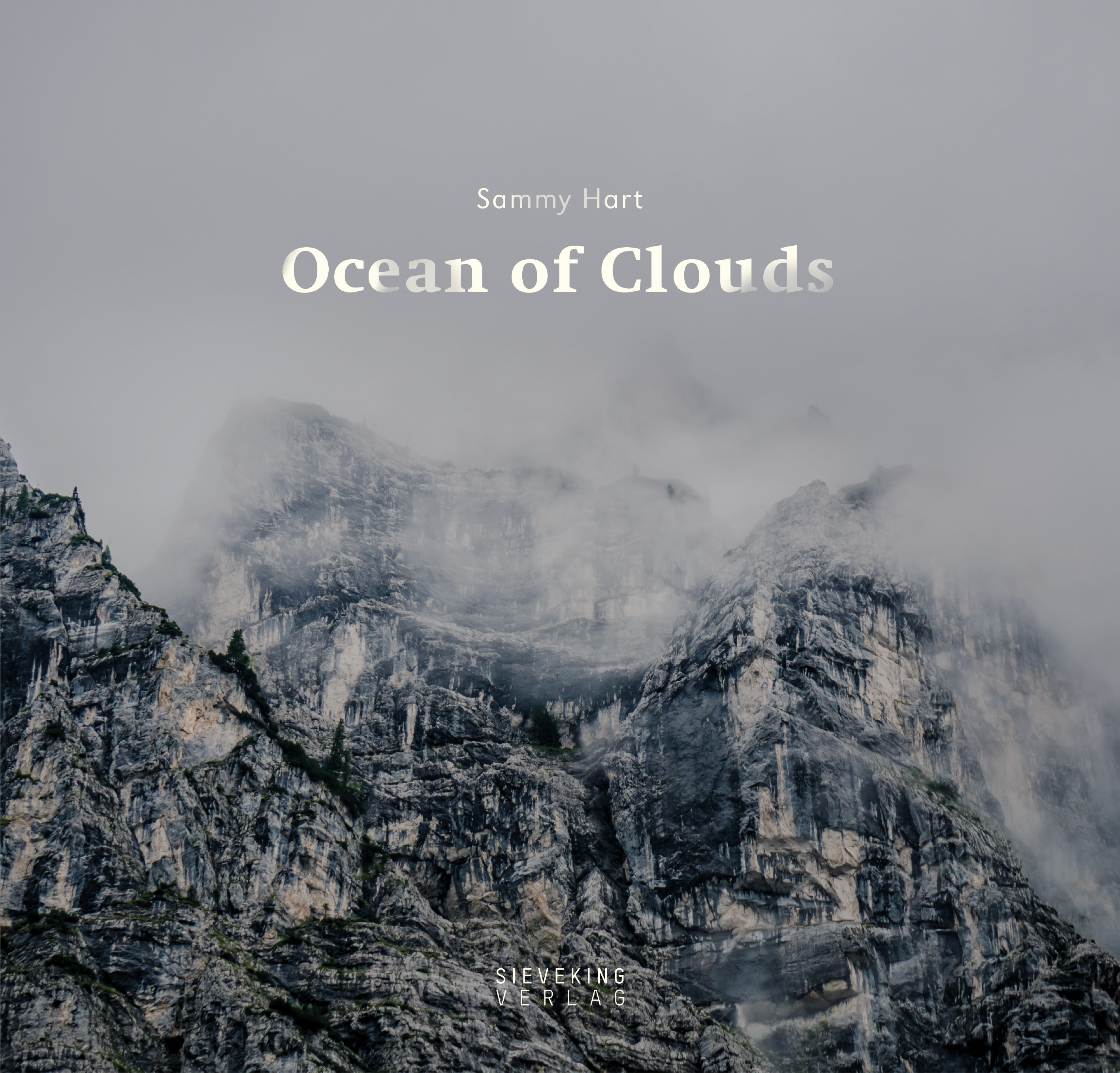
Wunderbar erzählter Bildband
(AM) Seit er 16 ist, geht der für seine Porträtaufnahmen bekannte Fotograf Sammy Hart mit der Kamera in die Berge, am liebstem bei wolkigem und wechselhaftem Wetter. Er weiß: Man geht nie zweimal auf denselben Berg. Für seinen exzellenten Bildband „Ocean of Clouds“ musste er nicht in die Ferne reisen. Seine Fotos stammen aus den Münchner Hausbergen im Ammergebirge, am Achensee, im Karwendel oder im Wettersteingebirge. Er fotografiert die Berge wie seine Porträts, nimmt alle Jahreszeiten, arbeitet den Charakter seiner Gegenüber heraus, nutzt Licht und Stimmungen, sucht die Poesie, glättet weder Schrammen noch Schrunden, zeigt auch Menschenspuren und Naturverbrauch auf Wanderwegen und Pisten. Auf diese Art bestehen auch Interieurs aus Berghütten neben Gebirgspanoramen und Landschaftsbildern, neben Pflanzen, Steinen, Felsen, Bachläufen, Schneefeldern, Herrgottswinkeln, Gipfelkreuzen, Tieren oder Nebelfetzen.

Das Fotobuch ist außerordentlich schön „erzählt“: Klug gesetzte Weißräume, Format- und Farbwechsel, wie aus dem Kino übernommene Einstellungsgrößen – Panorama, Totale, Halbtotale, Halbnah, Amerikanische, Nah, Groß, Detail – sowie ein sanft und beständig ins Wolkenreich ansteigender Rhythmus in den Bildstrecken vermitteln eine Seherfahrung, die im schönsten Sinn den Blick weitet. Ein „Weniger, das dich belohnt“, so der Fotograf. „Naturfotografie wird zu einer Erfahrung der Reduktion in einer Zeit des Überflusses.“
Ziemlich hinten im Buch findet sich – wie einem Märchen entstiegen – der hier eingangs zu sehende Schimmel in einer Mulde. Ebenfalls verzaubert hat mich eine hinter einem dickbemoosten Baum halb versteckte alte Frau, die in die Bergwelt schaut. Selbst mit zwei gebirgsfesten Onkeln groß geworden, die mich immer in die Allgäuer Bergwelt mitnahmen, ist dies eines der allerallerschönsten Bergbücher, die ich kenne.

Der Journalist und Autor Titus Arnu steuert einen sehr prägnanten Text über Naturfotografie bei. In Zusammenarbeit mit Enno Kapitza ist von ihm im gleichen Verlag der Bildband „Tsum Glück“ erschienen – eine Reise an den wohl friedlichsten Ort der Welt, mit ebenfalls atemberaubenden Fotografien. So viel Hinweis auf ein zweites Fotobuch muss in diesen Kurzbesprechungen sein.
- Sammy Hart: Ocean of Clouds. Mit einem Text von Titus Arnu. Sieveking Verlag, München 2019. Hardcover, Format 24 x 23 cm, 148 Seiten, etwa 100 Abbildungen, 45 Euro. Verlagsinformationen mit Blicken in das Buch.
- Titus Arnau, Enno Kapitza: Tsum Glück. Ein entlegenes Tal im Himalaya. Sieveking Verlag, München 2019. Hardcover, Schweizer Bindung, 240 Seiten, 140 Abbildungen, 55 Euro. Verlagsinformationen.

Humboldt als Tierforscher
(AM) Im Gegensatz zu Brehm hat Humboldt nie ein populärwissenschaftliches Tierleben geschrieben, stellt Sarah Bärtschi im Nachwort des wohl bibliophilsten Buches im Humboldt-Jubiläumsjahr fest. Tierepisoden aus seinem Gesamtwerk aber wurden in Zeitungen und Unterhaltungsblättern in großer Zahl nachgedruckt, dies auf fünf Kontinenten, etwa seine „Stories of Crocodiles“. Seine Beschreibung des Kampfes zwischen Zitteraalen und Pferden wurde zu seinen Lebzeiten über fünfzig Mal veröffentlicht.
Die Forschungsergebnisse, die Humboldt von seiner großen Amerikareise in den Jahren von 1799 bis 1804 mitbrachte, revolutionierten das damalige Wissen und den Blick der Alten auf die Neue Welt.
Der von Sarah Bärtschi vorzüglich editierte Band präsentiert erstmals 15 Tiertexte aus dem Gesamtwerk, die bisher so nicht zugänglich waren. Sie erschienen verstreut in Buchwerken oder als Aufsätze, Artikel, Essays und Briefe in Zeitungen und Zeitschriften. Humboldts Texte über die exotischen Tiere, die zuvor kein Europäer gesehen, geschweige denn beschrieben hatte, waren ein Meilenstein für die Zoologie. Manchmal sind sie fast moderne Reportage, auf jeden Fall aber Nature Writing pur.
Und erwähnt werden muss, dass es sich hier um einen besonders schönen Fall von Buchkunst pur handelt, gestemmt von der kleinen und edlen Friedenauer Presse, auch Papier und Schrift (Prillwitz) ein Fest. Die Verlagsseite gibt einen Eindruck. Gestaltet hat das Buch die Typografin und Grafikdesignerin Pauline Altmann, die seit 2013 gestaltet zusammen mit Judith Schalansky der bei Matthes & Seitz Berlin erscheinende Buchreihe „Naturkunden“ ein Gesicht gibt – großes CulturMag-Porträt der Reihe in unserem Special Verlust. 2014 und 2015 errang Pauline Altmann mit je einem Band aus der Reihe – „Insektopädie“ und „Wahre Monster“ – den Titel „Schönstes deutsches Buch“ der Stiftung Buchkunst. Das gehört nämlich auch zu Nature Writing: besonders schöne Bücher.
- Alexander von Humboldt: Tierleben. Herausgegeben und mit einem Nachwort von Sarah Bärtschi. Friedenauer Presse, Berlin 2019. Leinen, mit Farbtafeln und weiteren Abbildungen, 184 Seiten, 24 Euro.
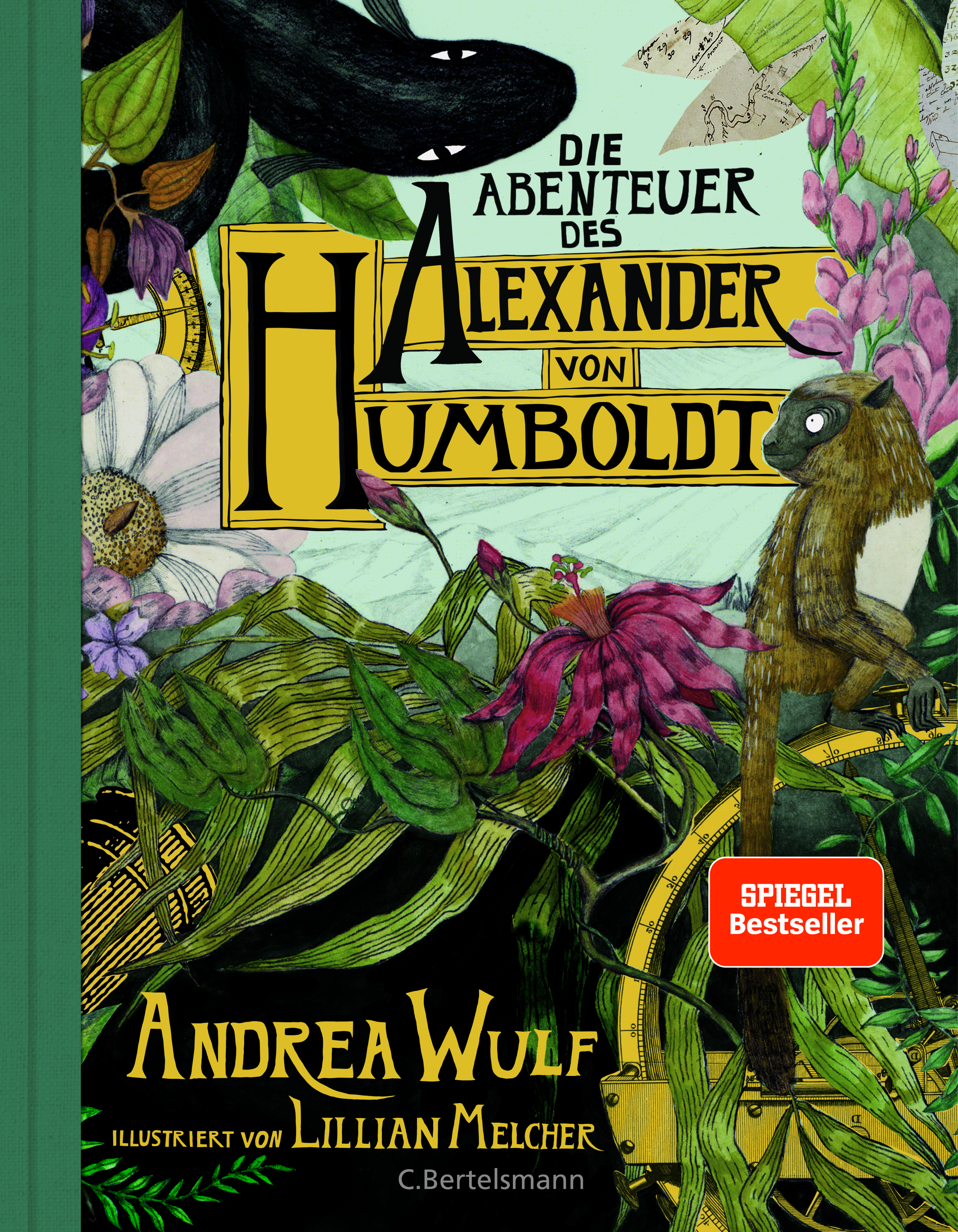
Spektakuläres Projekt
(AM) Sie ist ihm nachgereist, hat Berge erklommen, ist auf seinen Spuren durch tropische Flüsse gepaddelt, hat sich intensiv mit seinen Forschungen befasst und mehr als zehn Jahre ihres Lebens mit ihm verbracht. Die deutsch-britische Kunsthistorikerin Andrea Wulf hat 2016 mit „Alexander von Humboldt: Die Erfindung der Natur“ eine der pointiertesten Biografien des größten deutschen Naturforschers vorgelegt. Das Buch wurde vielfach preisgekrönt, 22 Auszeichnungen mindestens. Zum 250. Geburtstag Humboldts (am 14. September 1769) gibt es nun von ihr ein ganz besonderes Geschenk: eine Graphic Novel zur großen Lateinamerikareise in den Jahren 1799 bis 1804, verfasst zusammen mit der jungen New Yorker Illustratorin Lillian Melcher.
Die beiden Frauen ergänzen sich aufs Beste. „Lillian ist genauso ein Nerd wie ich“, meinte Andrea Wulf in einem Interview. Sie selbst sei auch ein visueller Mensch, habe sich bis 20 nicht entscheiden können, ob sie lieber malen oder schreiben wolle. So ist anhand Humboldts erst seit kurzer Zeit zugänglichen Tagebuchaufzeichnungen und angeregt von seinen Tagebüchern, Kupferstichen, Skizzen, Landkarten und präparierten Pflanzen eine höchst sinnliche Bildergeschichte entstanden. Ein spektakuläres Buchprojekt, eine illustrierte Entdeckungsreise in einer expressiven Mischung aus Zeichnung und Collage. Nur die Dialoge sind fiktiv. Eingefangen sind viele Szenen der Expedition, zum Beispiel die waghalsige Fahrt auf dem Orinoko oder die spektakuläre Besteigung des Chimborazo.
„Die Natur muss gefühlt werden“, schrieb Humboldt an seinen Freund Goethe. Zwar schleppte er 42 wissenschaftliche Instrumente quer durch Lateinamerika, betonte aber, dass im Umgang mit der Natur Gefühle gleichermaßen wichtig sind. Zahlen und Prognosen, meint Andrea Wulf, seien in der politischen Umweltdiskussion wichtig, keine Frage, aber eben auch die Erfahrung vom Zauber der Natur. Hierbei hilft dieses prächtige Buch. In Hitchcock-Manier haben die beiden Autorinnen darin einen kleinen Auftritt.
- Andrea Wulf: Die Abenteuer des Alexander von Humboldt (The Adventures of Alexander von Humboldt, 2019). Durchgängig farbig illustriert von Lillian Melcher. Übersetzt von Gabriele Werbeck. C. Bertelsmann Verlag, München 2019. Hardcover, Format 21 x 27 cm, 272 Seiten, 28 Euro.
Noch bis 19 April 2020
(AM) 2,4 Tiere, 70 Bakterien, 0,2 Viren, 7 Einzeller, 12 Pilze, aber 450 Pflanzen teilen sich im Mengenverhältnis ihren Platz auf der Erde. Pflanzen sind klar eine unterschätzte Spezies, mehr als 390.000 Arten von ihnen gibt es. Die von Kathrin Meyer kuratierte Ausstellung „Von Pflanzen und Menschen„ im Deutschen Hygienemuseum Dresden – noch bis 19. April 2020 besuchbar – will helfen, die Verhältnisse zurechtzurücken.

Das Leben auf dem grünen Planeten wird dabei von der Wurzel bis zur Blüte betrachtet und unserem Verhältnis zu Pflanzen auf den Grund gegangen. Die Würde des Kopfsalats ist Thema, ebenso das Gedächtnis der Kartoffel oder die Pflanze als geistiges Eigentum. Die Ausstellung ist in drei Kapitel unterteilt: Sie untersucht die kulturelle Aneignung der Pflanze als Objekt durch Künstler, Architekten, Autoren und Wissenschaftler, beschäftigt sich mit der Pflanze als Material und Rohstoff in Garten, Feld und Labor und betrachtet die Pflanze als Mit-Wesen, dessen Lebensbedingungen verstanden werden müssen, um Koexistenz und Diversität für die Zukunft bewahren zu können.
Natürlich kann ein Katalog keine Ausstellung ersetzen, der hier aber beinahe. Der im Göttinger Wallstein Verlag erschienene, äußerst appetitlich gestaltete flexible Leinenband ist ein ebenso haptisches wie visuelles und inhaltliches Vergnügen. Die darin aufgeblätterten Perspektiven sind interdisziplinär. Man schaut und staunt und lernt …
- Kathrin Meyer und Judith Elisabeth Weiss für das Deutsches Hygiene-Museum Dresden, (Hg.): Von Pflanzen und Menschen. Begleitband zur gleichnamigen Ausstellung im Deutschen Hygiene-Museum Dresden von April 2019 bis April 2020. Wallstein Verlag, Göttingen 2019. 232 Seiten, 64 farbige Abb., geb., Leinen, 24,90 Euro. Verlagsinformationen.
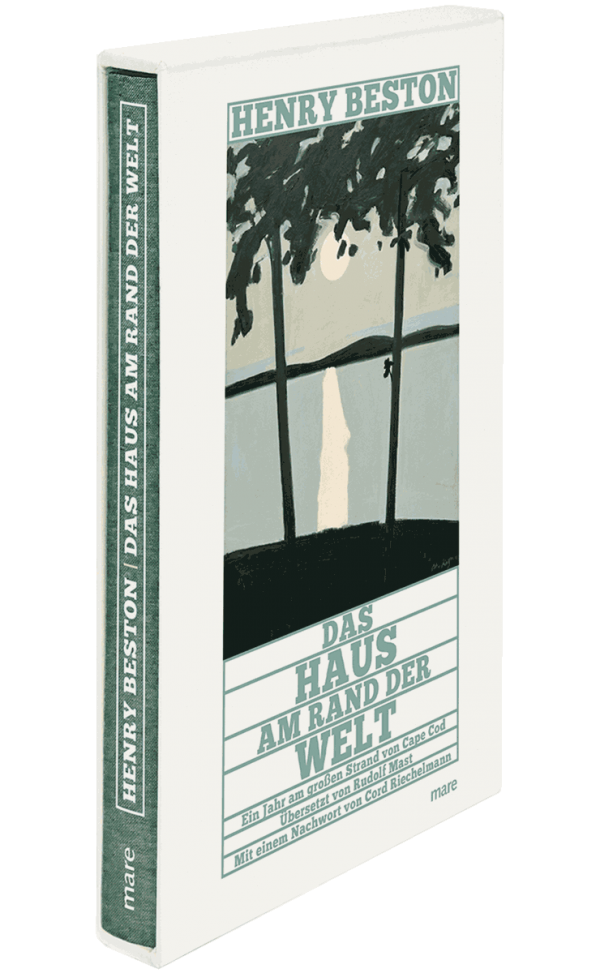
Acht Seiten nur über Brandungswellen
(LuF) Nach mehr als neunzig Jahren ist endlich das grandiose Buch von Henry Beston in deutscher Übersetzung erschienen! 1926 ließ sich der Schriftsteller und Journalist eine Hütte direkt am damals schon berühmten Strand von Cape Cod bauen, dem ›Außenposten‹ der USA zum Atlantik hin, kam für ein paar Wochen Urlaub – und blieb ein ganzes Jahr. Er arbeitete seine Aufzeichnungen über dieses Jahr zu einem Bericht aus, der sofort ein Nature Writing-Klassiker wurde und als literarisches Monument neben den Werken von Thoreau, Muir, Abbey, Lopez und Dillard steht.
Das Buch gliedert sich in einem großen Bogen nach dem Wechsel der Jahreszeiten in dem einen Jahr, das Beston an der Dünenkante in dem kleinen, hölzernen Haus verbrachte. Aber die einzelnen Kapitel setzen thematische Schwerpunkte: Gliederung und Aufbau der vorgeschobenen Landzunge von Cape Cod, Dünenvegetation und Veränderungen des Sandes, Ankunft und Abflug der Zugvögel, Alltagsroutine und Arbeit der Küstenwache, Wetterphänomene und Nachterfahrungen, Augenblicke der Einsamkeit und Austausch mit den Küstenbewohnern und vieles andere. Da schreibt einer, der ungeheuer genau beobachtet, der sich auskennt und über seine Erfahrungen nachdenkt, der nicht egozentrisch sein ‚Seelenleben’ ausbreitet, sondern der sich dem zuwendet, was die Sinne ihm an diesem extremen Ort erschließen.
Beston kann faszinierende acht Seiten nur über die Brandungswellen schreiben, die Stürme lebendig werden lassen – und auch die Strandungen der Segelschiffe, das Sterben der Schiffbrüchigen! –, er verschweigt Einsamkeit und Schrecken nicht. Ein Buch mit ›nichts anderem‹ als den Wahrnehmungen an einer exponierten Stelle im Angesichts des Meeres – und ein unvergleichliches literarisches Dokument.
- Henry Beston: Das Haus am Rand der Welt. Ein Jahr am großen Strand von Cape Cod (The Outermost House, 1928). Aus dem Amerikanischen von Rudolf Mast, Nachwort von Cord Riechelmann.
mare Verlag, Hamburg 2018. Leinenband im Schuber, 224 Seiten, 32 Euro.
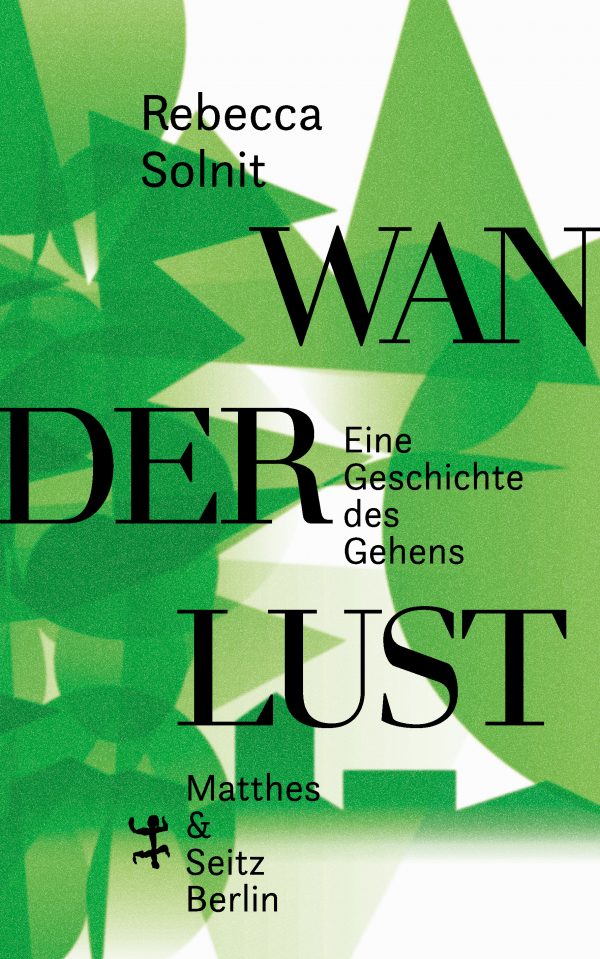
Zu Fuß kann man besser schauen
(AM) Rebecca Solnits Geschichte des Gehens durchschreitet viele Felder: Anatomie, Architektur, Gartenkunst, Landschaft, Geografie, Politik und Kulturgeschichte, Literatur, Sexualität, Religionswissenschaft, Allegorie und Herzschmerz. Ihr nun endlich auch – und wie könnte es anders sein, im Verlag der „Naturkunden“ – auf Deutsch vorliegendes Buch ist ein schöner und wichtiger Beitrag zur Anthropologie. Ihr Buch ist belesen und an den richtigen Stellen respektlos, streift durch die Jahrhunderte und Philosophien, überwindet Zäune und Sperren, weitet unentwegt den Blick. Ihr „Field Guide To Getting Lost“ (2017) schreibt das Thema weiter.
Schon Thoreaus Essay über das „Spazieren“ exemplifizierte, dass Wandern unvermeidlich zu anderen Themen führt. „Gehen ist ein Thema, das immer abschweift“, bekräftigt Rebecca Solnit, zum Beispiel zu den Götterblumen unterhalb der Raketenleitstation auf der nördlichen Landzunge der Golden Gate in ihrem heimischen San Francisco. Sie sind ihre Lieblingswildblumen, mit diesen kleinen magentafarbenen Trichtern mit scharfen schwarzen Punkten, die aerodynamisch geformt wirken wie für einen Flug, zu dem sie nie abheben. Für die politische Essayistin Solnit ist Gehen immer auch eine autonome Eroberung des Raumes, ein Mittel der Selbstbestimmung.
Gehen heißt umherschweifen. Das Wandern steckt uns Menschen in den Genen. 99 Prozent seiner bisherigen Zeit auf dem „blauen Planeten“ war der Homo sapiens nur zu Fuß unterwegs. Sein Fuß, sein Schritt und ein Radius von vier bis fünf Kilometern pro Stunde bestimmten das menschliche Maß von Raum und Zeit. Und immer schon, in allen Kulturen der Welt gab es Formen des Wanderns, die nicht ökonomischen Zwecken dienten, sondern dem Seelenheil.
„Die alte Kunst des Wanderns ist heute Einspruch gegen das Diktat der Beschleunigung“, sagt Ulrich Grober, selbst Buchautor zum Thema („Vom Wandern. Neue Wege zu einer alten Kunst“, 2006, NA 2011). Dass wir gehen, ist uns so selbstverständlich, dass wir oft vergessen, welch kultureller Reichtum und wie viel Glück in dieser alltäglichen Fortbewegungsart liegen. Der Maler Paul Klee wusste: „Zu Fuß kann man besser schauen.“ Wanderglück ist nicht käuflich. „Fußgänger der Welt, vereinigt euch“, rief Mike Davis („City of Quartz“) anlässlich der US-Ausgabe von „Wanderlust“ aus.
- Rebecca Solnit: Wanderlust. Eine Geschichte des Gehens (Wanderlust. A History of Walking, 2000). Aus dem Amerikanischen von Daniel Fastner. Verlag Matthes & seitz, Berlin 2019. 384 Seiten, 30 Euro.

ein ort der moral
(JG) Ein radikales Buch zum Gehen und zur Wüste. Kein Survival-Ratgeber, sondern Einblicke in eine persönliche, existenzielle Leidenschaft. Otl Aicher – legendärer Grafiker, Gründer der Ulmer Hochschule für Gestaltung, Erfinder der Piktogramme zu den Olympischen Spiele 1972 – war zeitlebens fasziniert von der Sahara. Er ging zu zweit, zu dritt, manchmal allein. Er war gelegentlich dem Tod nahe, aber fühlte sich nie so sehr am Leben wie in der Sahara.
„die wüste ist keine wildnis im gegensatz zu den leerzonen des nordens. sie ist rein, groß, unbefleckt. sie hat das hellste licht und den funkelndsten himmel. sie ist ein ort der moral. sie fördert die reduktion und sie zeigt das prinzip: minimierung der ansprüche ist optimierung der freiheit. reduktion ist gewinn. wer alles zurücklässt und nur mitnimmt, was er am leib hat, kommt als er selber zurück.“
Wer die Wüste liebt, wird sich in diesem Buch verlieren, in den Texten zum Gehen in der Nacht, zum Schuhwerk, zum Sternenhimmel, zum Überleben in Sandstürmen. Man kommt selbst ins Schweifen angesichts der Bilder, folgt den Gedankengängen Aichers, der stets zu Fuß ging. „die wüste ist eine denklandschaft. man geht nicht nur zwischen dünen umher, man macht gedankengänge. es verändern sich die gedankenhorizonte.“
- Otl Aicher: gehen in der wüste. Fischer Verlag Frankfurt 1988, NA 2005. 177 Seiten, überwiegend illustriert, 25 Euro.
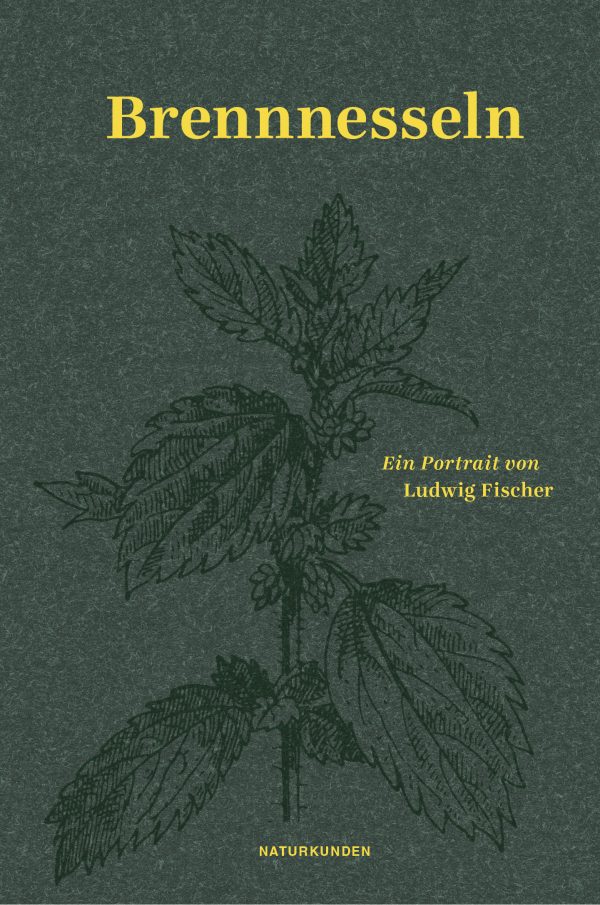
Verfemt, verkannt und garstig
(AM) Im Val Maira im Piemont kannte ich im armen Gebirgsort Stroppo ein Lokal namens „L’Ortica“, in dem nur Brennnesselgerichte serviert wurden. Wann immer ich dort war, kehrte ich da ein. Ehrfurcht vor dieser Pflanze hatte mir schon meine Großmutter beigebracht, die allerlei Rezepte kannte und schätzte. Ludwig Fischer – den wir nebenan in dieser Ausgabe mit einer Rezension seines „Natur im Sinn“ begrüßen und der uns von der Kulturgeschichte des Moors erzählt – hat dieser verkannten, garstigen und verfemten Pflanze innerhalb von Judith Schalanskys „Naturkunden“ ein ganzes Porträt gewidmet. Anders als die widerborstigen Pflanzenblätter lässt es sich wunderbar anfassen, über das edle Papier möchte man immer wieder streichen, das thermoreaktive Einbandmaterial Napura ® Khepera von Winter & Company möchte man gar nicht loslassen.
Die Gattung der Nesselgewächse (Urticaceae) ist riesig. In etwa 55 Gattungen werden über 2500 Arten verzeichnet, darunter die sehr gefährliche Australische Baumnessel, auch „The Suicide Plant“ genannt, deren Brennhaare verheerende Wirkung haben, trotzdem aber von einigen Tieren gefressen werden. Über 1100 Bezeichnungen gibt es für die oft verachtete und gemiedene Pflanze in den einzelnen Regionen Deutschlands, Ludwig Fischer entblättert ihre erstaunliche Geschichte, macht klar, dass Pflanzenkunde immer auch Kulturgeschichte ist. Märchen gehören dazu und Götter, Bräuche und Kuren, Literatur, Ängste, medizinische Anwendungen und teils immer noch unerklärte Phänomene. Schon vor 30.000 war die Nessel Faserlieferant, Nahrungsmittel, Heilkraut und Ritualpflanze, als feines Ramietuch später auch für Madame Bonaparte. Vor Blitz und Donner soll sie schützen, mit den Göttern verbunden sein. Und es ist, als würde sie – hartnäckig – die Nähe zu den Menschen suchen. Sie gehört zu jenen wilden, ungebetenen Kräutern, die im Garten viel schneller wachsen als die angekauften Würz-, Heil- und Duftkräuter. Ludwig Fischer, selbst leidenschaftlicher Gärtner, hat sie –mit Wurzelsperre – unter einen Apfelbaum gepflanzt, zum Erschrecken seiner Gäste und Besucher. Belohnt wird er mit reichster Apfelernte. Am Ende seiner begeisternden Exkursion gesteht er: „Die Brennnesseln in meinem Schaugarten geben mir immer noch Rätsel auf.“ Aber besser versteht man sie, nach diesem Buch, keine Frage.
- Ludwig Fischer: Brennnesseln. Ein Portrait. Reihe Naturkunden Band 32, herausgegeben von Judith Schalansky. Matthes & Seitz, Berlin 2017. 168 Seiten, Hardcover, Fadenheftung, 18 Euro – zur Zeit vergriffen.
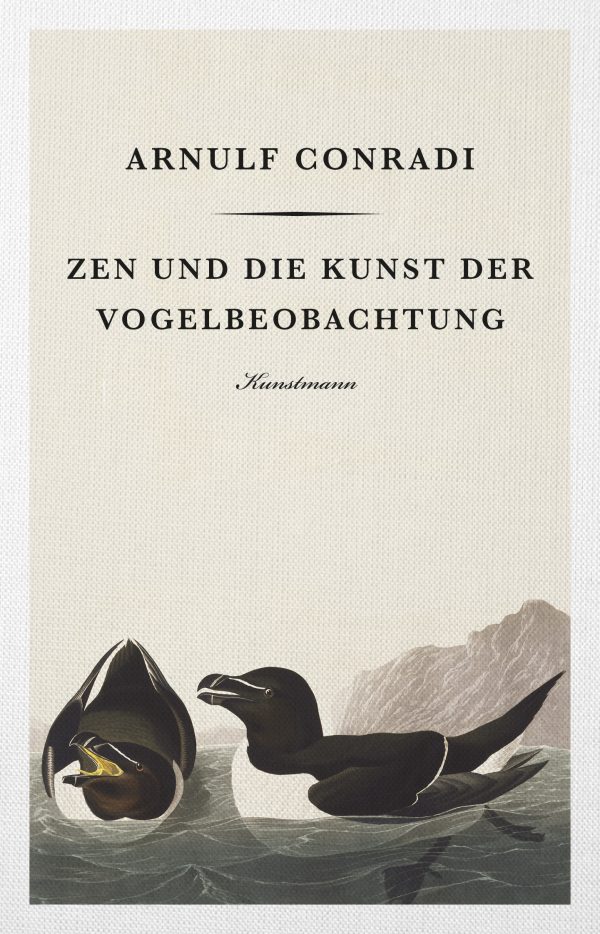
Das Sehen lernen
(AM) Dieses handschmeichlerisch gestaltete Buch möchte man, wenn es gelesen hat nicht mehr hergeben, denn es hat oftmals mit einem gesprochen – und wird es wieder tun. Ob man nun selbst Vogelbeobachter ist oder nicht. Arnulf Conradi vermag es, den Schock und die Schönheit des Sehens zu beschreiben, etwa als er seinen ersten Albatros sieht: „In der Beobachtung wurde ich für lange Minuten Teil seines Flugs, Teil dieser Leichtigkeit und Schönheit. Es war ein Jetzt, ein Augenblick, der sich tief einprägt – eine Senkrechte in der Zeit.“ Eine solche Erfahrung, schreibt Conradi, geht durch den ganzen Körper, erfüllt einen ganz und gar. „Wenn man den Albatros sieht, ist man ganz bei dem Albatros und zugleich ganz bei sich. Da gibt es eine schwer zu erklärende Identität zwischen dem Sehenden und dem, was er sieht. Und von diesem Augenblick, diesem kostbaren Jetzt, geht eine große Ruhe aus.“
Jeder Vogelbeobachter werde bestätigen, meint Conradi, dass der Anblick eines unbekannten oder seltenen Vogels die Zeit dehne, die man in der Anschauung verbringt. Der Anblick präge sich so tief ein, dass man ihn noch nach Jahren wieder aufrufen könne. (Ich zum Beispiel, als ich dies hier schrieb, einen Eisvogel an einem Altarm der Frankfurter Nidda, sicher 30 Jahre her, immer noch ein tiefenscharf farbiges Bild.) Es ist die Kunst Conradis, dass er uns seine Seh-Erlebnisse sinn- und bildhaft vermitteln kann. Er hält für uns die Zeit an, lässt uns zu- und mitsehen – und lehrt es uns zugleich. In einer kleinen Anekdote belustigt er sich leicht über einen Kreuzfahrtteilnehmer mit Motorkamera, der glaubte, etwas festgehalten zu haben.
Conradi hingegen überzeugt uns: Vogelbeobachtung ist eine Form der Meditation. Nicht von ungefähr lehnt sich der Titel seines Buchs an die Klassiker „Zen und die Kunst des Bogenschießens“ und „Zen und die Kunst ein Motorrad zu warten“ an. Der Gründer des Berlin Verlags und ehemalige Cheflektor und Programmleiter beim S. Fischer Verlag ist mehr als nur ein großer Vogelkundler, auch den Naturbezug des Zen-Buddhismus vermag er uns anschaulich zu machen. Oder was Rilkes Begriff von der „Einsicht“ beinhaltet.
2009 hat Conradi bei der Anderen Bibliothek „Die Vögel Mitteleuropas“ des großen deutschen Ornithologen Johann Friedrich Naumann herausgegeben, jetzt lässt er uns in Kapiteln wie „Die Seen/ Die Uckermark“, „Die Stadt/ Der Grunewald“, „Der Fluss/ Die Peene“, „Die Nordsee/ Sylt“ oder „In den Bergen/ Balderschwang“ an der Summe seines eigenen „Birder“-Lebens teilnehmen. Jeder vierte Engländer bezeichnet sich als ein solcher, bei uns ist das etwas Exotisches. Noch.
- Arnulf Conradi: Zen und die Kunst der Vogelbeobachtung. Verlag Antje Kunstmann, München 2019. Hardcover, 240 Seiten, 20 Euro.
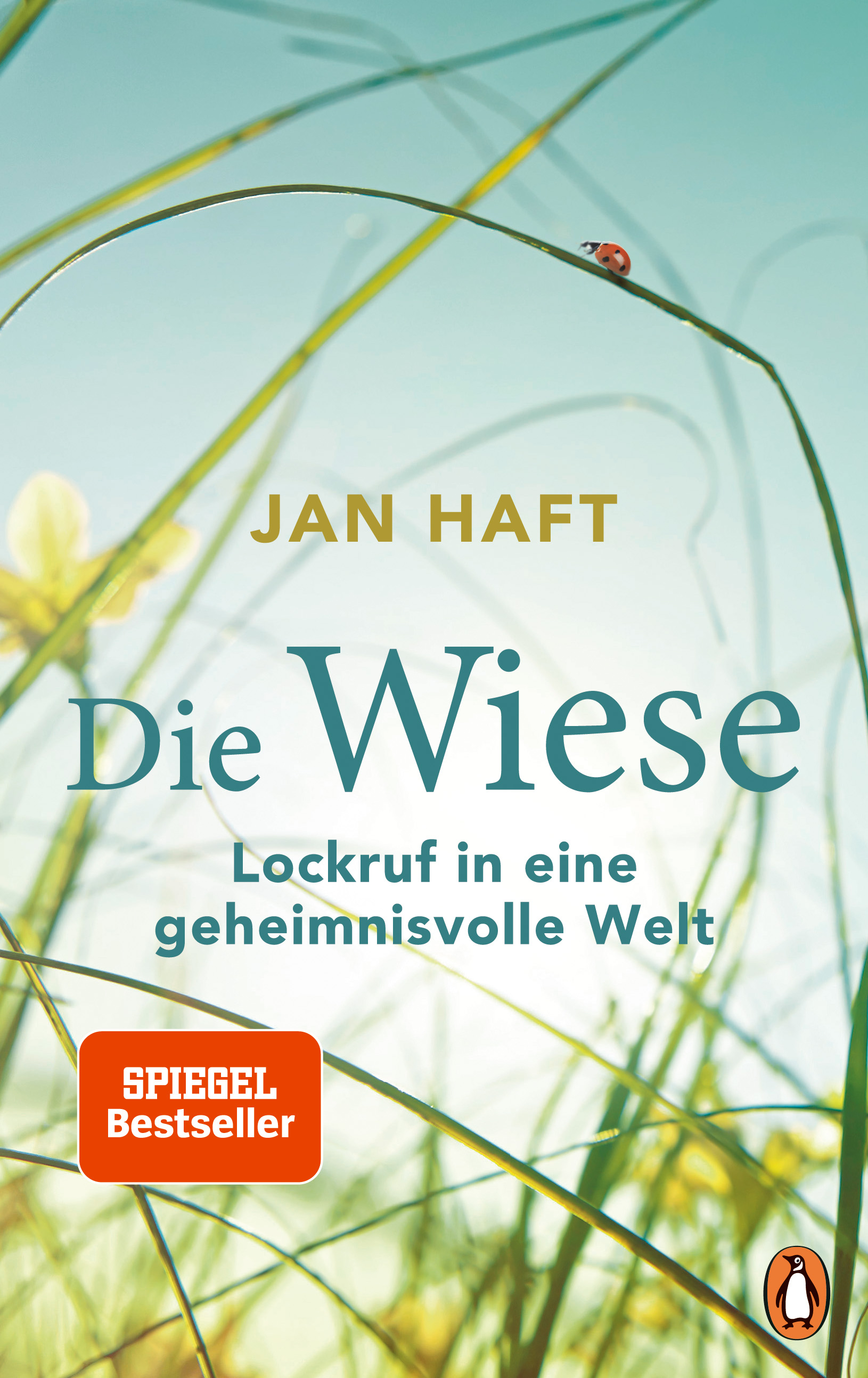
Die Wunder vor der Tür
(AM) Natürlich hatte ich als Junge ein großes Einmachglas mit gefangenen Kaulquappen auf der Fensterbank und sah ihnen bei der Verwandlung in Frösche zu. Heute ist das verboten. Naturschutz. Gleichzeitig gibt es Fördergelder, wenn ein Landwirt hunderte Hektar blühende Wiese in grüne Einöde verwandelt. Blühende Wiesen machten einst in Deutschland ein Drittel der Fläche aus, heute sind es noch klägliche zwei Prozent. Kein anderer Lebensraum hat so viele Farben und so viele Insektenarten, kein anderer Lebensraum bei uns ist mehr bedroht. Rund 3.500 Tierarten bevölkern solch eine Blumenwiese: Heuschrecken und Marienkäfer, Ameisen und winzige Springschwänze, singende Wanzen und Schmetterlinge, Schlangen und Mäuse, Igel und Vögel sowie Raubtiere wie Mäusebussarde, Eulen und Füchse.
Eine Hummel und eine Füchsin sind die Protagonisten im Prolog von Jan Hafts schönem Buch – das es auch als Film gibt. Sein Lockruf in die geheimnisvolle Welt der Wiese ist wohltuend bodenständig. Der Biologe und Naturfilmer ist schon als Junge im Gras gelegen, hat die Welt vor seiner Tür erforscht, Kaulquappen inklusive natürlich. Sein Buch ist angenehm lesbar geschrieben, vermeidet pathetische Töne, ist prallvoll mit Anekdoten, Hintergrund, Anschaulichkeit – und kleinem, rundem Glück. Naturkunde, populär gemacht.
Gewidmet ist das Buch „jenen Landwirten, die trotz aller Sachzwänge und ohne viel darüber zu reden auf ihrem Grund ein paar wilde Ecken und blühende Flecken zulassen, obwohl sie es nicht müssten“. Wenn die Bauern nur ein Fünftel ihres „Grünlandes“, so der Amts-Oberbegriff für Wiesen, im Sinne von Artenreichtum bewirtschaften würden, schreibt Jan Hoft, „wären wir um eine Million Hektar blühende Wiesen reicher. Es wäre ein Paukenschlag gegen das Insektensterben.“ Seine Forderung: Biodiversität muss zum Agrarprodukt werden.
- Jan Haft: Die Wiese. Lockruf in eine geheimnisvolle Welt. Penguin Verlag, München 2019. 256 Seiten, davon 32 Bildseiten, 20 Euro.

Erinnerungen an einen Großen
(AM) Ein Klassiker, von Ludwig Fischer in seinem Grundlagenwerk „Natur im Sinn“ (Besprechung hier nebenan) wärmstens empfohlen. Dieses große und auch großformatige Buch über Spinnen, das parallel zum gleichnamigen Fernsehfilm (mit Musik von „Tangerine Dream“) und in Zusammenarbeit mit dem Spinnenforscher Ernst Kullmann entstand, besteht zum Teil aus erzählenden Partien, die ohne Weiteres als bemerkenswertes Nature Writing gelten können. Ein Beispiel unter der Überschrift „Radnetze und Fangfächer“:
„Die beste technische Lösung des Problems,
bei eigener Unbeweglichkeit sich die Nahrung
aus der Luft zu greifen, ist das Radnetz.
Nach Verwendung von nur wenig Spinnmaterial
deckt es eine große Fläche. Es ist zugleich
flexibel und fest und benötigt nur wenige Auf-
hängepunkte. Die Radien sind Gerüst und
Signalanlage für die oft im Zentrum lauernde
Spinne zugleich. Auch läuft die Spinne an
ihnen zu jedem beliebigen Ort des Netzes,
ohne sich in den spiralförmigen Fangfäden zu
verheddern. Ohne Fangfäden, die als Spirale
von außen nach innen gezogen werden, wären
Radnetze funktionsunfähig. Das Radnetz ist die
einzige Alarmanlage der Welt, die den Einbrecher
nicht nur meldet , sondern auch gleich verhaftet.“
Heute ist der Journalist, Essayist und Schriftsteller Horst Stern fast vergessen, er starb 96-jährig Anfang dieses Jahres. Ludwig Fischer sieht in der Entschärfung der allgemeinen öffentlichen Diskurse über Natur in der Bundesrepublik einen Grund für die heutige Missachtung Sterns. Der sprachmächtige Autor konnte zuspitzen, konnte scharf und prägnant formulieren, scheute keine Kontroverse. Er „war unbestechlich und unbequem, scharfsichtig und furchtlos“ (Fischer). Die Einschaltquoten für seine Fernsehfilme übertrafen die der Quizshows. Fischer sieht seine großen Essays und Reden nach wie vor unübertroffen: als „unerbittliche, herausragend formulierte Nachdenklichkeiten über die Missachtung und Schändung der Mitgeschöpfe und der Umwelt – und über die Unzulänglichkeiten und Unentschiedenheiten des Naturschutzes wie über die Bigotterie einer ‚Versöhnung zwischen Ökologie und Ökonomie’“. Frau Klöckner lässt grüßen.
- Horst Stern, Ernst Kullmann: Leben am seidenen Faden. Die rätselvolle Welt der Spinnen. Verlegt bei Kindler, München 1981 (Erstauflage 1975). Großformatiger Bildband, 300 Seiten, nur noch antiquarisch erhältlich.
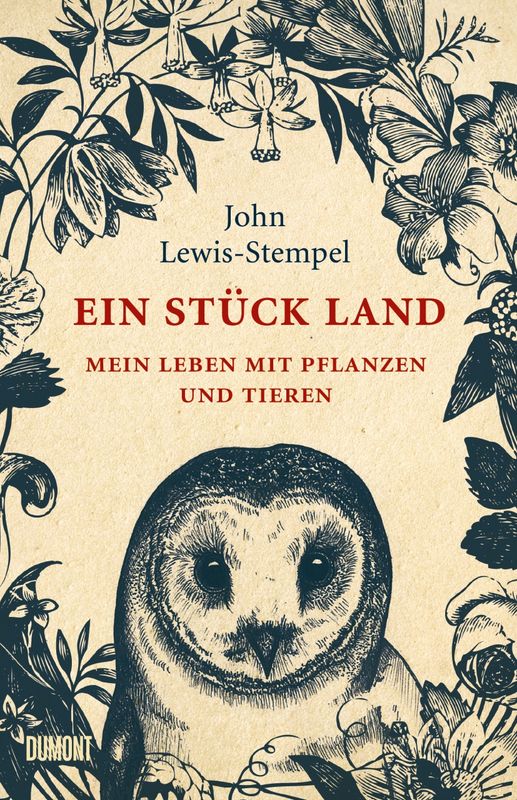
Stets im Verhältnis zur Mitwelt
(LuF) In einem Vorwort von wenigen Zeilen schreibt Lewis-Stempel: „Ich kann nur erzählen, wie es sich angefühlt hat. Wie es war, ein Stück Land zu bearbeiten und zu beobachten und mit allem verbunden zu sein, was dort ist und jemals dort war.“ Die programmatischen Sätze weisen voraus auf die bestechenden Qualitäten – und auf die latenten Risiken, die dieses Buch enthält.
Der Autor bewohnt mit seiner Familie einen kleinen Hof in Herefordshire, an der Grenze zu Wales. Er bewirtschaftet das alte Gehöft, zu dem einige von Hecken gesäumte Wiesen am Fluss Esclay gehören, mit historischen Nutztieren, regionalen Rinder- und Schafrassen. Er schreibt von der zum Teil harten körperlichen Arbeit – als der Mähbalken seines betagten Traktors beschädigt wird, muss er mehrere Hektar Wiese mit der Sense mähen, das Heu von Hand wenden und einbringen. Und er verschweigt auch die bitteren Erfahrungen nicht, die er immer wieder machen muss: das Sterben einer in den Graben gestürzten, vertrauten Kuh; den Tod von Lämmern, die der Fuchs sich holt.
Aber der größte Teil des Textes, der nach den Monaten eines Jahres gegliedert ist, berichtet von den Beobachtungen, die Lewis-Stempel auf den nach Lage und Boden unterschiedlichen Wiesen, in den verwilderten Ecken am Fluss und an den Gräben, in den Bäumen, in Haus und Scheune, auch am Himmel macht: genaue, eindrücklich, sinnlich fassbare Wahrnehmung noch unscheinbarer Naturphänomene, bis hin zu den Gräsern, Insekten und den Bodenlebewesen. Und immer wieder geht er auf die Geschichte des Anwesens, des Landstrichs, auch der politischen Landschaft ein – allerbestes Nature Writing, weil der Beobachtende stets sich selbst ins Verhältnis zu der erfahrenen Mitwelt setzt.
Aber es gibt eine manchmal arg nostalgische Tendenz in dem Buch: die Feier einer vormodernen bäuerlichen Arbeit; eine Überhöhung der natürlichen Prozesse, nicht nur mit den jahreszeitlichen Veränderungen; eine Bindung an, ja einen existenziellen Rekurs auf die ‚naturgegebenen’ Bedingungen auch des menschlichen Lebens. Dieser bedenkliche, regressive Zug an manchen Stellen des Textes entwertet den präzisen, unprätentiösen und vorzüglich formulierten Text nicht, lässt ihn aber – etwa im Vergleich zu den großen Texten des US-amerikanischen Farmers Wendell Berry – denn doch ein wenig beschaulich erscheinen.
- John Lewis-Stempel: Ein Stück Land. Mein Leben mit Pflanzen und Tieren (Meadowland: the private life of an English field, 2015). DuMont Verlag, Köln 2017. 288 Seiten, 23 Euro.
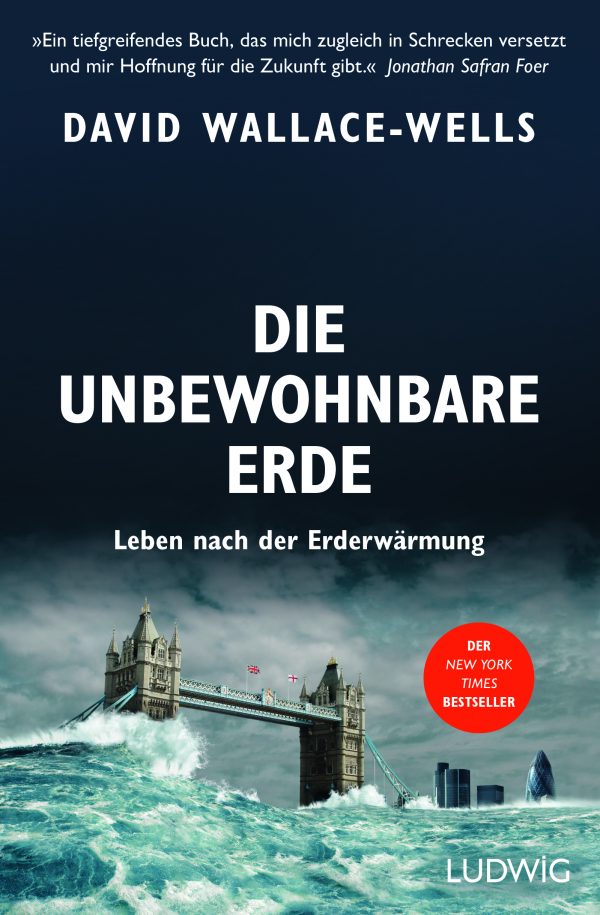
Alles noch schlimmer als gedacht
(AM) „The Atrocity Exhibition“ nannte der große englische Dystopie-Autor J. G. Ballard 1970 eine besonders ätzende Essay-Sammlung (deutsch als „Die Schreckensgalerie“ oder „Liebe und Napalm = Export USA“). Vieles darin war Meta-Ebene. Die Schreckensgalerie, in die uns der New Yorker Journalist David Wallace-Wells führt, hat sehr konkrete Ausformungen – und sie scheint unabwendbar. Nichts von seinen Erkenntnissen sei neu, betont er, sie seien alle bekannt, er habe sie nur neu zusammengetragen. Und kurz gesagt: Alles ist noch schlimmer als gedacht.
Auf Seite 160 äußert er Verständnis für mittlerweile einsetzende Panikattacken: „Wenn Sie es bis hierher geschafft haben, sind Sie ein tapferer Leser.“ Sein Buch fußt auf einem 2017 im New York Magazine erschienenen Essay mit dem Titel „The Uninhabitable Earth“, auf Deutsch im Freitag mit dem Titel „Der Planet schlägt zurück“erschienen. Wetterkapriolen und Klimakatastrophen sieht er nicht als Einzelfälle, sondern als Anfänge von Kaskaden, „Wasserfälle und Lawinen der Zerstörung, die dem Planeten einen Schlag nach dem anderen verpassen, immer heftiger und aufeinander aufbauend, auf eine Weise, die unsere Reaktionsfähigkeit zersetzt und einen Großteil der Landschaft umpflügt, die wir seit Jahrhunderten als sicheren Grund betrachten, auf dem wir uns bewegen, Häuser und Straßen bauen, unsere Kinder durch die Schulzeit bringen …“
Entlang der Elemente beschreibt Wallace-Wells, was auf uns zukommt: Hitze und Feuer, Wasser und Eis, Luft und Staub, Zerstörung. Und das immer schneller. Unaufhaltsamer. Momentan gibt es 354 Städte, schreibt er, in denen es im Sommer heißer als 35 Grad wird, bis zum Jahr 2050 kann diese Zahl auf 970 ansteigen und 1,6 Milliarden Stadtbewohner betreffen. Schon heute ist ein Drittel der Erdbevölkerung mindestens 20 Tage im Jahr tödlichen Hitzewellen ausgesetzt.
Ein „Höllen-Jahrhundert“ steht uns bevor, warnt der Autor: „A completely Mad Max world is around the bends.“ Das Buch will aufrütteln und für die Treibhausgase das sein, was Rachel Carsons „Der stumme Frühling“ von 1962 für Pestizide war. Das größt denkbare Warnschild.
- David Wallace-Wells: Die unbewohnbare Erde. Leben nach der Erderwärmung (The Uninhabitable Earth. Life After Warming, 2019). Aus dem Amerikanischen von Elisabeth Schmalen. Verlag Ludwig/ Random House, München 2019. Klappenbroschur, 336 Seiten, 18 Euro.

Die Schätze der Welt
(AM) Welch eine Detektivgeschichte. Nein, Geschichten muss man sagen. Ihre Hauptdarsteller: Libellen, Tapire, Hechtbuntbarsche, Mäuse, Salamander, Frösche, Geckos, Gallwespen, Fächer- und Bockkäfer, Vogelspinnen, Schnecken, Fadenwürmer, Leuchtschaben, unbekannte Arten. Wenn man sich die Vielfalt der Erde als Symphonie vorstellt und jede Spezies als einen Ton, dann wäre die Partitur so unvollständig wie Beethovens „Neunte“ klingen würde, wenn wir nur jeden fünften Ton von ihr kennen. Mit diesem Bild umreißt der Wissenschaftsautor Christopher Kemp das Problem, dass erst ein Fünftel aller biologischen Arten einen Namen hat (taxonomiert wurde). 75 Prozent all dieser Arten, schätzt er, sind irgendwo in einer der fast 8.000 naturhistorischen Sammlungen auf der Welt vorhanden. Nur etwa ein Prozent der Bestände aber sind in einem durchschnittlichen Naturkundemuseum ausgestellt, der Rest ist katalogisiert, zumindest oberflächlich, und schlummert vor sich hin. Die Wahrscheinlichkeit, in einem Museum eine Schublade aufzuziehen oder ein altes Glas aufzuschrauben und eine neue Spezies zu entdecken – in diesem Buch immer wieder beschrieben -, ist größer als im Regenwald oder sonst wo auf der Erde. Wir sind in großem Ausmaß von namenlosen Arten umgeben.
In Hinblick auf unser Verständnis der Artenvielfalt und der Ökosysteme fragt Kemp: Wie können wir etwas schützen, das keinen Namen hat? Er zitiert Konfuzius: „Weisheit beginnt damit, die Dinge bei ihrem Namen zu nennen.“ Und er nimmt uns mit auf 25 sehr anschaulich beschriebene Expeditionen in naturkundliche Sammlungen, wo Forscher in den Beständen aufregende Entdeckungen machen. Manchmal lagen die Funde schon Jahrzehnte oder länger herum – tatsächlich gibt es Forscher, die sich Käfer leihen wie andere Bücher, um sie zu bestimmen. Die Zahl der Kuratoren in den Museen freilich sinkt. Das Field Museum in Chicago etwa, beklagte Kemp in einem seinem Buch vorangegangen Text in der Wissenschafts-Zeitschrift „Nature“, hatte 2001 noch 39 Kuratoren, 2015 waren es noch 21 und keiner mehr für die enorm diverse Klasse der Fische. – Insofern ist dieses ultra-spannende Buch auch ein Warnruf.
- Christopher Kemp: Die verlorenen Arten. Große Expeditionen in die Sammlungen naturkundlicher Museen (The Lost Species: Great Expeditions in the Collections of Natural History Museums, 2017). Aus dem Englischen von Sebastian Vogel. Verlag Antje Kunstmann, München 2019. 288 Seiten, mit Farbteil, 25 Euro.
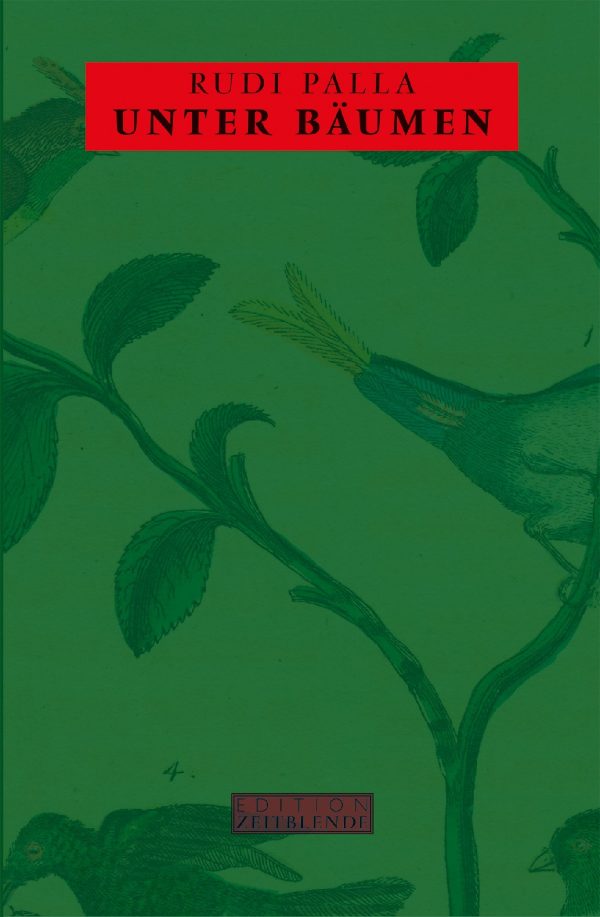
Jahre lang im Moos liegen
(AM) Aus den Reisen der Erstauflage von 2006 sind nun im Untertitel Begegnungen geworden, immer noch aber ist Rudi Pallas Buch „Unter Bäumen“ weit von den sentimentalen Baumbestsellern entfernt, die auch zur Konjunktur der Naturbücher gehören. Sein Buch ist beinahe erschreckend textlastig, hat einen überbreiten Satzspiegel, nähert sich auf 21 Reisen ebenso vielen Bäumen oder Baumarten, die alle eine besondere Biographie haben. Die Platane des Hippokrates ist dabei, der Baum des Müßiggangs und der Himmels, der der weisen Voraussicht und der des Friedens. Zum Entenfußbaum in der japanischen Tempelanlage Hosen-ji, der die Atombombe von Hiroshima überlebte, gehört dann auch Goethes Verbindung zum Ginko. Wie überhaupt die Verbindungslinien Rudi Pallas Sache sind.
Sein Text changiert zwischen Essay, Reisereportage und Kulturgeschichte. Wer sein Meisterwerk „Verschwundene Arbeit. Ein Thesaurus der untergegangenen Berufe“ kennt – CulturMag-Besprechung hier – wird sich diesem Autor gerne auch für diesen Ausflug zu den Bäumen anvertrauen. Als Motto zitiert er eine Postkarte Kafkas an Max Brod, Datum 18. September 1908 aus dem Böhmerwald: „Mein lieber Max, ich sitze unter dem Verandendach, vorn will es zu regnen anfangen, die Füße schütze ich, indem ich sie von dem kalten Ziegelboden auf eine Tischleiste setze und nur die Hände gebe ich preis, indem ich schreibe. Und ich schreibe, dass ich sehr glücklich bin und dass ich froh wäre, wärest Du hier, denn in den Wäldern sind Dinge, über die nachzudenken man Jahre lang im Moos liegen könnte. Adieu. Dein Franz.“
- Rudi Palla: Unter Bäumen. Begegnung mit den größten Lebewesen. Edition Zeitblende im AT Verlag, Aarau und München 2018. Völlig überarbeitete und neu gestaltete Ausgabe des bei Paul Zsolnay, 2006, erschienenen Buches. 280 Seiten, 27 farbige Abbildungen, Lesebändchen, Farbschnitt, 34 Euro.
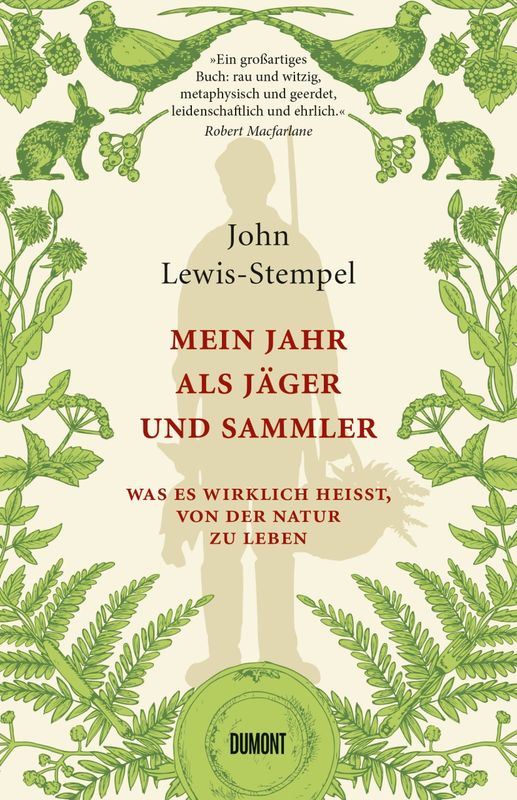
Selbstversuch
(AM) John Lewis-Stempel, Jahrgang 1967, ist ein englischer Farmer, Schriftsteller und „Sunday Times“-Top 5-Bestsellerautor. Steht in der englischen Wikipedia. So etwas können nicht viele Autoren von sich sagen. Er stammt tatsächlich aus einem Bauerngeschlecht in Herefordshire in den West Midlands, das sich auf über 700 Jahre zurückverfolgen lässt. Er kann mit Worten Geld verdienen, war Kolumnist des Jahre 2016 in Großbritannien, der „Spectator“ nannte ihn „the hottest nature writer around“. Und er kann zupacken, Kühe melken, Schafe scheren, Klauen schneiden, Tiere jagen, Hühner oder Schweine schlachten, Wurst machen, Katzen ersäufen, Geburtshelfer sein, sich selbst verarzten, was immer so ein Landleben erfordert.
„The Wild Life“ entstand fünf Jahre vor seinem hier ebenfalls besprochenen „Ein Stück Land“ und war ein Experiment: Kann er es als Jäger und Sammler schaffen, auf seiner Farm ein Jahr lang nur von dem zu leben, was die Speisekammer der Natur ihm bietet? Können ihn die Wiesen, Hecken und Bäche seines sechzehn Hektar großen Anwesens ernähren? John Lewis-Stempel, der übrigens auch Autor mehrere militärgeschichtlichen Werke ist – darunter das fulminante „Where Poppies Blow: The British Soldier, Nature, The Great War“ (2016) – kann erzählen ohne zu ermüden. Man folgt ihm gerne durch die Monate und bibbert oder schüttelt sich manchmal. Es gibt einen Kalender der wilden Nahrungsmittel für jeden Monat und zahlreiche Rezepte: von Löwenzahnkaffee und Hagebuttensirup bis zu Grauhörnchenburger mit Kräutern, Pilzketchup, Brennnesselbier und geschmortem Eichhörnchen.
Ich sage oft, es ist erst eine Generation her, dass man sein Essen noch selbst schlachten musste, das Buch macht zwischen allen Zeilen klar, wie sehr wir doch längst an die Supermärkte gewöhnt und eben schon lange keine Jäger und Sammler mehr sind. Lewis-Stempel schreibt im Präsens, er führt in eine fast schon vergessene und von vielen gerne hinter sich gelassene Welt. Dennoch ist dieser durchaus poetische Report eines Selbstversuchs ein zeitgemäßes Buch, keine Frage.
- John Lewis-Stempel: Mein Jahr als Jäger und Sammler. Was es wirklich heißt, von der Natur zu leben (The Wild Life: A Year of Living on Wild Food, 2010 ). DuMont Verlag, Köln 2019. 352 Seiten, mit 15 sw-Abbildungen, 22 Euro.
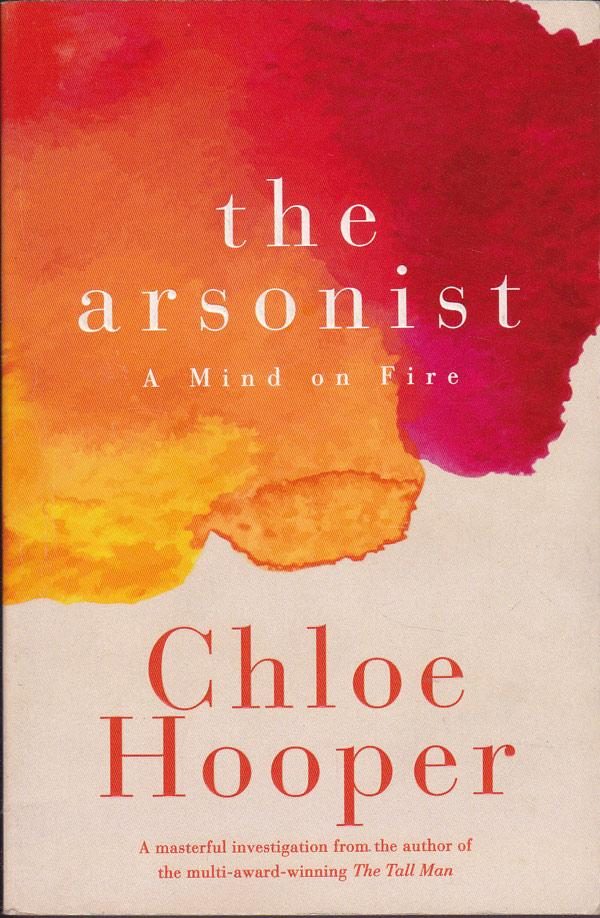
„Mein Brandstifter“
(AM) Natur brutal. Zur Menschheitsgeschichte gehört das Feuer, das werden wir noch viel öfter (wieder) lernen müssen. Das australische Standardwerk dazu, „Burning Bush“ (1991), stammt vom US-Wissenschaftler Stephen J. Pyne. Die Autorin Chloe Hooper wurde am „Schwarzen Samstag“ im Februar 2009 beinahe selbst von einem Buschbrand eingeschlossen. 173 Menschen verbrannten an jenem Tag im Bundesstaat Victoria, es war die tödlichste Feuerbrunst in der Kolonialgeschichte des Kontinents. 400 verschiedene Feuer wüteten dabei, Chloe Hooper konzentriert sich auf zwei im Latrobe Valley in Gippsland, für die die Polizei bald den Täter fand: Brendan Sokaluk, 42 und aus der Gegend stammend, wurde als Brandstifter für zehn Tode und 156 zerstörte Häuser verantwortlich gemacht und trotz attestiertem Autismus zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt.
Chloe Hooper, die sich in ihrem zu Recht gerühmten Buch „Der große Mann“ – CulturMag-Besprechung hier – einem rassistischen Polizisten annäherte und erstaunlich differenzierte Antworten fand, beschäftigte sich viele Jahre mit dem „Black Saturday“, besuchte den Verurteilten im Gefängnis, rekonstruierte Ermittlung und Verhandlung. Als ich sie 2015 in Melbourne traf, nannte sie ihn mit Affekt „my arsonist“, mein Brandstifter.
Sie fragt sich nicht nur, welch eine Art von Person eine Brandkatastrophe anzettelt, sie seziert auch eine Gesellschaft, die sich Monster baut, der Natur entfremdet ist und einfache Antworten statt Zusammenhänge will. Ihr Buch handelt darüber hinaus vom Niedergang einer ehemaligen Kohle-Stadt, von der Ausbeutung der Ressourcen und der Energieversorgung des Molochs Melbourne, kurz von unserm räuberischen Verhältnis zur Natur.
- Chloe Hooper: the arsonist. A Mind on Fire. Hamish Hamilton, Penguin Random House Australia, Sydney 2018. 254 pages.
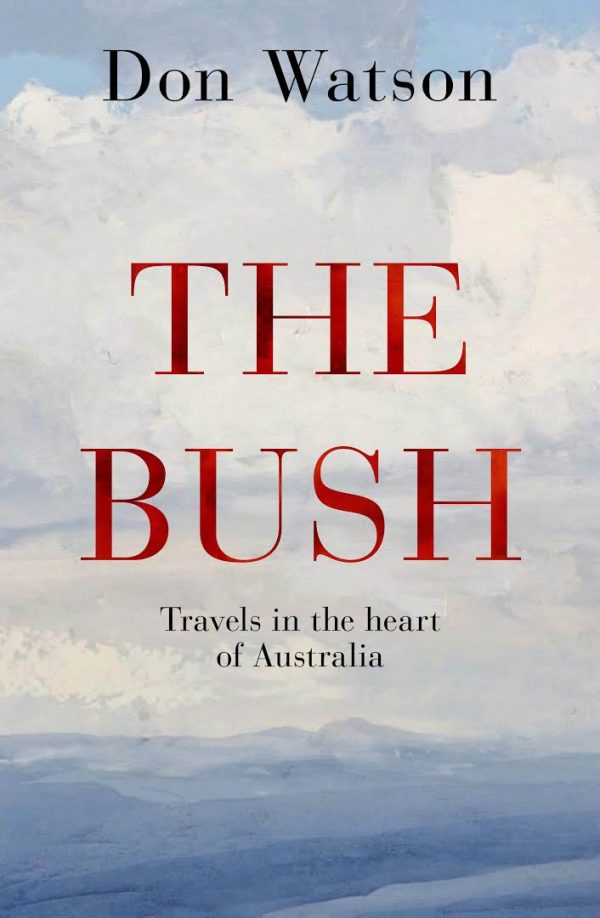
Das Herz eines Kontinents
(AM) Am Anfang war der Busch. Er war da, als die ersten Menschen vor 70.000 Jahren den fünften Kontinent besiedelten, er war da, als die Europäer kamen. Er ist real und er ist imaginär. Er ist die Idee von Australien selbst – und ihr Herz der Finsternis. Don Watson, einer der besten australischen Autoren und sicher einer der politischsten – er war es, der dem Premier Keating die „Redfern Adress“ schrieb, jene berühmte Rede, in der die Weißen gegenüber den Aborigines zum ersten Mal ihre koloniale Schuld eingestanden – ist für diesen Nationalcharakter auf Expedition gegangen. Selbst ein Landei, ist „The Bush“ auch die Summe seines Lebens und der Auseinandersetzung mit dem eigenen Land.
Wenn man wissen will, was Australien ist, muss man sein Buch lesen. Es ist blendend geschrieben, hat keinen deutschen Verlag. Es ist Reisebericht und Kulturgeschichte, ist Nature Writing und Biografie, ist Siedlungs-geschichte und Einsamkeitsstudie, es erzählt von Gewalt und Rassismus, spannt den Bogen weit. 2017 veröffentlichte Don Watson dazu sozusagen einen Materialienband, Stimmen aus vier Jahrhunderten: „A Single Tree. Voices from the Bush.“
Chloe Hooper übrigens und er sind ein Paar. Sie haben zwei Kinder.
- Don Watson: The Bush: Travels in the Heart of Australia. Hamish Hamilton, Penguin Random House Australia, Sydney 2014. 428 pages.
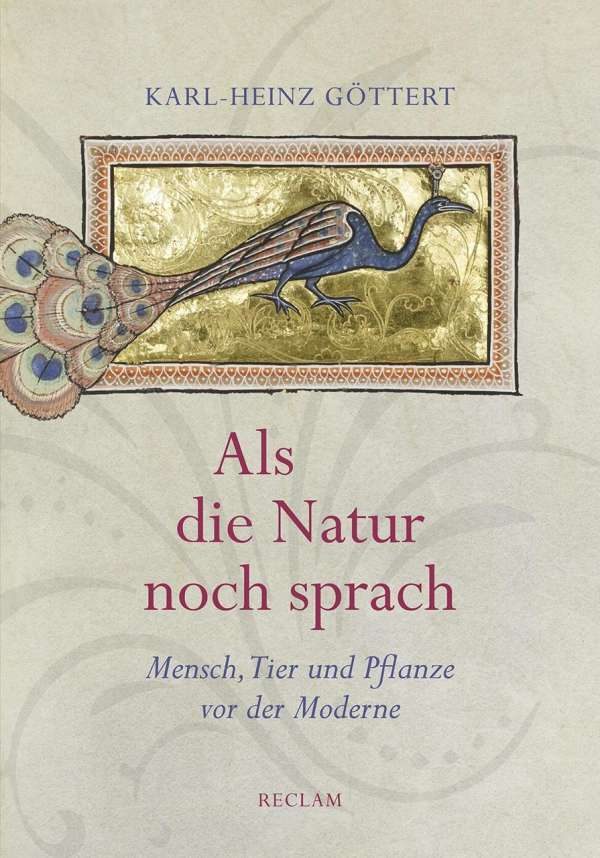
Die zweite Offenbarung
(AM) Karl-Heinz Götterts Buch ist schwer, wiegt beinahe ein Kilo. Schwergewichtig ist es auch inhaltlich. Der emeritierte Professor für Ältere Deutsche Sprache und Literatur an der Universität Köln, seit seiner Jugend begeisterter Botaniker, war dafür im Zwiespalt. Als Philologe, der die antik-mittelalterlichen Diskussionen sein Leben lang studiert hat und sie, wie der Name sagt, auch „liebt“, war es ihm als Vorhaben schwierig, Unsinn zu entlarven. Geht das zusammen, fragt er sich? Kann man mit einer gewissen Begeisterung schildern, was letztlich falsch ist? Man kann, zeigt er.
Seine Längs- und Querschnitte durch die antike und mittelalterliche Philosophie und Literatur zeigen, welch kuriose Blüten die Naturbetrachtung treiben kann, wenn sie einer bestimmten Sinnfindung unterworfen wird. (Ok, das gilt auch für Klimawandelleugner heute.) Natur war in der Antike ganz auf den Menschen und das ihm Nützliche bezogen, im Zeichen des Christentums sollte/ musste sie als großes Buch der Schöpfung in jedem Detail von der göttlichen Weltordnung sprechen. Dem frommen Christen bot die Natur als „zweite Offenbarung“ viele Lehren. Banales Beispiel: Warum hat der Pfau so einen langen, prächtigen Schwanz? Es ist ein Hinweis auf das ewige Leben und dessen Herrlichkeit.
Göttert blättert auf, was Plinius und Aristoteles, Albertus Magnus oder Thomas von Aquin, Hildegard von Bingen oder Paracelsus über Tiere, Pflanzen und unser Verhältnis zu ihnen zu sagen hatten. Seine Geschichte des vormodernen Naturbegriffs – des Wissens von der Natur vor der Moderne – bietet viele Sonderbarkeiten und Irrwege. Wichtiges Grundlagenwerk.
- Karl-Heinz Göttert: Als die Natur noch sprach. Mensch, Tier und Pflanze vor der Moderne. Reclam Verlag, Stuttgart 2019. Hardcover, Fadenheftung, Lesebändchen. 390 Seiten, 45 Farbabbildungen, 30 Euro.
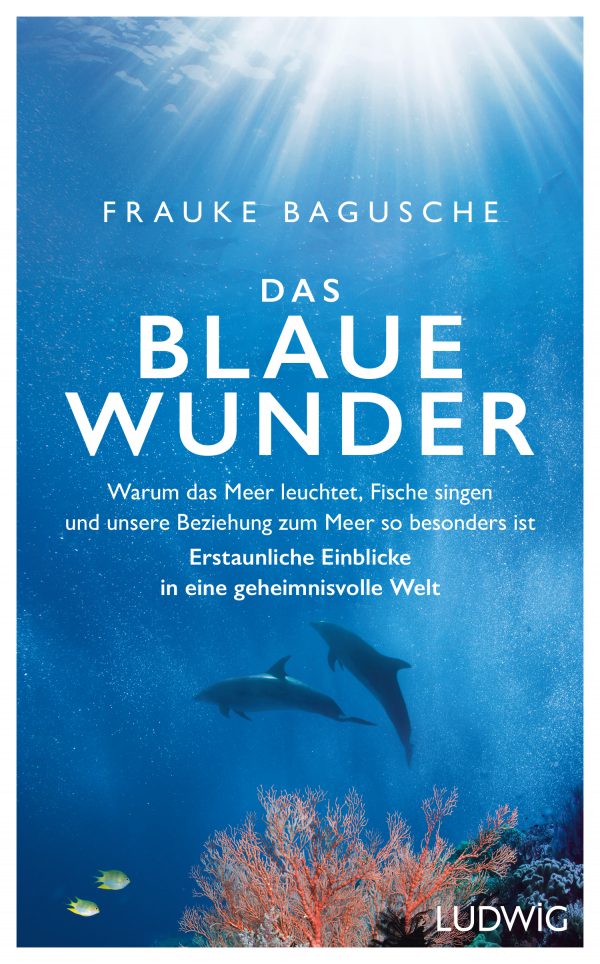
Thalassophie
(AM) Wenn es Magie gibt auf diesem Planeten, dann ist sie von Wasser umgeben, zitiert „Das blaue Wunder“ als Motto einen Satz von Loren Eiseley, dessen preisgekrönten Essay „Die braunen Wespen“ wir Ihnen in diesem CulturMag Special NATUR zum ersten Mal in einer deutschen Übersetzung präsentieren. Die Meeresbiologin Frauke Bagusche will Magie und Wunder des Meeres nahebringen, will unser aller Liebe zum Meer fördern. Das tut sie mit klarer Sprache, auch zum Vorlesen im Familienkreis geeignet, durchaus mit wissenschaftlichem Anspruch, aber es geht ihr dabei auch um Verständlichkeit.
Ihr Buch lädt dazu ein, buchstäblich in die Wunderwelt der Meere einzutauchen. Zwei Drittel unseres Planeten sind schließlich von Wasser bedeckt. Sie selbst, erklärt Frauke Bagusche, sei immer schon „thalassophil“ gewesen. Gemeinsam mit Umweltschützern und Surfern hat sie die Initiative „Aquapower Expedition“ gegründet, deren Ziel es ist, den Plastikmüll in den Meeren zu reduzieren. Ihr Buch macht klar: Meeresschutz fängt zu Hause an, ob man nah am Meer wohnt oder nahe am Gebirge. Mit kleinsten Änderungen im Alltag kann man zum Schutz der Meere beitragen.
- Frauke Bagusche: Das blaue Wunder. Warum das Meer leuchtet, Fische singen und unsere Beziehung zum Meer so besonders ist. Verlag Ludwig/ Random House, München 2019. Hardcover, 16seitiger Farbbildteil, 320 Seiten, 22 Euro.
Komplexität, verständlich gemacht

(AM) Der weltweite E-Mail-Verkehr erzeugt so viel CO2-Emissionen wie sieben Millionen Autos. Der Energie-Riese Internet ist für 2% der globalen CO2-Emissionen verantwortlich, bis 2040 werden es 14% sein, die weltweit von den Rechenzentren verursacht werden. Dies ist nur zwei der Erkenntnisse, die aus Esther Gonstallas „Klimabuch“ gewonnen werden können. Die freiberufliche Buch- und Magazingestalterin hat aus vielen (im Anhang dokumentierten) wissenschaftlichen Quellen 50 Themen destilliert und visualisiert die Daten überraschend kreativ in doppelseitigen Infografiken. Es ist ein Weckruf.
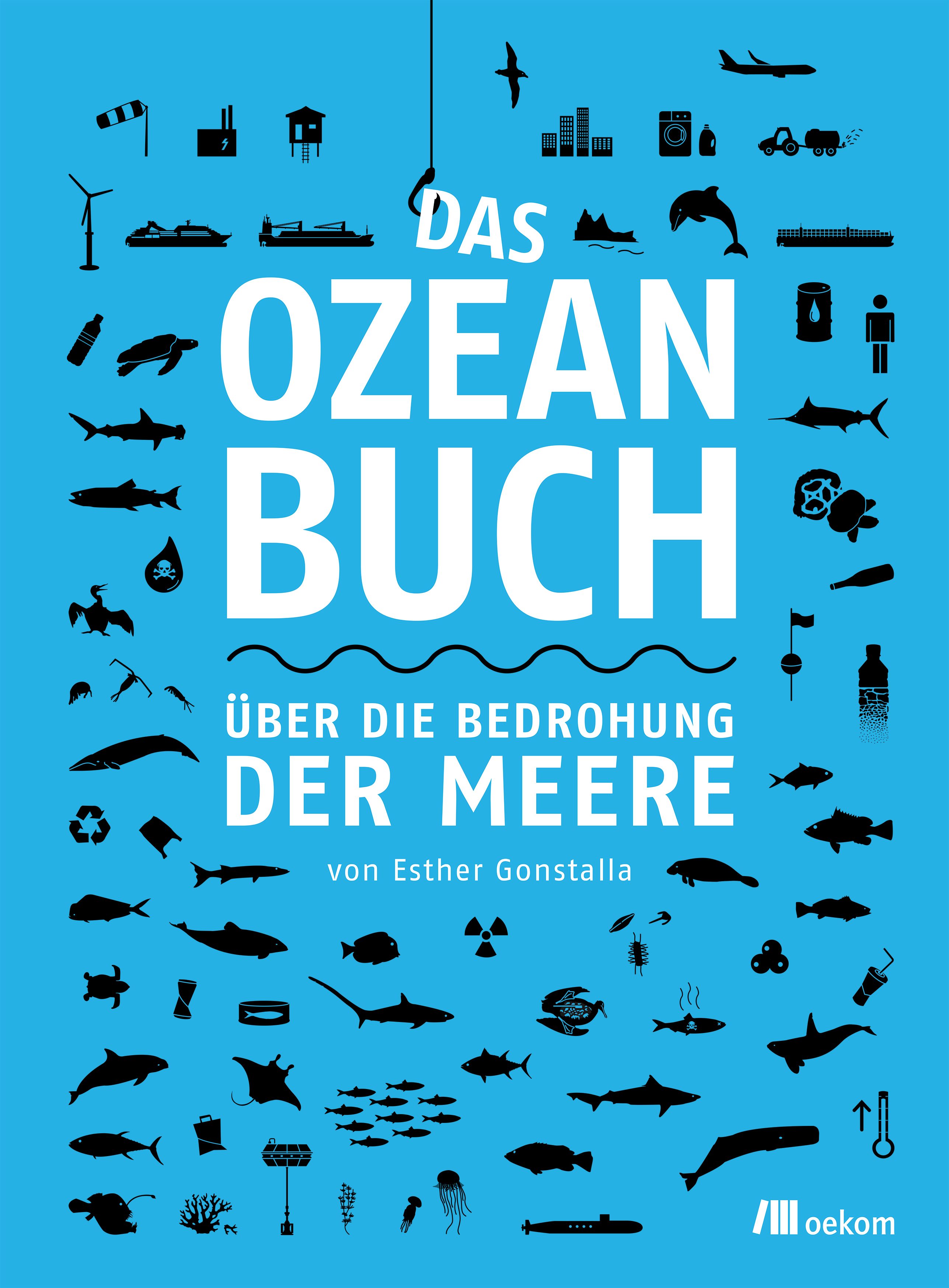
Esther Gonstalla zeigt, wie das Klima funktioniert, illustriert die Kippelemente und den Klimatreiber Mensch in globaler und regionaler Sicht. Anschaulich und verständlich informiert sie über die weltweiten Auswirkungen, wichtig sind ihr Lösungsansätze. Klimaschutz, macht dieses Buch klar, beginnt zu Hause. Aus dem Jahr 2017 – und in keiner Hinsicht veraltet – ist ihr komplementäres „Ozeanbuch. Über die Bedrohung der Meere“, ebenfalls aus dem klimaneutral und mit höchsten Umweltansprüchen produzierenden oekom Verlag. In ebenfalls 50 Infografiken macht Gonstalla hier das Verhältnis von Mensch und Meer begreifbar. Beispielhaft für ihre schönen Visualisierungsideen: die kleinen Wellen auf dem Vorsatzpapier, gefolgt von einer Seite, auf der ein Angelhaken eine Plastikflasche am Haken hat. Das Buch zeigt den Verlust den biologischen Vielfalt, den Ozean als Industriegebiet, die Probleme von Überfischung, Verschmutzung und Klimawandel. In 300 Jahren, macht eine der Grafiken klar, könnte der Meeresspiegel bis zu fünf Meter höher liegen.
- Esther Gonstalla: Das Klimabuch. Alles, was man wissen muss, in 50 Grafiken. Oekom verlag, München 2019. 128 Seiten, 24 Euro.
- Esther Gonstalla: Das Ozeanbuch. Über die Bedrohung der Meere. Oekom verlag, München 2019. 128 Seiten, 24 Euro.
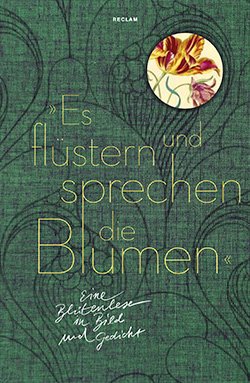
Wunderbares Brevier
(AM) Karl-Heinz Göttert, der auch das großartige und wichtige Werk „Als die Natur noch sprach“ verantwortet – Besprechung siehe weiter oben in dieser Rubrik -, zeichnet für diese Anthologie von Blumen-Gedichten verantwortlich. Kundiger geht es also kaum. Man könne kaum sagen, wen Blumen mehr anregen, schreibt er im Nachwort, die Maler oder die Dichter? Göttert beantwortet es, indem er in diesen vorzüglich ausgestatten Band beiden Kunstgattungen einen großen Auftritt gibt.
Dies ist ein Buch zum Behalten und Verschenken. Eines, in dem man viele Entdeckungen machen kann. Pflanzenporträts haben darin ebenso großzügigen Platz wie die Worte. Die Leseprobe gibt einen Eindruck. Ein wunderbares Brevier zum Andachthalten, mit farbigen Blumenzeichnungen von Maria Sibylla Merian, Albrecht Dürer, Pierre Joseph Redouté und anderen. Eine Kostbarkeit – mit kundigem Nachwort und solidem Registerteil. 45 Gedichte von Eduard Mörike, Clemens Brentano, Elisabeth Langgässer, Joachim Ringelnatz, Rainer Maria Rilke, Paul Celan, Peter Huchel, Klabund oder Heinrich Heine schweifen durch die Blumenwelt, flüstern und sprechen. Der Aufklärer Lessing tritt mit einer Iris in Erscheinung, der beißende Satiriker Karl Kraus mit dem Flieder.
- Karl-Heinz Göttert (Auswahl): „Es flüstern und sprechen die Blumen“. Eine Blütenlese in Bild und Gedicht. Philipp Reclam jun. Verlag, Ditzingen 2019. Bedrucktes und geprägtes Leinen, Fadenheftung, Lesebändchen. 128 S. 44 Farbabb., 18 Euro.
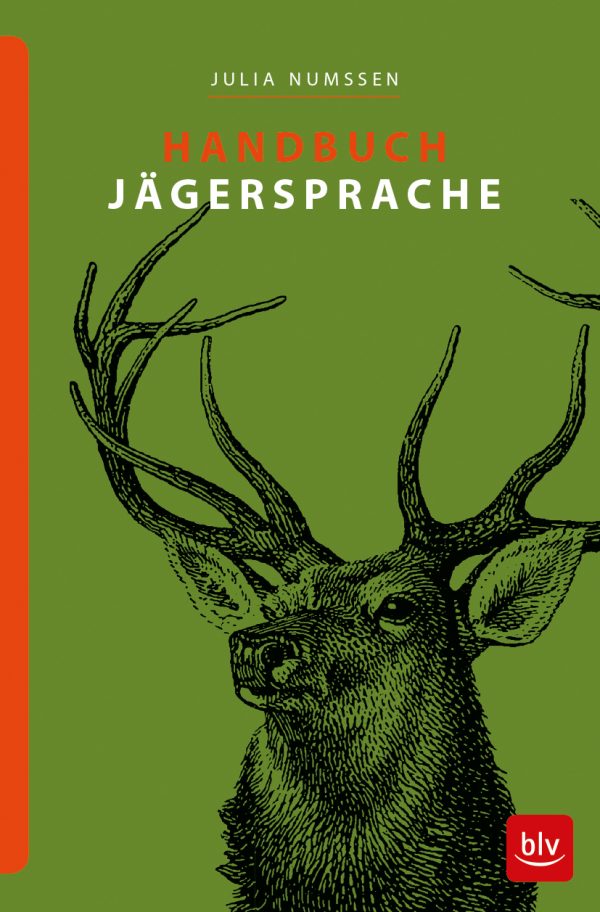
Brunftkugeln, Büchsenlicht und Schlachter
(AM) „Mit den Namen vergeht auch die Kenntnis der Dinge”, wusste Carl Linnaeus. Robert Macfarlane richtete mit „Die verlorenen Wörter“ einen bildschönen Appell gegen den Verlust von Begriffen und damit von Erfahrung und Sinnlichkeit (CulturMag-Besprechung hier). „Jede Wissenschaft, jede Kunst, selbst jedes Handwerk hat eigene Ausdrücke, um Werkzeuge, oder Handlungen, oder sonst Gegenstände auf eine kurze Art zu bezeichnen“, leitete Georg Ludwig Hartig 1809 seine „Anleitung zur Forst- und Waidmannssprache“ ein. Ihre Anfänge gehen ins 12. Jahrhundert als Zunftsprache der Berufsjäger, beschränkte sich erst auf Rotwild- und Hochwildjagd, Falknerei und Vogelfang. Erst ab dem 17. Jahrhundert wurden verstärkt Begriffe aus der Niederwildjagd aufgenommen.
Die Fotografin Julia Numßen geht seit ihrem 16. Lebensjahr auf die Jagd, schreibt für renommierte Jagdzeitschriften, ist Chefredakteurin des Jagdmagazin „Passion“. Ihr „Handbuch Jägersprache“ versammelt viel alten Wortschatz und aktuelle Fachbegriffe: von Aalrute (kurz und glatt behaarte, unkupierte Rute bei Jagdhunden) über Bache (weibliches Wildschwein vom 3. Lebensjahr an), Jacke (Behaarung des Hundes), Quäke (Lockinstrument zur Nachahmung der Hasenklage), schweißen (bluten) bis zählen (das langsame Knappen des Auerhahns) und Zylinderverschluss (bei Repetierbüchsen). Abstreichen gibt es bei beim leichten Federwild, das wegfliegt oder abstäubt, oder beim schweren Federwild, das abdonnert und abreitet wie der Auerhahn. Abschwarten ist das Häuten von Schwarzwild und Dachs. Blädern nennt man die meckernden Brunftlaute des Gamsbocks, Brunftkugeln die Hoden des männlichen Schalenwilds, Büchsenlicht das abnehmende Licht am Abend, das noch für einen sicheren Schuss ausreicht. Die Zeit der Abenddämmerung, in der die Eulen fliegen, ist die Uhlenflucht. Der Daumensprung dient zum Ermitteln des dominanten Schießauges, der beim Damhirsch häufiger als beim Rotwild oder Rehbock auftretende Doppelkopf ist eine Abnormität der Geweihbildung. Faseln heißt es, wenn ein Jagdhund unsicher umherirrt. Fehlstoß ist der missglückte Versuch eines Greifvogels, Beute zu schlagen. Kirren, das Anlocken von Wild durch ausgelegtes Futter. Schlachter steht für einen Bären, der bevorzugt zahmes Vieh schlägt. Im Anhang gibt es noch ein englischsprachiges Glossar rund um die Jagd.
- Julia Numßen: Handbuch Jägersprache. BLV Buchverlag, München 2017. 192 Seiten , 15 Zeichnungen, 15 Euro.
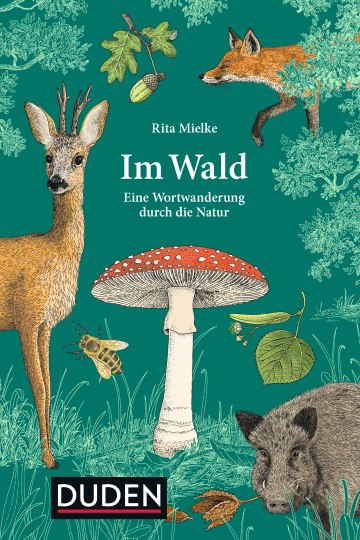
Der Hirsch als Vater vom Rehkitz?
(AM) Erich Kästner gibt das Motto vor: „Mit Bäumen kann man wie mit Brüdern reden/ und tauscht bei ihnen seine Seele um./ Die Wälder schweigen. Doch sie sind nicht stumm./ Und wer auch kommen mag, sie trösten jeden.“ Die Kulturjournalistin Rita Mielke sieht sich 32 Worte aus dem Wald näher an und bringt sie mit literaturwissenschaftlichem Blick zum Reden. Das fibelgroße Buch ist von Hanna Zeckau illustriert, führt von Adler und Ameise, Birke und Brennnessel, Fichte und Fledermaus über Linde und Mistel zu Reh und Specht, Wildschwein und Wolf.
Angelus Silesius („Heilige Seelenlust“, 1657) etwa definierte die Seele des Menschen als Reh und Jesus als den heilbringenden Jäger. In Marie von Ebner-Eschenbachs „Gemeindekind“ von 1887 symbolisiert die Tötung eines Rehs die Zerstörung der natürlichen Harmonie, das ist auch noch so bei Felix Saltens „Bambi“ (1923). Bei Walt Disney machte man, weil Rehe in Nordamerika nicht vorkommen, daraus Weißwedelhirsche, die deutsche Synchronisation ignorierte und sprach vom Rehkitz. Rita Milke dazu: „So glaubt wegen Bambi ein Großteil der Deutschen, der Hirsch sei der Vater vom Rehkitz (und nicht, wie im Film gezeigt, von einem Hirschkalb) und somit das Reh die Frau vom Hirsch“.
- Rita Mielke: Im Wald – Eine Wortwanderung durch die Natur. Mit Illustrationen von Hanna Zeckau. Bibliographisches Institut/ Duden, Berlin 2019.160 Seiten, 15 Euro.

Individuelle Porträts
(AM) Gut 50 Vogelarten sind es, denen in Henning Ziebritzkis eben gerade im Göttinger Wallstein Verlag erschienenen Gedichtband „Vogelwerk“ auf sehr einzigartige Weise begegnet werden kann. Kohlmeise und Rabenkrähe, Singdrossel oder Wasseramsel, Rohrmeise oder Kormoren, Teydefink, Teichrohrsänger oder Sanderling, Zaunkönig, Mehl- oder Rauchschwalbe, Schwarzspecht, Habicht, Turmfalke oder Gimpel, Rotkehlchen, Waldkauz oder Austernfischer sind unter ihnen. Jedes Gedicht ist anders, hat einen anderen Zugang, folgt einem anderen Impuls. Immer hat der Autor genau hingesehen, oft hingesehen. Manchmal erfahren wir ihn ebenso (beinahe) viel wie über den porträtierten Vogel.
Der studierte Theologe, der den Wissenschaftsverlag Mohr Siebeck leitet und Gedichte und Essays in Anthologien und Zeitschriften wie Jahrbuch der Lyrik, Akzente, Sinn und Form oder Neue Rundschau veröffentlicht, ist ein großer Vogelkenner – und Liebhaber.Auch von der Haltung her korrespondieren seine sehr feinsinnigen und ausdrucksstarken Gedichte mit Arnulf Conradi und seiner Zen-Kunst der Vogelbeobachtung (Besprechung hier weiter oben).
In Downtown Atlanta etwa, in einer Bar, offenkundig bei einer Zwischenlandung, stellt er sich vor, wie er im Oderbruch auf den Seggenrohrsänger warten wird,
„… stunden-, tagelang angespannt unbewegt
in der schönen Segge, in Sandsegge, Handsegge, Haarsegge,
um dich wiederzufinden …“
Und er stellt sich vor, wie dieser Vogel mit seinem Streifenkleid sich vielleicht doch noch zeigen wird, wenn er aufsteht und die Bar verlässt, ihm dann offenbart, wohin die Reise denn wirklich geht.
- Henning Ziebritzki: Vogelwerk. Gedichte. Wallstein Verlag, Göttingen 2019. 64 Seiten, gebunden, 18 Euro.
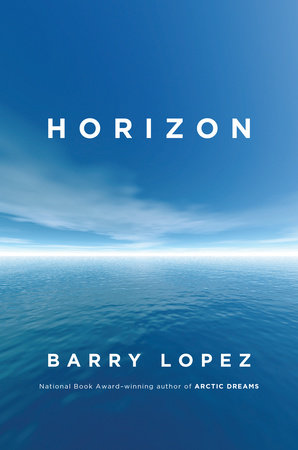
Dunkelheit und Licht
(AM) Passend, unsere Kurzrezensionen mit einem Blick auf den Horizont ausklingen zu lassen – auf „unsere unendliche Sehnsucht“, wie Didier Maleuvre sein philosophisches Standardwerk „The Horizon“ (Univ. of California, 2011) im Untertitel nennt. Ebenso passend, dass der auf sein 75. Lebensjahr zusteuernde große Barry Lopez seinem Vermächtnis solch einen Titel gibt. Wie eine dicke Baumrinde fühlt sich der Rauschnitt des 576 Seiten starken Buches an. In acht großen Kapiteln reist der Essayist, Ethnologe und Fotograf durch sein Leben und durch alle Kontinente, insgesamt in mehr als 70 Länder. 20 Seiten stark ist das Orts- und Namensregister.
1978 veröffentlichte er in Anlehnung an einen Titel John Steinbecks „Of Wolves and Men“ (Von Wölfen und Menschen), seine „Arctic Dreams“ von 1986 brauchten bis 2000 zu einer deutschen Übersetzung. Keine große Hoffnung also, dass dieses Buch bald folgt. Dabei hat Lopez viel zu sagen. Er hat Demut und Stoik, er ist neugierig und ehrlich, er zweifelt, er trauert, er ist wild. Was hat einer wie er bei seinen Reisen gelernt? In einem Satz: „Wir Menschen sind die Dunkelheit, so wie wir auch das Licht sind.“
Beim Reisen, zitiert er Saint-Exupéry als Motto, geht es vor allem darum, seine Haut zu wechseln.
- Barry Lopez: Horizon. Alfred A. Knopf, New York 2019. 576 pages, with 13 maps and 3 illustrations, $ 30.











