
Bloody Chops – kurz, hart, aber gerecht …
Heute auf dem Block: Marisha Pessl: „Die amerikanische Nacht“ gechopt von Karsten Hermann (KaHe), Pontus Ljunghill: „Der Mann im Park“, bearbeitet von Joachim Feldmann (JF) und der 18. Reacher-Roman von Lee Child: „Never go back“, am Beil Alf Mayer (AM).
 Im Sog des Bösen
Im Sog des Bösen
(KaHe) Sieben Jahre nach ihrem Debüt „Die alltägliche Physik des Unglücks“ legt die junge US-Amerikanerin Marisha Pessl einen packenden Spannungsroman vor, der die Grenzen der Wirklichkeit auslotet und auf ihre dunklen und magischen Seiten führt. Im Mittelpunkt stehen der Journalist Scott McGrath sowie der geheimnisumwitterte und untergetauchte Horror-Kult-Filmemacher Scott Cordova. Vor Jahren hatte sich McGrath bereits auf die Fährte von Cordova gesetzt und ihn verdächtigt, das Böse und Schockierende nicht nur in seinen Filmen zu zelebrieren, sondern Kunst und Leben gewissenlos zu vereinen. Ein Vergleich des Filmemachers mit Charles Manson hatte ihn dann seine Karriere und letztlich auch noch seine Familie gekostet.
 Als Cordovas Tochter Ashley auf mysteriöse Weise in New York ums Leben kommt, nimmt McGrath seine abrupt beendeten Recherchen wieder auf. Unterstützung findet er bei dem jungen Drogendealer Hopper, der in einer geheimnisvollen Beziehung zu Ashley steht, sowie der gerade in Manhattan gestrandeten und eine Schauspiel-Karriere anstrebenden Nora. Bei seinen Recherchen stößt das Trio neben einem Mosaik aus Zeugen und Hinweisen auch auf die „Blackboards“, eine versteckte „Deepnet“-Website für eingeschworene Cordova-Fans. Nach und nach wird für Scott McGrath ein Bruch in der bisherigen Gewissheit und Wahrheit der Welt spürbar und er droht sich in einem Spiegelkabinett aus Traum, Rausch, Magie und Film(-kulissen) zu verlieren.
Als Cordovas Tochter Ashley auf mysteriöse Weise in New York ums Leben kommt, nimmt McGrath seine abrupt beendeten Recherchen wieder auf. Unterstützung findet er bei dem jungen Drogendealer Hopper, der in einer geheimnisvollen Beziehung zu Ashley steht, sowie der gerade in Manhattan gestrandeten und eine Schauspiel-Karriere anstrebenden Nora. Bei seinen Recherchen stößt das Trio neben einem Mosaik aus Zeugen und Hinweisen auch auf die „Blackboards“, eine versteckte „Deepnet“-Website für eingeschworene Cordova-Fans. Nach und nach wird für Scott McGrath ein Bruch in der bisherigen Gewissheit und Wahrheit der Welt spürbar und er droht sich in einem Spiegelkabinett aus Traum, Rausch, Magie und Film(-kulissen) zu verlieren.
Marisha Pessl erweist sich auch in ihrem zweiten Roman als Erzählerin mit schäumender Fantasie, atmosphärischem Gespür sowie originellen Bildern und Vergleichen. Sie schafft eine dichte Atmosphäre und hat als authentische Realitäts-Zitate auch eingescannte Zeitungsberichte, Zeugenaussagen und (gefakte) Screenshots von Websites aufgenommen. En passant steigt sie dabei tief in die Welt des Films und seiner Bildsprache sowie in die abseitigen Bereiche der Magie und der Hexerei ein.
„Die amerikanische Nacht“ ist ein klug und virtuos inszeniertes Spiel mit einer Wirklichkeit, die nur die sichtbare Spitze eines darunter lauernden mächtigen Eisberges voller dunkler Geheinisse zu sein scheint. Der Leser findet sich in einem Zwielicht wieder, in dem nichts mehr wahr und alles möglich zu sein scheint – selbst ein faustischer Pakt mit dem Teufel: „Wir wissen nicht, wo der Glaube endet und die Realität beginnt.“ Fast mühelos gelingt es Marisha Pessl so, auch über 800 Seiten die Spannung stetig zu steigern und ihren Roman zu einem echten „Pageturner“ mit einem überraschenden Ende zu machen.
Marisha Pessl: Die amerikanische Nacht (Night Film. A Novel, 2013). Roman. Deutsch von Tobias Schnettler. Frankfurt am Main: S. Fischer 2013. 790 Seiten. 22,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch. Mehr zu Marisha Pessl.

 Nachdenklich
Nachdenklich
(JF) John Stierna ist noch keine sechzig, als er 1953 vorzeitig den Polizeidienst quittiert. Die letzten Jahre hat er damit verbracht, Informationstexte für die Schaukästen im Stockholmer Kriminalmuseum zu verfassen. Das war sein eigener Wunsch. Doch nun ist auch damit Schluss. Stierna nimmt die Fähre zur Insel Gotland, wo er sich in einer Pension einmietet. Wann er in die Stadt zurückkehren wird, weiß er nicht.
Es ist lange her, ein Vierteljahrhundert, da war John Stierna der jüngste Kommissar in der Kriminalabteilung der Stockholmer Polizei. Als die achtjährige Ingrid Bengtsson ermordet wird, übernimmt er die Ermittlungen in der festen Überzeugung, den Fall bald aufgeklärt zu haben. Er werde den Mörder finden, verspricht er der Mutter des Kindes. Doch trotz akribischer Polizeiarbeit führt keine der vielversprechenden Spuren zu einer Verhaftung. Der Fall wird zu den Akten gelegt. Aber im Leben des Kommissars ist nichts mehr wie vorher. Und Ingrid Bengtsson wird er nie vergessen.
Das mag der Grund dafür sein, dass Stierna einem Journalisten, der ihn in seiner Pension auf Gotland aufsucht, um ihn für eine Artikelserie über historische Kriminalfälle zu interviewen, bereitwillig Rede und Antwort steht. Der Zeitpunkt könnte kaum passender gewählt sein, denn nur wenige Tage später wird das Verbrechen verjähren und der Täter straffrei ausgehen.
„Der Mann im Park“ ist der Debütroman des schwedischen Kriminologen und Journalisten Pontus Ljunghill, auf dessen Cover der Heyne-Verlag die höchst unpassende Genrebezeichnung „Thriller“ gedruckt hat. Glücklicherweise haben wir es nämlich nicht mit einem jener auf oberflächliche Reize angelegten Psychokiller-Märchen zu tun, die momentan den Markt überschwemmen. Fernab eines jeden Sensationalismus erzählt Ljunghill davon, wie ein Gewaltverbrechen die Menschen, die mit ihm in Berührung kommen, verändert. Dass er dabei seinen Lesern die zermürbenden Details der polizeilichen Ermittlungsarbeit nicht erspart, gehört ebenfalls zu den Vorzügen dieses nachdenklichen Kriminalromans. Am Ende ist die Identität des Mörders kein Rätsel mehr, aber das hilft dem ehemaligen Kommissar wenig. Was geschehen ist, ist geschehen. Und eine Strafe wird es nicht mehr geben.
Das ist nicht unbedingt neu. Pontus Ljunghill erweist nicht nur einem Klassiker der Kriminalliteratur seine Reverenz. Doch die Art und Weise, wie hier Realismus und Mythologie des Genres zusammengeführt werden, macht das Buch lesenswert.
Pontus Ljunghill: Der Mann im Park (En Onsynlig. 2012). Roman. Deutsch von Christel Hildebrandt. München: Heyne: 2013. 560 Seiten. 16,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.

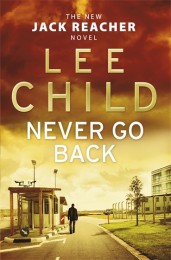 Des Wartens wert – Lee Childs 18. Thriller mit Jack Reacher
Des Wartens wert – Lee Childs 18. Thriller mit Jack Reacher
(AM) So witzig war er noch nie, so den Frauen zugewandt und dabei so cool und selbstironisch. Es hat mich Anstrengung gekostet, die Lektüre von Lee Childs gerade in den USA und England herausgekommenen achtzehnten (!) Jack-Reacher-Thriller auf zwei Tage zu strecken. Am liebsten hätte ich „Never Go Back“ in einem Rutsch verschlungen, 400 Seiten Dauerspaß, intelligente Lektüre – und dieses Mal etwas ganz Besonderes. Reacher kehrt nämlich an seinen Anfang zurück, zu seiner „homebase“, dem Hauptquartier der 110. Military Special Unit in Rock Creek nahe Washington D.C., das aus romantischem Interesse.
Vor vier Büchern (in „61 Stunden“, das am 28. Oktober bei uns erscheint) hatte er eines aktuellen Falles wegen mit seiner alten Einheit telefoniert, als seinen Nachfolger eine Frau ans Telefon bekommen. Major Susan Turners Stimme veranlassten ihn, den wohnsitz- und kofferlosen Vagabunden, quer durch die USA zu trampen. Drei Fälle hielten ihn auf, aber jetzt ist er da. Und sie warten schon auf ihn. Als er in sein altes Zimmer tritt, um endlich seine Nachfolgerin zum Abendessen auszuführen, sitzt da ein Mann, der ihm eröffnet: Reachers Arsch gehöre ihm, technisch sei er immer noch Soldat, er stünde unter Arrest, bekomme zwei Army-Anwälte gestellt, für ein altes Mordverfahren und für etwas noch Schockierendes, Susan Turner sitze wegen Korruption im Gefängnis, wolle ihn nicht sehen.
 Ob er denn viele sexuelle Verbindungen gehabt habe in seinem Leben, fragt ihn die eine Anwältin. So viele wie nur möglich, antwortet er. Er möge Frauen und schätze, das sei halt eine biologische Sache. Nun, eine dieser Begegnungen hatte wohl Folgen. Seine Tochter sei 14, lebe in Los Angeles, und er sei gehörig Unterhalt schuldig geblieben. Während seiner Stationierung in Korea soll es passiert sein, Reacher kann an die Mutter nicht mal erinnern. Das nagt.
Ob er denn viele sexuelle Verbindungen gehabt habe in seinem Leben, fragt ihn die eine Anwältin. So viele wie nur möglich, antwortet er. Er möge Frauen und schätze, das sei halt eine biologische Sache. Nun, eine dieser Begegnungen hatte wohl Folgen. Seine Tochter sei 14, lebe in Los Angeles, und er sei gehörig Unterhalt schuldig geblieben. Während seiner Stationierung in Korea soll es passiert sein, Reacher kann an die Mutter nicht mal erinnern. Das nagt.
Erst einmal aber hat er anderes zu bewerkstelligen. Und tatsächlich, mit einem brillanten Kabinettstück der Abwägung und Nutzung von Wahrscheinlichkeiten gelingt es ihm, im gleichen Militärgefängnis wie Susan Turner zu landen, mehr noch, tatsächlich mit ihr hinauszuspazieren. Die Passage ist atemberaubend, dazu Screwball-Comedy pur. Geile Dialoge, funkensprühende Situationskomik. „Well worth the wait“, all des Wartens wert, das ist sie nämlich: Major Susan Turner. Reacher sagt sich das, sich in den Arm kneifend, mehrmals wieder. Seit Elmore Leonards Gefangenenausbruchsszene in „Out of Sight“, von Stephen Soderbergh kongenial mit George Clooney und Jennifer Lopez verfilmt, habe ich ein derart knisterndes Stück Thrillerliteratur nicht mehr gelesen. Alle Achtung, Mr. Child, da haben Sie sich selbst übertroffen!
Ab Seite 110 sind die beiden auf der Flucht, wer Reacher kennt, weiß, dass jetzt ein Achterbahnritt beginnt (Alf Mayer über Jack Reacher). Es ist eine neue, mit neuen Gleisen, Lee Child brennt ein Feuerwerk von Einfällen ab, wie ich es so noch in keinem seiner Thriller erlebt habe.
Zeit also, allerhöchste Zeit, dass der in Deutschland für Lee Child zuständige Verlag Blanvalet endlich Tempo zulegt. Zurzeit hinken die deutschen Übersetzungen FÜNF Romane hinterher.
„Well worth the wait“, das ist Lee Child, aber es muss ja doch nicht Folter werden.
Lee Child: Never Go Back. (Jack Reacher 18). Bantam Press 2013. 416 Seite. 12,95 Euro. Zum Autor und seinen Büchern bei Bantam Press und Blanvalet. Mehr zu Jack Reacher bei CrimeMag hier, hier und hier sowie bei kaliber.38. Zur Homepage von Lee Child.












