
Bücher, kurz serviert
Kurzbesprechungen von fiction und non fiction. Zerteilt und serviert von: Joachim Feldmann (JF), Alf Mayer (AM), Frank Rumpel (rum), Thomas Wörtche (TW).
Bücher von: Lee Child, Karen Dionne, Garrett M. Graff, Uta-Maria Heim, Robert Hültner, Institut für Sozialforschung, Pankaj Mishra, Antonin Varenne, Donald E. Westlake.
 Was ist das, das da mordet?
Was ist das, das da mordet?
(AM) „Mittelweg 36“, die zweimonatliche Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung, haben wir bei CrimeMag schon des öfteren vorgestellt, immer wieder wartet die Redaktion mit Themen und Heften auf, die uns im Crime-Zusammenhang interessieren. Das aktuelle Heft nun wirkt, als hätten sich die Hamburger punktgenau mit dem Team von Krimis machen 3 abgesprochen. Der Heft-Schwerpunkt „Antun und Erleiden. Über Gewalt“ ist eine überaus empfehlenswerte Vorlektüre für die Podiumsdiskussion des ersten KM3-Nachmittags (Programm hier), bei der Autorinnen und Autoren und Kritiker über – ja nun – das Thema Gewalt diskutieren werden.
„Was ist das, das in uns
lügt, mordet, stiehlt?“
lässt „Mittelweg 36“ als Heftmotto Georg Büchner fragen. Und ja, was ist das eigentlich, das der Kriminalliteratur ihren Anlass gibt? Aus unterschiedlichen Positionen nähern sich Wolfgang Knöbel („Perspektiven der Gewaltforschung“) und Peter Imbusch („Strukturelle Gewalt“) dem Thema an, Teresa Koloma Beck spricht über „Gewalt als leibliche Erfahrung“. Jan Philipp Reemtsma, Gründer und Spiritus Rector des Instituts, liest – luzide und bedenkenwert wie immer – der Sozialwissenschaft, den Medien und eben auch Kriminalautoren, Lesern und Kritikern die Leviten, die mit all dem vorherrschenden Erklärungsbegehren, das Gewalt sofort hervorruft, das zivilisatorische Problem „Gewalt“ möglichst schnell in (irgend) eine Schublade stecken möchten. „Das Erklärungsbegehren“, schreibt er, „begehrt Einsinnigkeiten, wo sie nicht zu haben sind.“ Zwei Seelen ach, hausen zivilisationsgründend seit Kain und Abel in des Menschen Brust, Modernität und Barbarei, das hat uns das 20. Jahrhundert um die Ohren gehauen, sind keine Gegensätze. Reemtsma schlägt vor, Gewaltmilieus nicht zu erklären, sondern zu beschreiben. Womit wir wieder bei guter Kriminalliteratur und bei „Krimis machen“ sind.
Wir sehen uns dann, 1. bis 3.9. in Hamburg.
Mittelweg 36. Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Schwerpunkt: Antun und erleiden. Über Gewalt. 26. Jahrgang, Heft 3, Juni/ juli 2017. 114 Seiten, 9,50 Euro.
Natur (1): Die Provinz ist toxisch
(TW) Ein ganz schweres Kaliber ist Antonin Varenne. „Die Treibjagd“ ist sein drittes auf Deutsch erschienenes Buch (und im Vergleich zu dem Genrehybrid „Die sieben Leben des Arthur Bowmann„) ein böser Kriminalroman sui generis. Ein giftiges Buch aus dem Massif Central, in der Tradition von Jean-Patrick Manchette und Pierre Magnan. Allein die Schilderung des ökonomischen Niedergangs der fiktiven Stadt „R“ und den damit einhergehenden sozialen und psychologischen Verwerfungen ist ein stilistisches Glanzstück (von Susanne Röckel bestens übersetzt). Die Erzählstruktur, zeitlich originell um ein paar Kernereignisse gruppiert, ist ebenso spannend wie die Story und die Figuren. Im Grunde ist der Roman eine Romeo-und-Julia-auf-dem-Lande-Paraphrase – ein Außenseiter, der durch einen Unfall an Leib und Seele verletzte Jäger namens Rémi Parrot, ist mit der Tochter des Clan-Chefs der Messenets in Liebe verbunden. Die Messenets wiederum sind wiederum einer der beiden herrschenden Familien in der Gegend, ein dritter Clan besteht aus Roma, die sich als immer wieder angefeindete Wanderarbeiter durchschlagen. Mit um die abnehmenden Ressourcen des Departements zanken sich Investoren, Gewerkschafter und Naturschützer, die Polizei kann nur beobachten. Dann eskalieren die Dinge während einer Treibjagd auf Wildschweine, die für die lokalen Honoratioren veranstaltet wird. Die raue, wunderschöne, aber gefährdete und schon verwundete und geschundene Natur spielt eine große Rolle in dem Buch, sie schreibt sich in die harten, kantigen Figuren ein, die in der Gegend leben wollen oder müssen. Die profitgeile Ausbeutung der Landschaft richtet Verheerungen in den Seelen der Menschen an, es gibt keine geschützten Residuen mehr. Das ist brutal, und so kann das Buch auf sensationalistische Thrills verzichten, die Story und ihre Inszenierung sind hart genug. Grandios.
Antonin Varenne: Die Treibjagd (Battues, 2015). Roman. Dt. von Susanne Röckel. München: Penguin 2017, 302 Seite, € 10,00
Zu Varenne bei CrimeMag. Zum Buch geht’s hier entlang.
Beginn einer Landstreicherkarriere
(AM) Zwanzig Jahre nun schon schreibt Lee Child seine Jack-Reacher-Serie. Wir bei CrimeMag sind Fans und haben Ihnen diesen gerade auf Deutsch erschienenen 16. Jack Reacher-Roman bereits im Oktober 2012 vorgestellt (Besprechung von Peter Münder hier). Das Buch wurde vom deutschen Verlag erst einmal zugunsten des Susan-Turner-Quartetts beiseite gelassen: „61 Stunden“, „Wespennest“, „Der Anhalter“, „Die Gejagten“. Jetzt im Oktober erscheint in USA und England mit „The Midnight Line“ bereits Reacher Nummer 22. Blanvalet, Lee Childs deutscher Verlag, ist in Verzug und mit den Übersetzung mit „Die Gejagten“ erst bei Nr. 18 angelegt. „Der letzte Befehl“ (gar keine so dumme Eindeutschung von „The Affair“) ist ein Angelpunkt im Oeuvre Lee Childs. Bei CrimeMag hat er exklusiv erzählt, wie er einst seine Figur erfand.
„Der letzte Befehl“ ist ein Prequel und spielt sechs Monate vor dem allerersten Reacher-Roman – vor „Größenwahn“ (Killing Floor, 1997). Hier nun erfahren wir, wie Reacher zu dem Mann geworden ist, den man fürchten muss. Hier erfahren wir, warum er den Dienst bei der Militärpolizei quittiert hat und jener besitzlose Landstreicher wurde, als den wir ihn kennen. Es war ein Mordfall in einem kleinen Kaff am Mississippi, der Mörder der jungen Frau stammte vermutlich aus Fort Kelham, der großen Militärbasis der Army Rangers, von denen Reacher damals einer war. Er bekommt den Auftrag, eben jenen letzten Befehl, Peinlichkeiten für das Militär zu vermeiden – der Sohn eines prominenten, für Rüstung zuständigen Senators scheint darin verwickelt – und mit dem örtlichen Sheriff zusammenzuarbeiten. Netterweise ist das eine starke Frau: Elizabeth Deveraux. Kann er ihr trauen? Und wem überhaupt? Am Ende sind es der Schweinereien so viele und so große, dass er den Dienst quittiert und fort lieber an als Tramper an der Straße steht.
Anders als die meisten Reachers ist das Buch in der ersten Person geschrieben. Am Ende heißt es: „Ich war 36 Jahre alt, Bürger eines Landes, das ich bisher kaum kannt, und es gab Orte, die ich sehen, und Dinge, die ich tun wollte… Ich wählte die nächste Ausfallstraße, stellte einen Fuß auf den Randstein und einen auf die Fahrbahn und reckte den Daumen hoch.“
So haben wir ihn dann kennengelernt. Move on, Reacher!
Lee Child: Der letzte Befehl (The Affair, 2011). Deutsch von Wulf Bergner. Blanvalet Verlag, München 2017. 448 Seiten, 19,99 Euro.
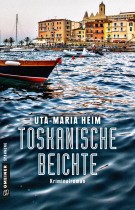 Vatikanische Verwicklungen
Vatikanische Verwicklungen
(rum) Auch wenn der Titel nach seichter Sommerunterhaltung klingt, der sich ohne viel Aufhebens einreiht in die Menge höchstens mäßiger Urlaubskrimis, die da von Hiesigen geschrieben an von Hiesigen geschätzten Ferienorten spielen: Uta-Maria Heims „Toskanische Beichte“ ist im Ansatz auch das, darüber hinaus aber ein herrlich abgedrehter Kriminalroman.
Da wird dem katholischen Pfarrer Justus Fischer im Beichtstuhl ein Handy zugespielt, das ihn erst zu einem Gerichtspsychiater und dann weiter in die Toskana führt. Fischer soll für eine geheime vatikanische Organisation rekrutiert werden, die dem zurückgetretenen Papst Benedikt gerne ein Wunder (gute Voraussetzung fürs Seligsprechungsverfahren) attestieren würde. Fischer indes ahnt nichts, fürchtet viel mehr seine Exkommunizierung. Er macht sich dennoch auf den Weg, verbringt einige Tage zusammen mit seinen greisen Großeltern und seiner behinderten Schwester Sarah auf einem toskanischen Campingplatz. Und dort stellt sich heraus, dass Fischers Großeltern einst Mitglied einer papstkritischen Kirche von unten waren. Und die scheint sich inzwischen zu einer kirchlichen Untergrundorganisation gemausert zu haben, die Selig- und Heiligsprechungsverfahren verhindern will und dabei auch zu robusten Methoden greift. Derweil ist die Vatikanbank in der Krise, die Kirche schwächelt, da wäre ein Wunder durchaus hilfreich. „Nachforschungen wurden angestellt, Gremien gebildet. Halbwissen paarte sich mit wissenschaftlichem Dilettantismus“, heißt es da. Und dann dräut über allem noch Fischers Trauma. In Kindertagen war beim Spielen eine seiner Schwestern spurlos verschwunden.
All das hat Uta-Maria Heim zu einer flirrenden, ziemlich unübersichtlichen Geschichte zusammengeschnürt, in der auch noch eine junge Autorin mit einem Enthüllungsroman über die Kirche und gefakte NSA-Abhörprotokolle geheimster Geheimabteilungen des Vatikans eine Rolle spielen. Dazu gibt’s bestens getroffene Alltagsszenen zwischen Bodensee und toskanischem Campingplatz. Heim flicht reale Versatzstücke, Verschwörungstheorien und wilde Ideen zusammen, spitzt gnadenlos zu, bis das Ganze so vollkommen hanebüchen ist, dass es prima funktioniert, was auch daran liegt, dass Heim einfach virtuos zu erzählen und scharfsinnig auszuteilen weiß. Sie schafft sich hier mal wieder reichlich Gelegenheit, quer zu allen Erwartungshaltungen zu schreiben und auf dem Weg dem Wahnwitz des Alltags eine Nische in guter Gesellschaft zu schaffen. Ein großer Spaß und damit nicht zuletzt auch ganz wunderbare Urlaubslektüre.
Uta-Maria Heim: Toskanische Beichte. Gmeiner-Verlag, 340 Seiten, 15 Euro.
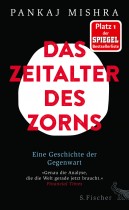 Must know …
Must know …
(TW) Wer die Welt zumindest ein bisschen verstehen will, muss sich wenigstens ein bisschen auskennen. Sonst landen wir bei schlichten Weltbildern, und nichts wäre fataler als das. Dazu braucht man Theorie, und die ist kein Luxus, sondern dringend notwendig.
Weil nichts irgendwie vom Himmel fällt, sondern schon seit langem in verschiedenen Modulationen schwelt, hat Pankaj Mishra in „Das Zeitalter des Zorns. Eine Geschichte der Gegenwart“ unsere gewalttätige Gegenwart auf die Bedingungen ihrer Entstehung abgeklopft.
Pankaj Mishra, global renommierter Philosoph, Essayist und Romancier, geht den gewaltgenierenden Ressentiments, die unser Hier und Heute bestimmen, auf den geistes- und kulturgeschichtlichen Grund. Ausgehend von Gabriele D´Annunzios Fiume-Abenteuer 1919 spürt er den Wurzeln und Quellen von Fanatismus, Ultranationalismus, Totalitarismus, Frauenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus, Tyrannei, Rückbau von demokratischen Strukturen, Populismus und deren jeweiliger Gewaltbereitschaft nach. Das geht bis weit ins 18. Jahrhundert zurück (Stichwort: Rousseau, und nebenbei eine der spannendsten Rousseau-Interpretationen) und bezieht vor allem auch die Interdependenzen von europäisch/westlichem und eben nicht-westlichem Denken in Indien, China, Japan, dem Iran und dem arabischen Raum nach. Die ungeheure Spannweite seines Wissens macht einfache Lösungen sowieso unmöglich, so unmöglich wie die manische Fokussierung des „Gewaltproblems“ auf den Islam. Schmeichelhaft ist sein Ansatz für alle kulturelle Formationen nicht, weil Mishra grundsätzlich die pragmatischen, bösen Folgen avancierten Denkens für die Milliarden von Menschen reflektiert, für die solche Konzepte (und seien sie noch so benevolent, ihre Gegenbildlichkeiten sind seit Rousseaus „Sparta“-Schwärmerei meistens abscheulich) vor allem mangels eines sinnvollen materiellen Unterbaus und der faktischen Machtverhältnisse auf diesem Planeten nicht funktionieren. Ein großer Wurf, der alle aktuellen Gewaltdebatten unterfüttern sollte und mithin eben auch Kriminalliteratur, die allzu oft nur deren kulinarischer Wurmfortsatz ist.
Pankaj Mishra: Das Zeitalter des Zorns. Eine Geschichte der Gegenwart (Age of Anger. A History of the Present, 2017). Deutsch von Laura Su Bischoff und Michael Bischoff. Frankfurt am Main: S. Fischer 2017. 416 Seiten, € 24.00. Zum Buch geht es hier entlang.
 Natur (2): Vater-Tochter, nicht ganz einfach
Natur (2): Vater-Tochter, nicht ganz einfach
(AM) Es gibt diese Bücher, die jemand lange in sich trägt – und in diesem Fall auch mit der entsprechenden Natur, Kultur und Landschaft gelebt hat. Vielleicht bleibt das dann ein Einzelstück und Niveau und Dichte des Erstlings werden in der weiteren Schriftstellerkarriere nie wieder so erreicht. (Charles Frazier ist so ein Fall, der Autor von „Cold Mountain“; alleine ist er damit nicht.) Karen Dionne, von deren etwas hausmütterlichem Aussehen man sich nicht abschrecken lassen sollte, hat mit ihrem Debüt „Die Moortochter“ (The Marsh King’s Daughter) gerade einen Welterfolg, das Buch wurde aus dem Stand in über 20 Länder verkauft. Und ist wieder ein Beleg dafür, dass neben einer spannenden und noch nicht unbedingt so erzählten Geschichte der „sense of place“, der detailliert geschilderte Geschmack und Charakter eines spezifischen Ortes große Anziehungs- und Universalkraft haben.
Während Antonin Varenne in „Treibjagd“ das französische Massif Central zum Schauplatz macht und seine Geschichte auch mit dieser Landschaft erzählt, ist es bei Karen Dionne die Sumpf- und Waldlandschaft der Upper Peninsula in Michigan. Das menschenleere Gebiet – Schauplatz auch der „Wood Cops“-Romane des leider schon lange nicht mehr übersetzten Joseph Heywood – macht etwa ein Drittel der Landfläche von Michigan aus, es leben aber dort aber nur drei Prozent der Gesamtbevölkerung.
Karen Dionne und ihr Mann sind vor 40 Jahren in diese Wildnis gezogen, haben dort Kinder großgezogen. Um Familienzusammenhänge, allerdings ziemlich brutale, geht es auch in der „Moortochter“. Hans Christian Andersens gleichnamiges, heftiges Märchen zieht sich wie ein kulturelles Leitmotiv durch die Erzählung. Und es ist nicht so weit hergeholt wie es scheinen mag. Auf der „U.P.“ (Yoopee von den Einheimischen gesprochen) verschränken sich skandinavische Einwanderer- und einheimische Indianerkultur seit dem 18. Jahrhundert. Karen Dionne erzählt in zwei sich aufeinander zubewegenden Strängen: die Gegenwart und die sie bestimmende Vergangenheit. (Man kennt das, funktioniert aber trotzdem; Varenne ist hier der experimentellere Erzähler.) Wir erfahren von einer Kindheit in der Wildnis und einer heftigen Vaterbeziehung während dieser gefährliche, mörderische Mann gerade aus dem Gefängnis ausgebrochen ist und sich auf seine Tochter Helena und deren Familie zubewegt, unterwegs Leichen als Gruß an sie hinterlässt. Als Fährtensucherin aber ist sie ihm ebenbürtig, sie hat bei ihm gelernt. Und nicht nur die harmlosen Künste. Diese Heldin wird man nicht so schnell vergessen.
Karen Dionne: Die Moortochter (The Marsh King’s Daughter, 2017). Psychothriller. Deutsch von Andreas Jäger. Goldmann Verlag, München 2017. 382 Seiten, 12,99 Euro. Verlagsinformationen.
Seinen Standards erfreulich treu
(TW) Über „Deutungshoheit“ könnte man bei der ganzen Welle, der zwar harmlos daherkommenden, aber letztendlich abwegigen Deutschgrimmis-besetzen-jetzt-auch-die-ganze-Welt-Welle nachdenken. Besonders die Franzosen werden gerade noch mal okkupiert – von den ganzen Bannalecs & Co., die Frankreich als großen kulinarischen und touristischen Theme-Park mit Mord entdeckt haben. Deswegen habe ich mit einigem Schrecken gesehen, dass auch der hochgeschätzte Robert Hültner mit seinem neuen Roman „Lazare und der tote Mann am Strand“ (btb) sich im südfranzösischen Sète und in den Cevennen tummelt. Aber puuu – Hültner bleibt seinen Qualitätsstandards treu: Kein Kulinarika, kein folkloristischer Fidelwipp und keine ulkig-knarzigen Franzosen und olalala-Französinnen. Stattdessen entwickelt sich der Roman von einem anscheinend routinierten Whodunit zu einem ziemlich giftigen Buch über die französisch-deutschen Verhältnisse, von der wirklichen, blutig ernsten Besatzungszeit bis zum sehr heutigen NSU und der rechten „Internationalen“, inklusive der Geheimdienste und der Kollaboration von Wirtschaft und Front National, ein enges Geflecht über die Ländergrenzen hinweg. Nüchtern und präzise erzählt und ohne Schielen auf „Identifikationswerte“ der Figuren (sowieso eine lästige Geißel der derzeitigen gefühligen Rezeptionshaltung Literatur gegenüber).
Robert Hültner: Lazare und der tote Mann am Strand. btb Verlag, München 2017. Hardover, 383 S., 20,00 Euro.
 007 James Bond, geschüttelt und gerührt: halb Parker, halb Dortmunder
007 James Bond, geschüttelt und gerührt: halb Parker, halb Dortmunder
(AM) Tausendsassa Donald E. Westlake (1933 bis 2008) schrieb – übrigens immer auf Schreibmaschine, am Ende suchte er Ersatzteile dann vorzugsweise in Mexiko – in 50 Schriftstellerjahren nicht nur über 100 Romane und fünf Filmdrehbücher, darunter 15 Dortmunder-Kriminalkomödien, vier Grofield- und 24 Parker-Romane (1962 bis 1974 und 1997 bis 2008). Er hat, was kaum jemand wusste, auch einen James-Bond-Roman hinterlassen. Charles Ardai hat ihn für seine Hard Case Crime-Reihe ausgegraben, vernünftig ausgestattet und nun als Hardcover herausgebracht. Was für ein Ding.
Der Autor mit einer komödiantischen und einer taffen Seele in der Brust, dessen unter dem Pseudonym Richard Stark erschienene ultra-hardboiled Romane mit dem Berufsverbrecher Parker (kein Vorname) Garry Disher zu seinem Wyatt und Wallace Stroby zu Stone, Vorname Crissa, inspirierten, lieferte im September 1995 bei MGM/ United Artists ein 35-seitiges Treatment zum Bond-Film Nr. 18 ab, war dazu eingeladen worden. Schließlich hatte Anthony Burgess die erste Fassung von „Der Spion, der mich liebte“ geschrieben, Ronald Dahl das Drehbuch von „Du lebst nur zweimal“. Don Westlake war immerhin 1990 für seine Adaption von Jim Thompsons „The Grifters“ für einen Oscar nominiert gewesen. Das Bond-Geschäft befand sich 1995 in einem ziemlichen Niemandsland. Mit Timothy Dalton war das Filmgeschäft abgestürzt, Pierce Brosnan kam als Nobody, niemand wusste, wie „Golden Eye“ wohl an den Kinokassen reüssieren würde. Neun Monate vor dem Filmstart des Brosnan-Erstlings dachte Westlake sich als Filmplot ein Katastrophenszenario mit der für 1997 avisierten Übergabe von Hongkong an China aus. Der Bösewicht würde die Wettersatelliten der Welt kapern und im Westen eine Nahrungsmittelkatastrophe auslösen wollen. Ein Großteil des Films sollte in Australien spielen und es würde Gimmicks wie etwa einen Bumerang geben, „der ‚Boom’ macht“.
Nachdem China aber „Golden Eye“ wegen der angeblich antikommunistischen Eröffnungsszene für die Auswertung sperrte, war es für MGM/ UA beschlossene Sache, dass 007 nicht so schnell auch nur in die Nähe von HK und der VR China kommen würde. Westlakes inzwischen auf neun Seiten geschrumpftes Treatment landete – nun ja, in der Versenkung. Hatte John le Carré anlässlich der Verfilmung von „The Little Drummer Girl“ dem Regisseur George Roy Hill ein Telegramm des Inhalts geschickt, „Sie haben meinen Ochsen genommen und einen Bouillonwürfel daraus gemacht“, so beschritt Westlake in aller Stille den anderen Weg. Aus neun, respektive 35 Seiten machte er heimlich einen 444-Seiten Thriller, der tatsächlich ziemlich vergnüglich zu lesen ist. Zehn Grad nach rechts gedreht, wäre man in einem Parker-Roman, zehn Grad nach links gestellt, in einer Dortmunder-Komödie. Es wimmelt von Insiderwitzen. Einmal etwa versucht Bonds Sidekick Mandrake tough zu werden, indem er einen Roman namens „Payback“ liest. Das war der Titel von Mel Gibsons Verfilmung des ersten Parker-Buches „The Hunter“. Ein Nachwort des früheren United Artists-Managers und Westlake-Fans Jeff Kleeman bietet eine Schatzkammer wertvoller Informationen.
Forever and a Death kann man lesen, muss es aber nicht, als Westlake-Fan jedoch kommt man nicht daran vorbei. Als Ergebnis habe ich beschlossen, mir seine irrwitzigen Monumentalthriller „Kahawa“ von 1984 wieder vorzunehmen, in dem eine zusammengewürftelte Crew von Abenteurern dem Diktator Idi Amin einen ganzen Zug mit der gesamten ugandischen Kaffee-Ernte stiehlt. Habe beste Erinnerungen daran. Wann wird das eigentlich verfilmt?
Donald E. Westlake: Forever and a Death. Hard Case Crime, edited by Charles Ardai. Titan Books, London 2017. Afterword by Jeff Kleeman. 464 Seiten, $ 22.99, GBP 16.99. Verlagsinformationen.
Die Internetpräsenz von Donald E. Westlake hier. Eine Dingfestmachung des Autors, die von der University of Chicago Press herausgebenen Nonfiction-Texte Westlakes – „The Getaway Car“ -, wurde hier bei CrimeMag besprochen.
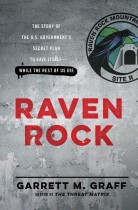 Dr. Seltsam und die Männer, die die Bombe lieben
Dr. Seltsam und die Männer, die die Bombe lieben
(AM) Jeden Morgen fliegen in Washington die blaugoldenen Hubschrauber der 1st Helicopter Squadron, Codename MUSSEL, über den Potomac in Richtung Capitol und Weißes Haus. Manchmal transportieren sie VIPS, aber ihr eigentlicher Zweck ist es, für eine Evakuierung des politischen Spitzenpersonals bereitzustehen – im Falle eines Terrorangriffs oder eines Nuklearangriffs auf die amerikanische Hauptstadt. Sie sind Teil eines ultrageheimen Doomsday-Plans, den uns der Journalist Garrett M. Graff in Raven Rock entblättert, einem Buch, das einem in diesen Wochen, da Präsident Dumb ganz unverhohlen mit dem nuklearen Feuer spielt, nicht richtig gute Laune macht. Stanley Kubricks Dr. Seltsam und seine Männer sind immer noch unter uns, der Buchuntertitel spricht es aus: „The U.S. Government’s Secret Plan to Save Itself – While the Rest of Us Die“.
Kein Kubrick-Film, sondern bizarre, hirnverbrannte Realität ist es, wie über die Jahrzehnte viele Milliarden von Dollar buchstäblich verbuddelt und versenkt wurden, um das Fortbestehen der US-Rumpfregierung nach einer Atomkatastrophe zu sichern. Und jetzt gibt es einen Präsidenten, bei dem man in Mar-a-Logo mit dem Träger des „nuklearen Fußballs“ Selfies schießen kann – neben dem Mann, der dem Präsidenten ständig den Koffer mit den Atom-Codes nachträgt. Holy Moly. Na dann Prosit.
Die Details und Anekdoten des Buches sind unglaublich. Die Planungen für „Site R“, auch „Raven Rock“ genannt, begannen 1948. Nach der Zündung der ersten sowjetischen Atombombe am 29. August 1949 trieb das Joint Command Post die Einrichtung eines atombombensicheren Bunkers nahe Washington voran, in dem wichtige Regierungsbehörden im Krisenfall weiterarbeiten könnten. Ausgesucht wurde dafür der Granitberg Raven Rock in Pennsylvania, rund 10 km nordöstlich von Camp David. Viele Milliarden wurden dort unterirdisch verbaut, die mehrstöckige, gigantische Anlage wurde immer wieder modernisiert. 350 Köpfe zählt(e) die Stammbesetzung, 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr. Und Raven Rock war nur der Anfang, ist nur das Symptom. Rund 60 Jahre schon entwickelt die US-Regierung geheime „Doomsday“-Pläne, um sich selbst zu schützen. „Continuity of Government“ (COG) nennt sich das mittlerweile Billionen schwere Programm aus dem Tollhaus.
Graff arbeitet heraus, wie solch eine „Vorsorge für den Jüngsten Tag“ die Kriegspläne, die Kultur und das Herz des Kalten Krieges wie auch danach die militärischen Planungen prägten, noch bis ins Heute wirken und einen Trump unbekümmert über „fire and rage“ schwadronieren lassen. Um nur eine der vielen, vielen beklemmenden Geschichten des Buches zu rekapitulieren: Seit den 1950er waren/ sind die US-Militärs davon überzeugt, dass Russland einen Atomkrieg damit beginnen würde, in der Botschaft in Washington und in der UN-Mission in New York eingeschmuggelte Atombomben zu zünden. Ein brasilianischer Informant hatte dem FBI entsprechende Geschichten erzählt, das ließ sich nie verifizieren, aber auch John F. Kennedy war davon überzeugt: „Wissen Sie, die Sowjets haben eine Atombombe im dritten Stock ihrer Botschaft“, eröffnete er 1961 dem Journalisten Hugh Sidey, die Teile seien im Diplomatengepäck eingeschmuggelt worden. Paranoia kennt keinen Boden. „Raven Rock“ lässt in den Abgrund schauen.
Garrett M. Graff: Raven Rock. The Story of the U.S. Government’s Secret Plan to Save Itself — While the Rest of Us Die. Simon & Schuster 530, New York 2017. Seiten, davon 32 Bildseiten, $28. Verlagsinformationen hier, viele Zitate aus dem Buch hier.














