Sie sind kürzer geworden, unsere Chops, dafür aber mehr. Es waren am Beil:
Joachim Feldmann (JF): Harry Crews: Florida Forever; Dror Mishani: Die Möglichkeit eines Verbrechens; Lucie Flebbe: Prinzenjagd //
Tobias Gohlis (TG): Antonin Varenne: Die sieben Leben des Arthur Bowman //
Karsten Herrmann (KH): Benjamin Black: Die Blonde mit den schwarzen Augen //
Klaus Kamberger (KK): Michael Molsner: Begegegnungen //
Anne Kuhlmeyer (AK): Andreas Kollender: Kolbe //
Alf Mayer (AM): Christopher Peters: Der Arm des Kraken; Lauren Beukes: Broken Monsters; Taylor Stevens: Mission Munroe. Die Spezialistin, Harro Albrecht: Schmerz; Mittelweg 36: Schwerpunkt: Der Gewalt ins Auge sehen; Klaus Theweleit: Das Lachen der Täter: Breivik u.a.; Michel Foucault: Die Strafgesellschaft //
Peter Münder (PM): Till Raether: Blutapfel //
Marcus Münterfering (MM): Michael Robotham: Um Leben und Tod //
Frank Schorneck (FS): Helen FitzGerald: Ex.
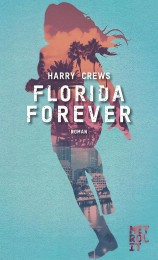 Absturzgefährdet im Trailerpark: Florida von unten
Absturzgefährdet im Trailerpark: Florida von unten
(JF) Wer nicht mit der Terminologie des Baugewerbes vertraut ist, wird stutzen, wenn von „auskragenden Brüsten“ die Rede ist. Doch es handelt sich weder um einen Druck- noch um einen Übersetzungsfehler. In „Celebration“, so der Originaltitel von Harry Crews‘ letztem Roman, just als „Florida Forever“ auf Deutsch erschienen, heißt es „cantilevered breasts“, und tatsächlich sind hiermit jene Stützen gemeint, die einen Balkon vor dem Absturz bewahren. „Too Much“ nennt sich die 18-jährige Besitzerin dieses anatomischen Wunderwerks, die nicht nur den Männern in ihrer Umgebung den Kopf verdreht.
Irgendwann ist die junge Frau in dem Trailerpark aufgetaucht, den der Kriegsveteran Stump irgendwo in Florida als Refugium für Rentner betreibt. Schon bald verfällt der mental fast vergreiste Mittfünfziger den erotischen Künsten dieser fleischgewordenen Männerfantasie. Und von da an ändert sich alles. Too Much übernimmt die Kontrolle und verwandelt das Verwahrlager für alte Menschen in einen Ort sinnenfreudigen Treibens. Eine verstörende Erfahrung für die meisten Beteiligten, zumal die Machtergreifung durch die listenreiche Sexprophetin nicht ohne Kollateralschäden bleibt. Auch dem Leser wird gelegentlich schwindlig bei der Lektüre dieses bizarren Romans, der auf atemberaubende Weise Horror-, Krimi- und Noir-Elemente kombiniert.
Harry Crews (1935-2012) hat sich in seiner amerikanischen Heimat mit 15 Romanen Kultstatus erschrieben. Hiesige Freunde unkonventioneller Literatur dürfen ihn noch entdecken. Und sich für eine drastische Leseerfahrung wappnen.
Harry Crews: Florida Forever. Roman. (Celebration. 1998). Aus dem Amerikanischen von Gunter Blank. 334 Seiten. Berlin. Metrolit: 2015. € 22,00.
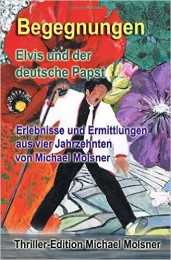 Ray – ein Wort muss hier als Titel reichen
Ray – ein Wort muss hier als Titel reichen
(KK) In der Führungsetage der Deutsch-Krimi GmbH & Co.KG hat er ja seit über vierzig Jahren seinen – unbestrittenen – (Ehren-)Platz, und manch einer hält ihn seit seinem fulminanten Erstling anno 1968 („Und dann habe ich geschossen“) für einen der, wenn nicht den besten: Michael Molsner. Mehr als zwei Dutzend Romane, viermal auf der Jahresbestenliste des Deutschen Krimi-Preises, Ehren-Glauser für sein Lebenswerk… Noch mehr gefällig? Nicht nötig… Von der „Szene“ ist er eh nicht wegzudenken.
Wieso aber einer, der ja auch einen wie Thomas Mann und all die anderen Highbrows der deutschen Schreibkultur mehr als hoch hält (für seinen erst kürzlich erschienenen Roman „Dich sah ich“, übrigens mal kein Krimi, hat er nicht ohne Hintersinn eine Anleihe bei Goethes Sesenheimer Gedichten gemacht), wieso so einer meint , sich nun „alternativlos“ aufs Krimi-Schreiben meinte stürzen zu müssen, das verrät er uns jetzt – unter anderem – in seinem Kompendium aus Aufsätzen, Kritiken und Glossen, das gerade bei Amazon auf die Liste gekommen und dort abrufbar ist.
Der Titel ist Programm: „Begegnungen. Elvis und der deutsche Papst“, und dieser Untertitel ist durchaus ernst gemeint, schlägt er doch einen großen Bogen über das, was M. als Person bewegt und zugleich seine Schriftstellerei quasi unterfüttert. So handeln M.‘s Anmerkungen halt mal von einem gewissen Joseph Ratzinger (furchtbar konservativ) dann wieder von Clint Eastwood (furchtbar republikanisch), von Elvis Presley (Bürgerschreck) , Walter Sedlmayr (Volksschauspieler), Lothar Günther Buchheim (Selbstdarsteller) bis zu Judy Garland (tja, zu der fällt mir nun nix mehr ein), von Carl Zuckmayer (Anti-Faschist) bis zu E.A. Rauter (Kommunist), aber noch weiter – ja, jetzt wird es ernst: bis hin zum Leuchtturm all seines schriftstellerischen Bemühens: Raymond Chandler.
Mit all diesen Figuren kann er etwas anfangen, und das auch noch gleichzeitig. Was sagt uns das? Mike Molsner hat es offenbar mit dem Pop! Gemach, gemach, das ist keineswegs anzüglich gemeint, im Gegenteil: ausweitend. Popularität ist halt kein Wertmaßstab, weder in die eine, noch in die andere Richtung. Alles sollte erst einmal für sich selber zur Kenntnis genommen werden; seien es auch eine Theologie, die meint, nicht ohne Dogmatik auskommen zu können; oder eine Musik, die neue Traditionen schafft, statt alte nachzuäffen; sei es eine Schauspielerei, die vordergründig bloß Typen produziert und trotzdem Botschaften sendet oder…
Der Thriller-Autor Molsner hat nachweislich und Zeit seines Lebens nicht fürs „Feuilleton“ geschrieben, sondern für Leser. Und er hat sich damit der Gefahr ausgesetzt, in neunmalklugen Kategorien als „trivial“ zu gelten. In seinen nun so divergierend anmutenden Traktaten legt er sich nun mit allen an: mit den Ideologen des Wahren und Schönen, mit Spießern (die per se ja nicht wissen, dass sie welche sind) und sonstigen geschichtslosen Deutschen (die das auch noch als Fortschritt empfinden), und nicht zuletzt mit den Hochgemuten und Hochmütigen aus den Kulturetagen. Auch mal mit hinterhältigem Witz: Weist er doch in seiner „fiktiven Ermittlung“ des Falls, in dem Raymond Chandler in L.A. doch tatsächlich zum Retter Thomas Manns wurde, so nebenbei wie schlüssig nach, dass Mann seinen Plot zum „Doktor Faustus“ bei Chandler abgekupfert hat!
Für den Schriftsteller Molsner war die Entdeckung Chandlers in der Taschenbuch-Krabbelkiste einer Münchner Buchhandlung übrigens so etwas wie der Urknall. Inhaltlich. Ästhetisch. Politisch. Das spürt man in jedem seiner Romane, und das spürt man auch in diesen Anmerkungen zur populären Kultur auf jeder Seite. Und die haben es in sich!
Michael Molsner: Begegnungen. Elvis und der deutsche Papst. Thrills of my Life. Thriller-Edition Michael Molsner. 2015. 286 Seiten. Als Taschenbuch (€ 9,10) und E-Book (€ 5,24) bei amazon abrufbar.
 Weit besser als das Cover
Weit besser als das Cover
(MM) Michael Robotham ist Australier, hat bald ein Dutzend Spannungsromane geschrieben, die zumeist in Großbritannien spielen – und gehört zu den Autoren, an denen ambitionierte Krimileser im Regal regelmäßig vorbeigreifen. Was sehr viel mit der unglücklichen Covergestaltung zu tun hat, die – ebenso wie die deutschen Titel – vermuten lässt, dass es sich hierbei um Dutzendware handelt, mit der man nur seine viel zu knappe Lesezeit vergeuden würde.
Dass dem nicht so ist, könnten regelmäßige Leser dieses Magazins durchaus mitbekommen haben: Schon seit Jahren preist Alf Mayer in seinen Rezensionen (hier und hier ) den Autor, der „Bücher voller Konflikt und Spannung“ schreiben und dabei die „Intelligenz des Lesers“ nicht beleidigen würde.
Für Robotham-Novizen bietet sein neuer Roman einen perfekten Seiteneinstieg. Denn in „Um Leben und Tod“ wechselt er Ort und Protagonisten. In Texas entspinnt sich die vertrackte Handlung, die mit einem spektakulären Gefängnisausbruch beginnt – in der Nacht bevor Audie Palmer, der wegen eines Raubüberfalls zehn Jahre gesessen hat, entlassen werden sollte.
Romane, wie Robotham sie schreibt, leben von den Volten, die die Geschichte schlägt, weswegen hier gar nicht viel mehr verraten werden soll, als dass Pamers Ausbruch einige honorige Texaner mächtig in die Bredouille bringt und diese den Flüchtigen mit allen Mitteln ausschalten wollen.
Robotham beweist sich in „Um Leben und Tod“ ein weiteres Mal als gewiefter Erzähler von der Sorte, die es schafft, dass man gar nicht lang darüber nachdenkt, wie er eigentlich schreibt. Das ist nicht mangelnder Stil, sondern eine hohe Kunst. Die Kunst des „No bullshit“.
Michael Robotham: Um Leben und Tod. (Life or Death.) Übersetzt von Kristian Lutze. Goldmann TB. 474 S., 9,99 Euro
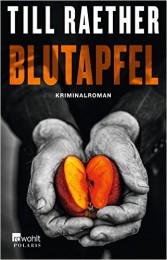 Urban Exploring
Urban Exploring
(PM) In seinem ersten Krimi „Treibland“ ließ der Hamburger Journalist Till Raether seinen sympathischen Querdenker- Kommissar Adam Danowski auf einem Kreuzfahrer ermitteln: Auf dem kam nicht nur ein Passagier ums Leben, es gab auch noch Ebola-Alarm, so dass Danowski tagelang auf diesem „Pestschiff“ isoliert war. Trotz einiger allzu quirlig-karnevalesker Plot-Einlagen demonstrierte „Treibland“ eindrucksvoll, dass Raether ein spannendes Garn knüpft und wunderbar lockere Dialoge fabriziert. Begeisternd ist vor allem dieser Danowski : Ein imposantes Monument sturer Eigenwilligkeit, unbeirrt durch Intrigen, lästige Alltagsroutine, familiäre Verpflichtungen oder profilneurotische Vorgesetzte.
In „Blutapfel“ ist nun subkulturelles „Urban Exploring“ in Tunneln, Bunkern und Bauruinen angesagt. Ein im Elbtunnel erschossener Autofahrer führt Danowski bei seinen Ermittlungen zu geheimen Tunnelsystemen, in denen sich urbane Abenteurer herumtreiben- ihre in Blogs geposteten Impressionen wollen Konkurrenten in dieser Nervenkitzel- Disziplin immer wieder übertrumpfen. Und mittendrin im Tunnel-Kriechgang findet sich schließlich auch Danowski, der sehen muß, wie er all die verwirrenden Erkenntnisse und Spekulationen über rivalisierende Balkan-Klans und US-Geheimdienste auf die Reihe kriegt. Spannend und faszinierend, wie Raethel diese Spießer-Abenteurer und Spionage-Sphären miteinander verknüpft!
Till Raether: Blutapfel. Rowohlt Taschenbuch. 476 S., 14,99 Euro.
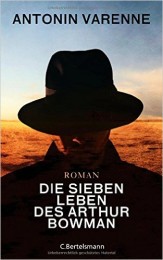 Großartiger Schmöker
Großartiger Schmöker
(TG) Vielleicht gibt es in jeder Dekade den einen Abenteuerroman. Mitte der Siebziger Jahre war es für mich „Shogun“ von James Clavell. Über andere müsste man weiter nachdenken.
Aktuell ein herrliches Exemplar: „Die sieben Leben des Arthur Bowman“. Antonin Varenne – den man im Auge behalten sollte und der 2012 mit „Fakire“ ziemlich unbeachtet blieb – geht von der einfachen Tatsache aus, dass Mitte des 19. Jahrhunderts die Globalisierung so weit fortgeschritten war, dass ein einfacher Mann in der Spanne seines Lebens auf (fast) allen Kontinenten leben und arbeiten konnte – als Soldat.
Nach ersten Aufenthalten in Afrika, noch als Schiffsjunge, wird Arthur Bowman in Diensten der britischen Ostindischen Kompanie als „härtester Sergeant Indiens“ in den frischen Kolonialkrieg gegen Burma geschickt. Für eine geheime Mission soll er zehn Männer auswählen. Kurz nach einem Massaker am Ufer des Irrawaddy scheitert das Unternehmen, die Zehn werden von Einheimischen gefangen genommen. Sieben Jahre später tut ein traumatisierter, seine Albträume mit Opium und Schnaps dämpfender Bowman in London Polizeidienst. Während einer Hitzeperiode, in der die Stadt sich in eine Kloake verwandelt, entdeckt Bowman eine Leiche. Sie ist verstümmelt mit dem gleichen Narbenmuster, das er und seine zehn Soldaten auf dem Körper tragen – Folgen der Foltern in Burma.
Bowman kann seine Albträume nur loswerden, wenn er den Mörder findet. Denkt er. Seine Suche führt ihn durch England, dann in die sich nach Westen ausbreitenden USA, wo weitere Morde dieser Art begangen werden. Varennes Lebensdarstellung eines Mannes, der an seiner Stärke zu zerbrechen droht, ist fantastisch recherchiert und in einer großartigen nüchternen Sprache geschrieben. Die Lebensumstände in Burma, London und in den USA, die Bowman von New York bis San Francisco durchquert, werden plastisch.
Das Ende ist überraschend – gerade für Leser, die vom Cover auf die Fährte eines Western-Noir geleitet werden.
(Zuerst erschienen auf dem Blog von Tobias Gohlis.)
Antonin Varenne: Die sieben Leben des Arthur Bowman (Trois mille chevaux vapeur, 2014). Roman. Aus dem Französischen von Anne Spielmann. München: C. Bertelsmann 2015. Hrdcover, 560 Seiten, 22,90 Euro.
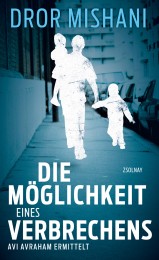 Einer der traurigsten Mörder der Kriminalliteratur
Einer der traurigsten Mörder der Kriminalliteratur
(JF) Drei Gewaltverbrechen, vor Jahrzehnten begangen, aber noch immer unaufgeklärt. Seltsame Einbrüche in die Wohnungen alter Menschen, bei denen nichts gestohlen, wohl aber etwas hinterlassen wird. Und ein Kriminalist, der diesen mysteriösen Fall als das versteht, was er wahrscheinlich auch ist: „Er hatte das Gefühl, als hätte das Ganze etwas Romanhaftes an sich und würde ihn am Ende nicht zu einem Verbrechen führen, das ein echter Mensch begangen hat.“
Wie genau Inspektor Avi Avraham von der Polizei in Cholon nahe Tel Aviv diesen mysteriösen Fall dann doch löst, verrät uns der allwissende, aber gelegentlich mit Auskünften geizende Erzähler in Dror Mishanis zweitem Kriminalroman selbstredend nicht. Schließlich wird hier auf knappem Raum nur die Möglichkeit einer Handlung angedeutet, die im gewöhnlichen Rätselkrimi schon mal einige hundert Seiten in Anspruch nehmen kann. Doch diese populäre Art der Spannungserzeugung ist die Sache des Jerusalemer Literaturwissenschaftlers nicht.
Bereits in seinem Debüt, das seinem Rezensenten ein wenig bemüht vorkam, demonstrierte Mishani seine Vorliebe für die narrativen Möglichkeiten der Metafiktion. Auch „Die Möglichkeit eines Verbrechens“ ist nicht frei von derlei Schabernack. Dann kommt es Inspektor Avraham so vor, als „läse er in einem seiner geliebten Kriminalromane davon, ohne in Wirklichkeit zu ermitteln“. In dieser „Wirklichkeit“ nämlich agiert er alles andere als perfekt. Er ist abgelenkt, verlässt sich zu sehr auf seine Intuition und macht Fehler. Und dennoch gelingt es ihm, ein Verbrechen aufzuklären, dessen Urheber, einer der traurigsten Mörder in der Geschichte der Kriminalliteratur, dem Leser längst bekannt ist. Die Spannung beruht also nicht auf der Frage, wer es denn nun war, sondern entsteht durch die geschickt gestaltete Konfrontation von Ermittler und Täter. Mishani verlässt sich dabei – zumindest ist das der Eindruck, den die Übersetzung ins Deutsche vermittelt – auf eine betont sachliche Sprache, die dem Alltagsrealismus des Geschilderten entspricht.
Am Ende des Romans, nachdem alle Fälle gelöst sind, bekommt der Zigarettenraucher Avraham eine Pfeife geschenkt, das unvermeidliche Insignium berühmter literarischer Detektive von Holmes bis Marlowe. Er freut sich darüber, weiß aber noch nicht, „wie man sie benutzt“. Man darf gespannt sein, ob und wie er es herausfindet.
Dror Mishani: Die Möglichkeit eines Verbrechens. Avi Avraham ermittelt. (Efsharut shel alimut. 2013). Aus dem Hebräischen von Markus Lemke. 333 Seiten. Wien: Zsolnay 2015. € 19,90.
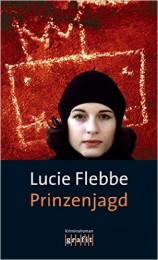 Geschlechterkrieg in Bochum
Geschlechterkrieg in Bochum
(JF) In Bochum tobt der Geschlechterkrieg. Zwei besonders unangenehme Vertreter der männlichen Seite hat es bereits erwischt. Und mittendrin steckt Lia Ziegler, die es nach dem Abitur in die krisengebeutelte Ruhrgebietsstadt verschlagen hat. Allerdings nicht zum Studium. Das ließ sie sausen, um endlich ihrem prügelnden Vater zu entkommen. Ein Dreivierteljahr ist das her. Seitdem wohnt sie gemeinsam mit dem Macho-Privatdetektiv Ben Danner über einer Kneipe und löst als Undercover-Spezialistin einen Fall nach dem anderen. Ob Putzfrau oder Trebegängerin – Lila Ziegler spielt ihre Rollen engagiert und überzeugend.
Für ihren aktuellen Auftrag allerdings ist kein besonderer körperlicher Einsatz erforderlich. Das Ermittler-Gespann wird vom Direktor eines noblen Hotels engagiert, auf dessen Grundstück ein Fernsehkoch und ein Casting-Show-Promi ums Leben gebracht wurden. Der Mann fürchtet um das Renommee seines Hauses und hat kein großes Vertrauen in die offizielle Polizeiarbeit. Das klingt nicht sehr überzeugend, doch für 2.000 Euro lassen sich Danner und Ziegler gerne auf ein paar kostenlose Nächte in einem Luxuszimmer ein. Gefährlich wird es trotzdem, schließlich scheint es der Mörder auf Männer abgesehen zu haben, für die der alte Kampfbegriff „Chauvischwein“ noch ein Kompliment wäre. Und als Softie geht Danner nicht gerade durch.
Wie seine Vorgänger überzeugt auch „Prinzenjagd“ durch einen schnoddrig-wehmütigen Erzählton und ein sicheres Gespür für soziale Verwerfungen. Lesenswert!
Lucie Flebbe: Prinzenjagd. Kriminalroman. 252 Seiten. Dortmund: Grafit 2015. € 10,99.
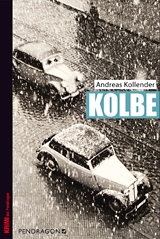 Verräter?
Verräter?
(AK) Kolbe bekleidet über Jahre eine subaltere Stelle im Auswärtigen Amt, während sein Schweigen angesichts des Unrechts, von dem er weiß, ihn quält. Bis er eine Möglichkeit findet, geheime Unterlagen aus dem Amt zu schmuggeln und den Amerikanern zu zuspielen. Dem ersten Triumph folgt eine neue Qual, nämlich die des Doppellebens eines Agenten, der keiner ist. Kolbe fehlt so ziemlich alles, was die Agenten von John le Carré z.B. haben – das nötige Handwerkszeug eines Geheimdienstmannes. Er hat nichts als seine Überzeugung, dass falsch, menschenverachtend und zynisch ist, was die Nazis tun. Deshalb spioniert er. Der einzige Halt in seiner Einsamkeit ist Marlene Wiese mit der schönen Nase. Die Liebesgeschichte im kriegsgeschüttelten Berlin gerät ein wenig schwülstig. Zu oft gehört, zu oft gelesen, wie Menschen ihr privates Glück inmitten von Chaos bewahren. Sei’s drum.
Das Doppelleben des Fritz Kolbe dient einer guten Sache. Er will, dass der Krieg schnellst möglich beendet wird. Doch warum bombardieren die Amerikaner die Wolfsschanze nicht, nachdem er ihnen den Ort bezeichnet hat? Stirbt sein bester Freund durch die Folgen seiner Spionage? Kolbe glaubt das, als ein Sender in Irland atomisiert wird und die Frau des Freundes, den Verlust nicht erträgt, sich selbst tötet.
Kann man in Zeiten einer Gewaltherrschaft das „Richtige“ tun? Das am wenigsten Falsche vielleicht, auch wenn man nicht damit rechnen kann, dafür Anerkennung zu bekommen. Die wird Fritz Kolbe tatsächlich erst posthum zuteil, 60 Jahre nach dem Ende der Diktatur. Er selbst leidet an der Lüge, an der systembedingten Deformation, die ihm zum zweiten, hässlichen Selbst wird.
In dem historischen Kriminalroman stellt Kollender die Frage nach der Rechtschaffenheit von „Verrat“, die durchaus aktuell erscheint, denkt man an Edward Snowden, die Frage nach der Rechtfertigung von persönlichen Konsequenzen und Opfern. Und er erzählt spannend, gekonnt und bildhaft von einem Beispiel an Zivilcourage.
Anmerkung: Wer ist ein Verräter? Einer, der dem sozialen System, in dem er lebt, schadet. Gleichgültig, wie sehr das System seinen Mitgliedern schadet, wird er von den eigenen Leuten und von denen anderer Systeme dafür verachtet, ausgegrenzt, verfolgt. Das ist zwar nicht richtig und gleich gar nicht gerecht, folgt aber der absurden Logik, dass das System Vorrang vor allem, auch vor moralischen Grundsätzen, hat. Angesichts der sich zuspitzenden Gewalt gegen das Fremde, könnten ein paar mehr „Verräter“ heute auch nicht schaden.
Andreas Kollender: Kolbe. Pendragon, Bielefeld, 2015, S. 444, 16,99 Euro
Zum Blog von Anne Kuhlmeyer geht es hier.
 Schluss mit Tarantino!
Schluss mit Tarantino!
(AM) Man muss da jetzt mal eine Drohkulisse aufbauen: Die nächsten fünf Jahre nimmt ab sofort jede Marketing- oder/oder Social-Media-Kraft und jeder Kritiker, der/die etwas von „Tarantino trifft XY“ oder ähnliches in einer Buchempfehlung faselt, an einer Auslosung teil, bei der jedem zweiten Zwangsgemeldeten von einem Uma-Thurman-Double im „Kill Bill“-Kostüm öffentlich ein Finger abgehackt wird. Chop, Chop. Ich kann diese Tarantino-Vergleiche nicht mehr lesen. Geschweige denn glauben.
Christoph Peters hat sie gar nicht notwendig, auch wenn ich sein Ost-meets-West-in-Berlin-Buch unausgewogen finde. Er operiert mit zwei stilistisch gegensätzlichen Ansätzen. Knapp, nüchtern und anschaulich, wenn vom Yakuza-Killer Fumio Onishi erzählt wird, tarantino-geschwätzig, wenn Annegret Bartsch, Kommissarin im Vietnamdezernat der Berliner Polizei, das Erzählkommando hat. Zwölf Seiten Redemarathon oder mehr sind angesagt, mit wenig Punkt und ganz ohne jeden Absatz, wenn es an ihre Perspektive kommt.
Kann man gut finden. Aber Spannung geht anders. Auch die zwischen Ost und West. Es entschädigen viele kleine Beobachtungen aus Berliner Milieus. Etwa: „Ein alter Stasi-Mann auf dem Flur erspart so manche Ermittlungsarbeit.“ Oder zweifelsfrei gut recherchierte, aufgefächerte Infos über die asiatische OK (Organisierte Kriminalität) in Berlin und deren Geschichte. Die Figuren habe ich trotzdem nicht geglaubt. Oder dem „bestechenden Psychogramm zweier vielfach gebrochener Menschen, die gefangen sind in den Zwängen und Absurditäten ihres jeweiligen Lebensentwurfs“. Dafür wegen Geschwurbel was auf die Finger, aber ohne Schwert.
Christopher Peters: Der Arm des Kraken. Hardcover, 352 Seiten. Luchterhand, Berlin 2015. € 19,99
 Broken Genres, phantastische Literatur
Broken Genres, phantastische Literatur
(AM) Die Leiche. Die-Leiche-die-Leiche-die-Leiche, denkt sie. Wenn man Wörter wiederholt, verlieren sie ihre Bedeutung. Eine Autorin, der man wegen ihres supersouveränen Sprachgefühls überall hin folgt, das ist die zwischen allen Genres schreibende – und vermutlich deshalb von der Kritik deutlich unter Wert gehandelte – Südafrikanerin Lauren Beukes. In „Broken Monsters“ sind es SEHR dunkle Orte, an die sie ihre Leser führt. So dunkel, dass manche Bilder aus diesem Buch sich einem in die Träume schleichen. Das schafft nun wirklich nicht jeder Roman.
Lauren Beukes schreibt auf hohem Niveau, um nicht zu sagen, auf traumhaftem: „Ich träumte, ich wäre der Traum eines Traums.“ Das ist nicht nur dahin gesagt, sondern eine alles bestimmende Erzählachse. Kunst als Form der Gegenwartsbewältigung, ganz existentiell; das marode Detroit als Boden für einen Künstlerroman, der gleichzeitig ein fulminanter Polizeiroman ist, ein bissiger Sozial- und Medienkommentar, ein glaubwürdiges Psychogramm, eine selbst Stephen King zum Niederknien bringende Horrorgeschichte, ein Stück phantastische Literatur, erschreckend, spannend und humorvoll, kritisch in Sachen Social Media und modernen Hipstertum, ein prall volles, reiches Buch. Lauren Beukes, deren Romane „Moxyland“, „Zoo City“ und „The Shining Girls“ ebenfalls angeraten sind – jeder von ihnen ist anders -, hat vor Ort in Detroit recherchiert, besonders auch in der Künstlerszene. Das macht dies Buch ungeheuer authentisch, gibt ihm die Bodenhaftung. Umso begeisternder, wie sehr Lauren Beukes sich über alle Schwerkraft erhebt, den Ort und die Genres transzendiert.
Dem CM-Autor Marcus Müntefering hat sie in seinem Fragebogen ausführlich geantwortet (hier), ganz zweifellos ist sie eine Autorin, der es auf der Spur zu bleiben lohnt. James Ellroy über Lauren Beukes: „Dig it: what a brilliant crime-phantasmagoria novel this is!!!!! This splendid novel is THE new primer on urban decay to the nth degree. I unhesitatingly urge you to buy it and read it now!!!”
Lauren Beukes: Broken Monsters. Aus dem Englischen von Alexandra Hinrichsen. Rowohlt Polaris, Hamburg 2015. Klappenbroscher, 542 Seiten, 16,99 Euro. Webseite der Autorin.
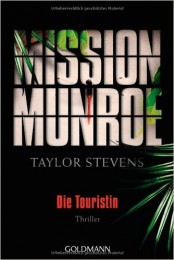 Eher Reacher, gewiss nicht Dan Brown
Eher Reacher, gewiss nicht Dan Brown
(AM) Ein Klappentext ohne Tarantino könnte so gehen: „Du denkst, ich sei harmlos. Doch unsicher zu sein ist nur eines meiner vielen Talente. Nur wenige Menschen besitzen meine Fähigkeiten. Ich bin absolut tödlich. Fordere mich nicht heraus, denn du wirst verlieren.“ Leider wird das aber ergänzt von Unsinn aus den ‚Dallas Morning News“: „Überragend! Nur Lee Child und Dan Brown kommen an Taylor Stevens heran.“ Auweia, diese Skylla-und-Charybdis-Kluft, die große Verlage wie Goldmann zwischen den Dan-Brown- und den Jack-Reacher-Lesern mit solchem Apfel-und-Birnen-Zeugs zu überbrücken suchen. Ich fürchte, dass bei der scharfkantigen Thrillerautorin Taylor Stevens eher die Vatikan-Fraktion ins Wasser fallen wird. Die anderen brausen mit ihrer androgynen, todgefährlichen Protagonistin Vanessa Michael Munroe (siehe oben) und mit somalischen Piraten in ein dicht, schnell, ortskundig und gewiss nicht langweilig erzähltes Abenteuer.
Es ist das vierte mit Munroe, und ihr bisher exotischstes. Wir hatten schon: „Mission Munroe. Die Touristin“, „Mission Munroe. Die Sekte“ und „Mission Munroe. Die Geisel“. Die Autorin Taylor Stevens (zum CM-Porträt geht es hier) hat eine Figur erfunden, die immerhin ein Echo von Modesty Blaise aufkommen lässt. Munroe Nr. 6,„The Mask“, ist im Juli 2015 in den USA erschienen. Nr. 5 war das unübersetzte eBook „The Vessel“.
Und nein: Wer Taylor Stevens surfend sucht, trifft nicht die Richtige bei der Ice Bucket Challenge auf YouTube.
Taylor Stevens: Mission Munroe. Die Spezialistin. (The Catch.) Aus dem Amerikanischen von Leo Strohm. Goldmann Verlag, München 2015. Klappenbroschur, 480 Seiten, 9,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch. Webseite der Autorin.
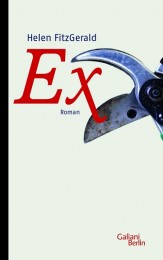 Schmerzhafte Stellen
Schmerzhafte Stellen
(FS) Seit ihrem Erstling „Furchtbar lieb“, der 2010 auf Deutsch erschien, liefert Helen FitzGerald – die sicherlich einige literarische Inspiration aus ihrer Erfahrung von mehr als zehn Jahren Sozialarbeit im Strafvollzug zieht – schwarzhumorige Krimis mit dem gewissen Etwas. Catriona, die Protagonistin ihres neuen Romans, bekommt Probleme, als sie sich bei einer Leichenschau ein Grinsen nicht verkneifen kann. Dabei entbehrt es nicht eines gewissen skurrilen Witzes, wenn man einen Ex-Lover allein über seinen Penis identifizieren muss. Wenn aber drei Ex-Freunde das Zeitliche segnen und allen dreien ebenjener Körperteil abgetrennt wurde, dann machen sich Zeugenaussagen über Kichern bei der Leichenschau vor Gericht nicht gut. Catriona landet also in Untersuchungshaft und muss von dort aus versuchen, herauszufinden, was wirklich passiert ist. Dass sie selbst große Erinnerungslücken hat, macht sie zu einer recht unzuverlässigen Erzählerin.
Was sie noch weiß, ist, dass sie sich vor ihrer nahenden Hochzeit von ihren Ex-Freunden verabschieden wollte. Dass es dabei auf Sex hinauslaufen würde, war eigentlich nicht geplant – und dass sich die Männer sehr endgültig nicht nur aus Catrionas Leben verabschiedeten, wohl auch nicht. Helen FitzGerald mischt die lückenhafte Erzählperspektive Catrionas mit den Manuskriptseiten einer Journalistin, die sich Catrionas Vertrauen erschlichen hat, sie in der reißerischen Biographie jedoch als Psychopathin darstellt. Fast alle ihrer Quellen scheinen dieses Bild zu bestätigen, stehen aber in krassem Widerspruch zu den Aussagen Catrionas. So fügen sich viele Puzzleteile zunächst kaum ineinander, legt die Autorin Fährten in verschiedenste Richtungen.
Wer Helen FitzGeralds Romane kennt, weiß, dass die Story bis zum blutigen Showdown so manche unerwartete Wendung machen wird. Vielleicht ist dies der einzige Vorwurf, den man ihr machen kann: Dass die Masche der unvorhersehbaren Haken als Masche erkennbar wird und der Leser ihrer ersten Bücher nicht mehr so ohne weiteres jeder falschen Fährte auf den Leim geht, nicht mehr jeden erzählerischen Köder schluckt. Auch wenn die Geschichte für männliche Leser so manch schmerzhafte Stelle parat hat – was sich weniger auf die Amputation bezieht, sondern vielmehr auf die entlarvende Charakterzeichnung -, ist die Lektüre ein großer Spaß. Zimperlich sollte man allerdings nicht sein. Jemand hat Fitzgeralds Prosa mit den Filmen der Coen-Brüder verglichen. Besser kann man es eigentlich nicht beschreiben.
Helen FitzGerald: Ex (Ex, 2011). Roman. Aus dem Englischen von Steffen Jacobs. Berlin: Galiani Berlin 2015. Klappenbroschur, 240 Seiten, 14,99 Euro.
Verlagsangaben zum Buch und zur Autorin.
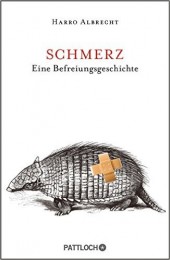 Hier tut es weh
Hier tut es weh
(AM) Sie steht noch aus, die Kulturgeschichte des Schmerzes in der Kriminalliteratur –obwohl der Schmerz doch ganz gewiss für das Genre prägend ist. „Das Leiden anderer zu betrachten“ (Susan Sontag), letztlich mehr oder weniger mitzuleiden, die eigene Empfindsamkeit, Empathie oder Kaltblütigkeit zu testen oder zu erleben, das alles gehört gewiss zu den unterirdischen Motiven, sich Kriminalromanen auszusetzen. In keinem anderen Genre ist per se derart viel an Schmerz versammelt.
Vermutlich machen wir alle es uns zu wenig klar, wie viel an Leid und Schmerz das Personal von Kriminalromanen zu erleiden und auszuhalten hat, wie viel an Verletzungen, Schlägereien, Todesqual ein mittlerer Kriminalroman enthält, die Nahbetrachtungen von Schmerz und Qual und Folter, vorzugsweise aus der Opferperspektive, dabei ein besonders gewinnträchtiges Segment. Machen Sie ein Experiment, liebe Leserinnen und Leser, und betrachten Sie doch einmal die Cover auf den Krimi-Büchertischen in Hinblick auf das dort ausgebreitete und versprochene Schmerz-Potential. Wie oft ruft es Ihnen da entgegen: Hier tut es weh! Nietzsches „Ecce homo“ – Ich leide, also bin ich -, findet hier großflächig irdische Niederkunft.
Nicht dass der Arzt und Wissenschaftsjournalist Harro Albrecht sich direkt mit dem Schmerz im Kriminalroman beschäftigen würde, sein Buch zielt erst einmal auf die 16 Millionen Deutschen, die unter andauernden oder wiederkehrenden Schmerzen leiden. Rücken-, Knie- oder Kopf- davon die häufigsten. Aber sein 608 Seiten starkes Buch geht weit über das Für und Wider von Schmerztherapien hinaus. Es leistet tatsächlich den Anfang einer Kultur- und Sozialgeschichte des Schmerzes.
Albrecht sagt: „Der Schmerz ist die Grenzfläche, an der Psyche und Körper aufeinandertreffen. Er ist ein Phänomen, welches das ganze menschliche Leben umfasst. Er ist die Grundlage vieler Religionen und Motor der Kultur. Ohne Schmerz keine Kunst, keine Sprache und kein Denken. Damit führt das Nachdenken über diese unangenehme, oft belastende Empfindung weit über die Medizin hinaus.“ Die antiken Griechen übrigens bezeichneten den Schmerz als Leidenschaft der Seele.
Harro Albrecht: Schmerz. Eine Befreiungsgeschichte. Hardcover, 608 Seiten. Droemer Knaur / Pattloch, München 2015. 24,99 Euro. Verlagsinfo hier.
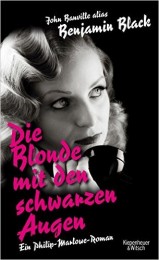 Marlowe lebt
Marlowe lebt
(KH) Unter dem Alias-Namen Benjamin Black widmet sich der berühmte irische Schriftsteller John Banville auch immer wieder dem Krimi-Genre und erweckt nun mit „Die Blonde mit den schwarzen Augen“ den Kult-Detektiv Philip Marlowe zum Leben. Auch wenn dies nicht jedermanns Sache ist und die Fußstapfen gewiss groß sind: Die erste Szene ist eine klassische Chandler-Eröffnung: Die titelgebende Blonde mit den schwarzen Augen – reich, geheimnisvoll – betritt das Büro von Philip Marlowe und beauftragt ihn, nach ihrem angeblich bei einem Autounfall getöteten Liebhaber zu suchen. Wie nicht anders zu erwarten, sticht Marlowe bei seinen Ermittlungen in ein Wespennest und hinter vielen Schichten falscher Fährten und Vertuschungen führt der Fall zur Auftraggeberin zurück, in die er sich verliebt hat, „auf eine schmerzliche, hoffnungslose Art“.
Benjamin Black trifft den Sound der Chandler-Klassiker täuschend echt und zieht den Leser in die südkalifornische Noir-Atmosphäre der 1930er und 40er Jahre. Sein Marlowe tritt vielleicht eine Spur reflektierter auf als das Original und philosophiert schon einmal gerne über die Welt, die Einsamkeit oder den magischen ersten Schluck Bier. Aber sonst ist er wie Chandlers Figur ein Mann mit eisernen Prinzipien und großer Gelassenheit, der sich auch von allen Bedrohungen und Bestechungsversuchen nicht von seiner Spur abbringen lässt. „Die Blonde mit den schwarzen Augen“ ist ein kurzweiliges und durchaus spannendes Retro-Lesevergnügen. Es ist, um Stephen King zu zitieren, „als würde ein alter, tot geglaubter Freund plötzlich den Raum betreten“. Vielleicht dürfen wir diesen alten Freund in Zukunft noch des Öfteren bei seiner Arbeit erleben, denn in Raymond Chandlers Nachlass befand sich eine Liste möglicher Titel für zukünftige Romane. Den ersten hat Benjamin Black nun abgearbeitet, aber es warten noch solche wie „The Man with the shredded ear“ oder „Stop screaming – It’s me“.
John Banville alias Benjamin Black: Die Blonde mit den schwarzen Augen (The Black-Eyed Blonde, 2014). Aus dem Englischen von Kristian Lutze. Köln: Kiepenheuer & Witsch 2015. Klappenbroschur, 288 Seiten, 14,99 Euro. Verlagsangaben zum Buch und zum Autor.
 Gewalt – Das Erleben von Grandiosität
Gewalt – Das Erleben von Grandiosität
(AM) „Die Gewalt lebt davon, dass sie von Anständigen nicht für möglich gehalten wird.“ Dieses Zitat von Jean-Paul Sarte steht der Ausgabe August/ September 2015 des „Mittelweg 36“ voraus, der zweimonatlich erscheinenden Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung. „Der Gewalt ins Auge sehen“ heißt das Heft. Es enthält unter anderem Jan Philipp Reemtsmas Abschiedsvorlesung „Gewalt als attraktive Lebensform betrachtet“.
Es ist ein wichtiger Text. Dies nicht nur, weil er ein in jeglicher Hinsicht ungewöhnliches Forscherleben in geschliffener Form bündelt, sondern weil dieser Text – mit seinem ganzen kulturgeschichtlichen Hintergrund – in diesen Tagen, da sich Hass und Gewalt gegen Ausländer in (fast) alter Ungezügeltheit zeigen, uns allen ein wenig den Kopf wäscht. Und die Sache klarer sehen lässt. Unser Erklärungsbegehren, hält Reemtsma uns vor, wolle unentwegt verborgene Gründe aufdecken, wolle ein Rätsel da sehen, wo keines sei, und weiche „der verstörenden Erkenntnis des Offensichtlichen aus: Die Zugehörigkeit zu Gewaltmilieus und die (kollektive) Ausübung von Gewalt bieten Gratifikationen, die in der bürgerlichen Gesellschaft ihresgleichen suchen – eine als grenzenlos erlebte Möglichkeit der Entsublimation.“
Zuordnung wie „Pack“, „Gesindel“, „Dreck“ oder andere Abwertungen und Ausgrenzungen helfen nicht weiter, meint er. An Gewalt könne man genauso „unerklärbar“ Geschmack finden wie am Genuss von Whisky, der nach Moorleichen und Torfbrand schmecke. Der persönliche Erlebnis der Machtwillkür sei von einer Faszination und Grandiosität wie das bürgerliche Leben sie nicht zu bieten vermöge. Das Heft ist mittlerweile ausverkauft und nur noch als E-Journal erhältlich.
Mittelweg 36. Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Schwerpunkt: Der Gewalt ins Auge sehen. 24.Jahrgang, Heft 4, August/ September 2015. 120 Seiten, 9,50 Euro. E-Journal hier.
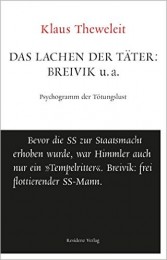 Wenn Henry Fonda lächelt
Wenn Henry Fonda lächelt
(AM) Es ist ein Filmbild, das Klaus Theweleit sich als Leitmotiv für „Das Lachen der Täter: Breivik u.a. Psychogramm der Tötungslust“ wählt. Das Lächeln von Henry Fonda, wenn er den zehnjährigen Jungen, den letzten Überlebenden der Familie McBain erschießt, um deren strategisch wichtigen Grundbesitz sich die Geschichte von Sergio Leones Western „Spiel mir das Lied vom Tod“ rankt. Die Familie wird aus dem Hinterhalt niedergeschossen, dann treten erst zwei, dann drei weitere Männer in langen Staubmänteln aus dem Gebüsch, gehen auf den Jungen zu, der bei den Schüssen aus dem Haus rannte und nun den Mördern gegenübersteht. „What are we gonna do with this one, Frank?“, fragt einer. Was sollen wir mit diesem hier tun? „Jetzt, wo du meinen Namen genannt hast“, knurrt der, sammelt seine Kautabakspucke, wirft sie aus und lächelt – Henry Fonda, der good guy des Western, hier bei dessen Grabgesang – und zieht seinen Revolver. Und lächelt. Und schießt. Fast drei Minuten zieht sich die Hinrichtung des kleinen Jungen hin, neun Minuten die ganze Szene, und neben aller Opern- und Genrekunst ist bei Sergio Leone auch ordentlich Sadismus dabei, wie er in diesem langen, großartigen Film immer wieder Henry Fondas Lächeln gegen die Pein und Ohnmacht seiner Opfer setzt. Bis ihm Charles Bronson zu guter Letzt buchstäblich diesen lächelenden Mund mit einer Harmonika stopft, damit der Titel endlich wahr wird: Spiel mir das Lied vom Tod!
Theweleit kennt auch den Vorläufer dieser Szene und dieses Lächelns; in „Shane“ (1953) ist Jack Palance der lächelnde Böse. Er wird derart symbolisch bestraft, dass die Brüder John Foster und Allan Dulles – der eine US-Außenminister, der andere CIA-Chef – den Film gerne ausländischen Staatsgästen vorführen ließen, um zu zeigen, wie man in den USA mit dem Böse umgehe. Der Böse aber lächelt, lächelt bis heute. Von Palmyra bis Oslo. Dass man ihn dann wegsperrt oder umbringt, ist ihm recht egal – nach diesem Moment der eigenen, die menschliche Gemeinschaft verlassende Grandiosität. Reemtsma lässt grüßen.
Anders Behring Breivik mordete und lächelte am 22. Juli 2011 in Oslo. Eine obszöne Zahl von Toten, von einer einzigen Hand. „Du sollst Bestie sein“, heißt ein Roman von Uzodinma Iweala. Theweleit stellt sie uns vor, forscht ihnen nach, den Bestien. Das Lachen der Töter war ihm zuerst beim Sammeln der Stoffe für „Männerphantasien“ (1977/8) aufgefallen; viele der von den Freikorps-Soldaten gefeierten Morde an den aufständischen Arbeitern der Novemberrevolution von 1918 wie auch die Morde an Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht wurden als „Lustmorde“ begangen, gefeiert und ausgestellt.
Dies Buch nun, das mich in manchem an Reinhard Lettaus „Täglicher Faschismus“ (1971) erinnert, knüpft an, aber rundet nicht. Vorhang zu und alle Fragen offen. Hervorgegangen aus der „Frühlingsvorlesung“ an der Akademie Graz 2014, ist dieses Buch laut Autor „zum großen Teil gemacht aus Zeitung; geschrieben entlang aktueller Zeitungsberichte über die in ‚politischen‘ sowie ‚religiösen‘ Kontexten verübten Gewalttaten der letzten Jahre zwischen ‚Breivik‘ und ‚Charlie Hebdo‘, zwischen den Killern des IS, dem Genozid an der Tutsi-Bevölkerung in Ruanda… und den Morden des deutschen NSU.“ Das Buch bleibt mehr Stoffsammlung als stringente Analyse, die aber eh, wenn ich KT nicht zu nahe trete, nicht so ganz seine Sache ist, sondern eher die These.
Klaus Theweleit: Das Lachen der Täter: Breivik u.a. Psychogramm der Tötungslust. Aus der Reihe „Unruhe bewahren“. Residenz Verlag, Salzburg 2015. Klappenbroschur, 246 S., 22,90 Euro. Verlagsinformationen hier.
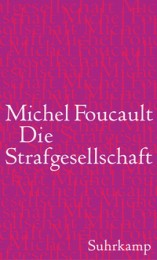 Der innere Feind
Der innere Feind
(AM) Der 1984 an AIDS gestorbene Michael Foucault fehlt im Wissenschaftsbetrieb, man mag sich kaum vorstellen, mit welchem Feuerschwert er über die Rechtlosigkeit der Migranten, Flüchtlinge und prekär Beschäftigen oder die Unantastbarkeit der Finanzelite seinen so geliebten Diskurs führen würde. „Die Gefängnis-Form“, betont er in seinen nun zugänglichen gemachten Vorlesungen zur Strafgesellschaft, „ist weit mehr eine Gesellschaftsform als eine Architekturform.“ Die Strafgesellschaft, das ist eine Machtgesellschaft – und natürlich stellt sich die Frage, wer die Macht hat und warum. Foucault arbeitet unter anderem eine Theorie der Illegalismen heraus, „jede Klasse und Kaste hat ihre je eigene Illegalität“. Noch aufregender aber ist, was er – mit vielen Diskurssträngen zur Disziplinarkultur und in Verlängerung Benthams zum Panoptimus (zur CM-Besprechung) – als Summe seiner 13 hier versammelten Vorlesungen letztlich zum Vorschein bringt: nämlich die ersten Beispiele für eine Überwachungskultur. Die NSA lässt grüßen.
Foucaults Vorlesungen am College de France 1972-1973 über „Die Strafgesellschaft“, die 2013 bei Gallimard und jetzt bei Suhrkamp erschienen sind, sollten der Vorbereitung seines wohl wirkmächtigem Buches dienen – seinem „Überwachen und Strafen“. Der Philosoph, Soziologe, Psychologe und Historiker aber schaut weit über eine Entstehungsgeschichte des Gefängnissystems hinaus, er nimmt die gesamte kapitalistische Gesellschaft in den Blick – als eine spezifische Organisation vielfältiger Regelverstöße. Etwas, das wir uns angewöhnt haben, „den Wahnsinn“ zu nennen. Foucaults Buch gehört zweifellos zu den großen Werken über die Geschichte des Kapitalismus.
Schön, zu sehen, dass in akademische Texte der frühen 1970er noch so viel Editionsarbeit gesteckt wird. Eingeordnet und erläutert, zum Beispiel in Bezug auf den „Anti-Ödipus“ von Deleuze und Guattari, – schon lange nichts mehr von „Schizoanalyse“ gehört – werden Foucaults Vorlesungen in einem mehr als 50-seitiges Nachwort von Bernard E. Harcourt („The Illusion of Free Markets“), Professor für Recht und Politikwissenschaft an der Universität von Chicago und Forschungsdirektor an der Ècole des hautes études en sciences sociales in Paris. Auch ein Namens- und ein breit angelegtes Sachregister erschließen „Die Strafgesellschaft“, deren Ziel laut Foucault weniger der Kriminelle als der innere Feind ist.
Michel Foucault: Die Strafgesellschaft. Vorlesung am Collège de France 1972-1973. Aus dem Französischen von Andrea Hemminger. Suhrkamp Verlag, Berlin 2015. 443 Seiten, 44,00 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.











