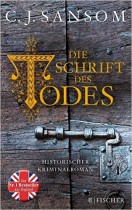Kurz und blutig
Heute mit neuen kriminellen Texten von John Niven (Old School), Veit Etzold (Der Todesdeal), Jürgen Kehrer (Wilsbeg. Ein bisschen Mord muss sein), Rainer Küster (Schuldenspiele), Peter Høeg (Der Susan-Effekt), Christian Keßler (Der Schmelzmann in der Leichenmühle / Wurmparade auf dem Zombiehof), Jörg Buttgereit (Besonders Wertlos), Charly Weller (Finsterloh), Sam Hawken (Kojoten), C.J. Sansom (Die Schrift des Todes) und Richard Price (Die Unantastbaren). Besprochen von Max Annas (MA), Joachim Feldmann (JF), Alf Mayer (AM), Marcus Müntefering (MM) und Alexander Roth (AR).
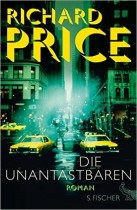 An Schlaf ist nicht zu denken
An Schlaf ist nicht zu denken
(AR) Detective Billy Graves, einst Mitglied der glorreichen „Wildgänse“, einer gefürchteten Gruppe von New Yorker Polizisten, muss Nachtschicht schieben. Er hält sich mit Energydrinks, hastig gerauchten Zigaretten und dem Hass auf jenen ganz speziellen Mörder wach, den er nicht hatte fassen können. Seinen damaligen Kollegen ergeht es nicht anders. Jeder von ihnen hat seinen eigenen „Unantastbaren“, der ihnen damals durch die Lappen ging, den sie unbedingt seiner gerechten Strafe zuführen möchten. Dann wird einer dieser Männer ermordet – und wie Brackwasser aus den Kanaldeckeln überfluteter Straßen werden die alten Geschichten wieder hochgespült.
Dass Richard Price es kann, darüber müssen wir nicht diskutieren. „Clockers“, „Cash“, seine Drehbücher für „The Wire“ – wo sein Name draufsteht, ist Qualität drin. Für seinen neusten Roman legte er diesen zwar kurzzeitig ab (siehe hier), dem Ergebnis tat dies jedoch keinen Abbruch. Mit gestochen scharfen Sätzen hangelt sich der Autor an alten Tatortfotos entlang in die dunkelsten Stunden der Nacht.
So viel Leid, so viel Gewalt. Price bemüht nicht das Klischee des gebrochenen Polizisten, er zeigt vielmehr, wie es Menschen verändert, tagtäglich mit dem Unmenschlichen konfrontiert zu werden. Irgendwann im Laufe der Geschichte nimmt man die unzähligen Gräueltaten, die Billy Graves mitansehen muss, nur noch als Regentropfen wahr, die auf der Scheibe seines Dienstwagens Schlieren ziehen, gebannt von der diffusen Gefahr, die den ausgemergelten Familienvater in immer kleiner werdenden Abständen umkreist. „Die Unantastbaren“ ist ein atemloser, grimmig-düsterer Cop-Thriller, ebenso intim wie humorvoll – und damit alles, was die zweite Staffel von „True Detective“ gerne gewesen wäre.
Richard Price: Die Unantastbaren. Roman. Aus dem Amerikanischen von Miriam Mandelkow. Gebundene Ausgabe. Fischer, Frankfurt am Main 2015. 426 Seiten, 24,99 Euro.
Ein ganz anderes Kaliber
(JF) Nicht selten unterscheiden sich so genannte historische Krimis nur durch Kostümierung und Kulisse von gewöhnlichen Genreprodukten. Als Stapelware türmen sie sich auf den Tischen im Eingangsbereich der Filialbuchhandlungen. Hier dürfte momentan auch C. J. Sansoms neuer Roman „Die Schrift des Todes“ zu finden sein, dessen Aufmachung die übliche Schmökerware vermuten lässt. Qualitativ jedoch ist dieser sechste Band einer Reihe um den fiktiven Anwalt Matthew Shardlake, dessen Karriere im Windschatten Thomas Cromwells, des später in Ungnade hingerichteten Gefolgsmann Heinrichs VIII, beginnt, von anderem Kaliber. Der studierte Historiker und Jurist Sansom verfügt über die nötige Expertise, um lächerliche Anachronismen zu vermeiden. Das hat er mit der Booker-Preisträgerin Hilary Mantel, deren hochgelobte Romane um Thomas Cromwell das populäre Interesse an der Tudor-Zeit wieder entfacht haben, gemeinsam. Andererseits ist er ein gewiefter Spannungsautor. Gerade der Umstand, dass sein Ermittler Shardlake bei jedem Schritt auf die jeweiligen Machtverhältnisse Rücksicht nehmen muss, macht den Reiz des Erzählten aus. „Die Schrift des Todes“, im Original schlicht „Lamentation“, spielt während der letzten Regierungsmonate Heinrichs VIII, eine Zeit wüstester konfessioneller Konflikte. Seine sechste Frau Catherine Parr hat ein religiöses Bekenntnisbuch verfasst, das ihr äußerst gefährlich werden könnte, geriete es in falsche Hände. Doch genau das geschieht, und Shardlake hat einen Auftrag, der ihn wieder einmal das Leben kosten könnte. Glücklicherweise hat sich Sansom nicht dafür entschieden, im Gegenteil. Der letzte Satz des Romans deutet eine neue Auftraggeberin an, die allerdings erst elf Jahre später den englischen Thron besteigen wird: Elisabeth I.
J. Sansom: Die Schrift des Todes. Historischer Kriminalroman. (Lamentation. 2014). Aus dem Englischen von Irmengard Gabler. 768 Seiten. Frankfurt am Main. Fischer: 2015. € 14,99.
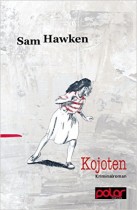 Nicht was, sondern wie
Nicht was, sondern wie
(MM) Es gibt Autoren, deren Romane will man unbedingt gut finden. Weil sie wirklich etwas zu sagen haben, weil sie sympathisch sind und eigentlich genau die Sorte Bücher schreiben, die man mag. Geradezu exemplarisch für diese Sorte Schriftsteller ist Sam Hawken, ein Amerikaner, der Geschichten erzählt über La Frontera, das amerikanisch-mexikanische Grenzgebiet. Über die Menschen, die innere und äußere Grenzen überwinden müssen, um sich ihren Traum vom richtigen Leben zu erfüllen. Und über Menschen, deren Träume schon längst an den unerträglichen Realitäten zerschellt sind. Sein Personal sind Flüchtlinge, Texas Ranger, Boxer, Cops – und Kojoten. „Kojoten“ heißt auch sein jetzt im Polar Verlag erschienener Roman (390 S., 14,90 Euro, übersetzt von Karen Witthuhn, Vorwort von Tobias Gohlis), es ist nach „Die toten Frauen von Juarez“ der zweite, der auf Deutsch vorliegt. In drei Episoden, die sich erst ganz am Ende verbinden, erzählt Hawken davon, worüber er so viel zu sagen hat: das harte Leben an der Grenze. Was er erzählt, ist nicht das Problem, sondern wie er es erzählt. Die Episoden sind brav aufgereiht, jedem Protagonisten gehört genau ein Drittel des Romans: Ana, Texas Ranger, die in der Grenzstadt Presidio ihren Dienst tut und in der Wüste auf eine Leiche stößt; Luis, der ehemalige Kojote, der dabei ist, sich eine bürgerliche Existenz aufzubauen, aber eigentlich keine Chance hat; Marisol, die allein aus El Salvador aufbricht, um über Mexiko in die USA zu gelangen. Man mag diese Figuren, man mag auch diesen Roman, aber letztlich fehlt ihm die Radikalität, die Härte, die erzählerische Kraft, die zum Beispiel Antonio Ortuños „Die Verbrannten“ auszeichnet.
Sam Hawken: Kojoten. (La Frontera, 2013). Aus dem Englischen von Karen Witthuhn. Polar Verlag 2015. 390 S., 14,90€
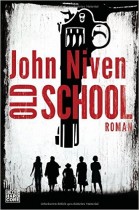 Amüsant damals und amüsant heute
Amüsant damals und amüsant heute
(MA) Ein Wort wie amüsant hört sich heute ja abwertend an, aber ich meine es gar nicht so. Filme von Stanley Donen waren zum Beispiel amüsant, nicht alle, aber einige. Und „Charade“ sogar sehr. Cary Grant war damals ungefähr so alt wie einige der Protagonistinnen aus John Nivens neuem Roman. Aber er hätte sich nie als alt verkaufen lassen. Julie Wickham und Susan Frobisher haben damit allerdings kein Problem. Ihr Problem ist vielmehr, dass sie alt sind und nicht wissen, wovon zum Teufel sie im Alter leben sollen. Die amüsante Räuberinnenpistole beginnt, als Susans Gatte in einer absolut unvorteilhaften Position tot aufgefunden wird. Der Riesendildo in seinem After wäre bei Donen natürlich nie ein Thema gewesen – aber das unterscheidet vielleicht amüsant damals und amüsant heute.
Aus der Notsituation der beiden Frauen entwickelt sich die Geschichte eines Finanzausgleichs. Sie suchen sich eine Bande und überfallen die nächste Bank. Und wirklich die allernächste. Niven ist mehr an der Entwicklung der lustigen Szene als solcher interessiert als an Plot-Logik, und die Sache mit dem Dildo ist bei weitem nicht der letzte Scherz auf Kosten jener beliebten Körperöffnung. Aber die Geschichte funktioniert trotzdem sehr gut. Vielleicht auch deshalb, weil die Bande alter Frauen, der alte Mann macht es nicht lange, so uncool ist, dass man sie nebenbei noch als Genrekritik lesen kann.
John Niven: Old School (Sunshine Cruise Company, 2015). Aus dem Englischen von Stephan Glietsch. Gebundene Ausgabe, Heyne Hardcore, München 2015. 400 Seiten, 19,99 Euro.
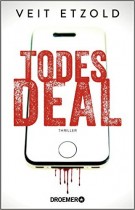 Dialoge im Lexikonformat
Dialoge im Lexikonformat
(JF) „Als Lucia Ming am Gate vorbei in das Flugzeug stieg, wurde ihr klar, dass sie noch nie zuvor nach Afrika geflogen war. In diesem Moment spürte sie einen Blick im Nacken. Sie drehte sich um und schaute in zwei blaue Augen.“ Die junge Dame, bei der übersinnliche Fähigkeiten mit einer seltsamen Gedächtnisschwäche einherzugehen scheinen, spielt eine zentrale Rolle in Veit Etzolds Politthriller „Todesdeal“, der sich engagiert dem ohne Skrupel geführten globalen Krieg um Rohstoffe widmet. Der Autor, dessen beeindruckende weltweite Aktivitäten nur aufgrund von Platzmangel hier unerwähnt bleiben sollen, verfügt über geradezu enzyklopädische Kenntnisse der internationalen Politik, ist aber nur bedingt in der Lage, diese erzählerisch zu vermitteln. Deshalb schreibt er Dialoge, in denen seine Figuren ganze Lexikonartikel von sich geben.
Auch Lucia Ming, die für einen chinesischen Staatsfonds arbeitet, lässt sich von von einem Funktionär erklären, weshalb die Volksrepublik bevorzugt in westlichen Rohstofffirmen investiert. Schließlich müsse „der Rohstoffhunger unseres Anderthalb-Milliarden-Volkes gestillt werden“. Genauso werden sie reden, die alten Parteikader. Auskunftsfreudig zeigen sich auch zwei junge Deutsche im Kongo, die gerade auf einen illegalen Waffendeal gestoßen sind. Ebenso empört wie erstaunt tragen sie sich ihre Kenntnisse über die tatsächlich üble Rolle Deutschlands im internationalen Rüstungsgeschäft vor, um dann einen Vers aus Paul Celans bekanntestem Gedicht zu zitieren. Einer der beiden ist übrigens der Besitzer jener blauen Augen, die Lucia Ming im Nacken spürte. Was diesen Roman ansonsten füllt, ist das übliche Thrillermaterial – böse Russen, diabolische Warlords und sinistre Geheimdienstler inclusive.
Wer Stieg Larssons Millenium-Trilogie für Aufklärungsliteratur hält, wird von Veit Etzold nicht enttäuscht sein.
Veit Etzold: Todesdeal. Droemer, München 2015. 474 Seiten. 14,99 Euro.
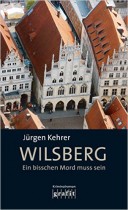 Klassische Muster
Klassische Muster
(JF) Aufrechte Privatermittler haben es schwer. Vor allem, wenn sie es mit zwielichtigen Auftraggebern zu tun bekommen, die mit einem Bündel großer Scheine vor ihrer Nase herumwedeln. Da ist die Verlockung groß, allen Edelmut fahren zu lassen. Doch Georg Wilsberg bleibt standhaft. Einen „Rest Würde“ habe er sich bewahrt, davon ist er überzeugt. Aus diesem Grund geht es ihm auch besonders miserabel, wenn seine Motive verkannt werden. Dann fühlt er sich wie jemand, „der seine Seele schon zum dritten Mal an denselben Teufel verkauft hat“. Glücklicherweise ist ihm sein entscheidender Fehler zu diesem Zeitpunkt noch nicht bewusst, er hätte vielleicht noch ein drastischeres Bild gewählt. Denn am Ende steht er ziemlich düpiert da. Der Fall ist gelöst, doch die Bösen kommen davon.
In diesem Sinne folgt „Wilsberg. Ein bisschen Mord muss sein“ den klassischen Mustern des hartgesottenen Detektivromans. Aber damit erschöpfen sich die Gemeinsamkeiten auch schon. Jürgen Kehrer lässt seinen Privatschnüffler, den viele nur noch als Hauptfigur der gleichnamigen ZDF-Serie kennen dürften, nämlich in der Welt von Schlager und Karneval ermitteln, und da geht es eben doch recht albern zu. Die leicht windschiefe Konstruktion des Plots tut ein Übriges. So liest man das Büchlein ohne rechte Anteilnahme flott weg und wünscht sich, das einst so beschauliche Münster wäre in den vergangenen Jahren nicht zur westfälischen Krimimetropole mutiert.
Jürgen Kehrer: Wilsberg. Ein bisschen Mord muss sein. Grafit, Dortmund´2015. 189 Seiten. 9,99 Euro.
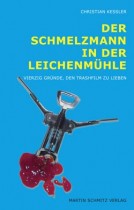 Splatting Images
Splatting Images
(AM) Am Anfang war das Kino. Es erblickte das Licht der Welt auf dem Rummelplatz, im Schatten der Schiffschaukel. Sein Vater war die Geisterbahn, seine Mutter der Stand mit den Lebkuchenherzen. So poetisch fängt Christian Keßlers zweite Sammlung wüster Filme an. Er unterteilt sie in Raumfilme, Alienfilme, Affenfilme, Testosteronfilme, Außenseiterfilme, Politische Filme, Freß-, Musik- und Ingwerfilme und Filme, die sonst nirgendwo reinpassen. Wer seine Beiträge in der Berliner Filmzeitschrift „Splatting Image“ nicht kennt, wird ganz schön von den Socken sein. Wer diesen unerschrockenen, keiner Geschmacklosigkeit aus dem Weg gehenden Autor mag, kann noch zum Vorläuferbuch „Wurmparade auf dem Zombiehof“ greifen. Dort gab es Eisbrecher, Klassiker, Monsterfilme, Männerfilme, Frauenfilme, Bauern-, Bekloppten-, Kirchen-, Mutanten- und Penisfilme, sowie den Rest vom Schützenfest.
Etwas mehr Metaebene, aber nicht nur,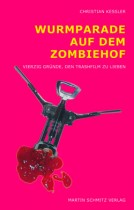 gibt es in Jörg Buttgereits Filmtext-Sammlung „Besonders wertlos“, die ich als ehemaliger Direktor der Filmbewertungsstelle Wiesbaden (FBW, die mit den Prädikaten, nicht die Altersfreigaben) nur dringendst empfehlen kann. Jemand muss sich ja doch kundig, witzig, engagiert und liebevoll um den ganzen Trash kümmern. Buttgereit und Keßler tun das. Auch ihr Verleger Martin Schmitz, der sich zudem noch mit Architektur und Stadtplanung auskennt (was hier keine Rolle spielt), sich um „Die Tödliche Doris“ kümmerte und kümmert, eine Vergangenheit als Galerist und eine Gegenwart als Uni-Professor hat, weiß, was er tut. Alle drei Bücher haben auch je ein Register.
gibt es in Jörg Buttgereits Filmtext-Sammlung „Besonders wertlos“, die ich als ehemaliger Direktor der Filmbewertungsstelle Wiesbaden (FBW, die mit den Prädikaten, nicht die Altersfreigaben) nur dringendst empfehlen kann. Jemand muss sich ja doch kundig, witzig, engagiert und liebevoll um den ganzen Trash kümmern. Buttgereit und Keßler tun das. Auch ihr Verleger Martin Schmitz, der sich zudem noch mit Architektur und Stadtplanung auskennt (was hier keine Rolle spielt), sich um „Die Tödliche Doris“ kümmerte und kümmert, eine Vergangenheit als Galerist und eine Gegenwart als Uni-Professor hat, weiß, was er tut. Alle drei Bücher haben auch je ein Register.
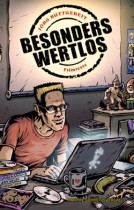 Christian Keßler: Der Schmelzmann in der Leichenmühle. Vierzig Gründe, den Trashfilm zu lieben. Martin Schmitz Verlag, Berlin 2015. 300 Seiten. 18,80 Euro.
Christian Keßler: Der Schmelzmann in der Leichenmühle. Vierzig Gründe, den Trashfilm zu lieben. Martin Schmitz Verlag, Berlin 2015. 300 Seiten. 18,80 Euro.
Ders.: Wurmparade auf dem Zombiehof. 288 Seiten. 18,80 Euro
Jörg Buttgereit: Besonders Wertlos. Filmtexte. Illustrationen von FuFu Frauenwahl. Martin Schmitz Verlag, Berlin 2015. 200 Seiten, farbige Abbildungen. 17,80 Euro. Informationen zum Verleger hier, zu den Büchern hier und hier. Auch ziemlich lustig: Eine Liste von Pornofilmen berühmter Regisseure.
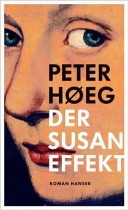 Naturwissenschaften, unterhaltsam
Naturwissenschaften, unterhaltsam
(AM) Guter Anfang, gutes Setting, rasant entwickelt. Ein Einstieg, der Freude aufkommen lässt. Kleiner Auszug: „Die meisten halten Gefängnisse für stille Orte, niedergedrückt von Reue und Selbstprüfung. Das ist ein Irrtum. In Gefängnissen herrscht ein Lärm wie in Raubtierkäfigen zur Fütterungszeit.“ Wer da so kühl analysiert ist Susan Svendsen, Experimentalphysikerin an der Universität Kopenhagen mit Verbindungen in die höchsten Kreise von Wissenschaft und Gesellschaft, die Icherzählerin des „Susan-Effekts“, eines Buchs im Thrillergewand, das immerhin irgendwie gegen „Fräulein Smillas Gespür für Schnee“ von 1992 antritt.
Tatsächlich bin ich Susan sehr lange gefolgt, die nicht nur ihren Gasherd eigenhändig konfigurieren („29 Millibar, das sind dreißig Prozent über dem zugelassenen Maximum, ich mag es, wenn die Flammen fauchen“), sämtliche physikalischen Gesetze vor- und rückwärts aufsagen, einem die Rationalität und Schönheit der Naturwissenschaften vermitteln, ohne Anstrengung 250 Studenten unterscheiden, sondern auch kaltblütig die wundersamsten Dinge vollbringen kann. Sehr witzige, verblüffende Dinge. Der Unterhaltungsfaktor dieses Buchs ist hoch. Nur die Superfrau mit der einen einzigartigen Eigenschaft, die nehme ich dem Erzähler Peter Høeg nicht ab. „Ich rufe Aufrichtigkeit hervor“, sagt Susan. Menschen müssen in ihrer Gegenwart einfach die Wahrheit ausplaudern, wird behauptet. Müssen sie nicht (alle), tun sie nicht (alle). Dieser McGuffin wird nach erzählerischem Belieben ein- oder ausgeschaltet, würde ja auch sonst den Suspense hemmen wie der Teufel.
Man stelle sich einen Kriminalroman vor, in dem die Heldin einfach zu allen Leuten sagt: „Was ist die Wahrheit?“, und zack gibt es die ehrliche Antwort. Also klarer Fall von Autorenselbstfesselung. Dazu kommt, wie ja schon bei Frøken Smilla eine gewisse Überfrachtung im Abgang. Zu immerhin 80 Prozent aber ist dies ein blendend geschriebener, immer wieder witziger philosophischer Roman in Thriller-Form, der viele kluge Beobachtungen und Einsichten bietet, Lust auf Naturwissenschaft macht und echte moralische Fragen aufwirft. Es gibt schlechtere Verkleidungen. Dümmere Bücher.
Peter Høeg: Der Susan-Effekt (Effekten af Susan, 2014). Aus dem Dänischen von Peter Urban-Halle. Hanser Verlag, München 2015. 400 Seiten. 21,90 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.
 Bodenständig und traditionell
Bodenständig und traditionell
(JF) Regietheater ist schlimm, Steuerhinterziehung ist schlimmer. Aber muss man den Schauspielers Leon Steiner, der sich gerade als Titelheld einer wirren „Wilhelm Tell“-Aufführung hat bejubeln lassen, deshalb gleich bewusstlos schlagen und im Kofferraum vom Ruhrgebiet bis an die Nordsee transportieren? Diese Frage könnte sich Hauptkommissar Erich Rogalla von der Bochumer Kripo stellen, doch leider tappt er im Fall des verschwundenen Bühnenstars vollkommen im Dunkeln. Dann geschieht ein Mord, der Ermittlungsdruck steigt und Rogalla beginnt die Fäden des trickreichen Plots, mit dem Rainer Küsters Kriminalroman „Schuldenspiele“ aufwartet, zu entwirren. Doch bevor es zum Verhaftungserfolg kommt, darf der bodenständige Beamte manch falsche Fährte verfolgen und ziemlich viel herbes Pilsener aus der lokalen Brauerei konsumieren.
Wer die traditionelle Spielart der literarischen Mördersuche mag und gelegentliche Umwege auf dem Weg zur Aufklärung nicht scheut, wird an diesem, erzählerisch wie sprachlich soliden, Exemplar der Gattung sein Vergnügen haben.
Rainer Küster: Schuldenspiele. Ein Kriminalroman aus dem Ruhrgebiet. 272 Seiten. Brockmeyer Verlag. Bochum 2015.€ 12,99.
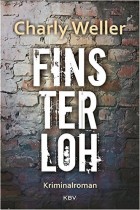 Ein dreckiges Stück Heimat
Ein dreckiges Stück Heimat
(AM) Es im Leben zu etwas gebracht hat man erst, wenn man bei Gref-Völsing auf der Hanauer Landstraße in Frankfurt mit Namen begrüßt wird, sinniert ein Polizist, der sich in dieser „höchstens 30 Quadratmeter großen Kathedrale urbaner Mittagsverköstigung mit verschärfter Rindswurstaffinität“ zum Austausch von Erkenntnissen mit Kollegen aus Gießen trifft. Mit dabei, Kommissar Roman Worstedt, hinter seinem Rücken „Kommissar Worschtfett“ gerufen, den wir samt seiner „manischen“ Wurzeln schon aus Charly Wellers Erstling „Eulenkopf“ kennen.
Retzlaff kann es sich nicht verkneifen, seinen Kollegen gegenüber einen Scherz über die „Metzgerei Mathias, Stiftstraße 78“ machen, was Gelegenheit gibt, zu Frankfurts interessantestem Mordfall zu schweifen, kaufte da das „Mädchen namens Rosemarie“ doch bevorzug frische Leber für ihren Pudel und wurde dort am Nachmittag des 29. Oktober 1957 zum letzten Mal lebend gesehen. Eines der Beweisstücke im Nitribitt-Fall spielt in Charly Wellers neuem Kriminalroman eine Rolle, nämlich jener auf der Garderobe der Edelprostituierten vorgefundene Herrenhut, der, wie sich herausstellte, dem stellvertretenden Frankfurter Polizeichef gehörte und dann in den Akten und den Asservaten spurlos verloren ging.
Überhaupt die Vergangenheit, sie ist allgegenwärtig in „Finsterloh“. Entweder werden die Protagonisten von ihr eingeholt oder sie werden darauf geschubst. Charly Weller hat den Bogen heraus, wie er all diese Seitenlinien miteinander verknüpft und die Exkurse nicht wie Belehrungen aussehen lässt oder zusammengestauchte Wikipedia-Artikel. Dass der Bruder des Ermordeten einst in der Fremdenlegion war, gibt Anlass zu einem heftigen Einstieg. Das ganze Buch hindurch entsteht nebenbei so etwas wie eine kleine Sittengeschichte der Legion. Weller erzählt zum Beispiel von einer perfiden Schinderei, bei der es galt – „Wir lassen niemanden zurück!“ -, einer Zigarettenkippe ein ehrenhaftes Begräbnis im harten Wüstenboden zu geben, das Loch mannsgroß und ordentlich tief. Ehe das nicht erledigt war, gab es keinen Schlaf. Wir erfahren, was es mit der „Blutwurst“-Hymne der Legionäre auf sich hat, warum – Stichwort Wüstensand – die Legionäre bei Militärparaden mit 88 statt der üblichen 110 Schritte per Minute marschieren und warum sie dabei Äxte und Lederschürzen tragen.
Der titelgebende Ort „Finsterloh“ ist ein heruntergekommenes Gelände am Stadtrand von Wetzlar, einst ein ehemaliges Sammellager für Juden, danach eine nahezu gesetzesfreie Zone für fahrendes Volk, Schausteller und Altwarenhändler, Kohlenausträger, Maronenbrater, Scheren- und Messerschleifer, Kesselflicker. Ein Stück dreckige Provinz. Wellers Kriminalromane sind Heimatkunde von unten. Da ist einer, der herumgekommen ist, nun in der Region seiner Geburt zurück und rollt sie lustvoll auf.
Charly Weller: Finsterloh. KBV, Hillersheim 2015. 322 Seiten. 9,95 Euro.