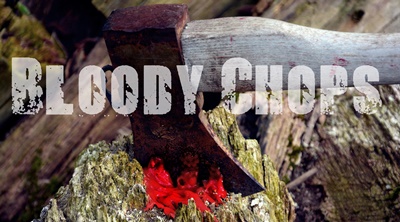Bloody Chops im Mai 2016
– Dieses Mal am Hackebeilchen: Joachim Feldmann (JF), Kasten Herrmann (KH), Alf Mayer (AM), Alexander Roth (AR) und Thomas Wörtche (TW). Sie widmen sich:
Graham Greene: Der Dritte Mann (JF), Joe R. Lansdale: Deadwood Dick (TW), Charles Willeford: Seitenhieb (AM), Olen Steinhauer: Der Anruf (TW), Christian Roux: Der Mann mit der Bombe (AR), Ulrich Ritzel: Nadjas Katze (JF), Joseph LeDoux: Angst (AM), Kamel Daoud: Der Fall Mersault (KH), Smith Henderson: Montana (AM), Tom Hillenbrand: Der Kaffeedieb (JF), Stefan B. Meyer: Kein großes Ding (AR), Jörg Maurer: Schwindelfrei ist nur der Tod (JF), Regina Nössler: Endlich daheim (AM), Martin Walker: Eskapaden. Der achte Fall für Bruno, Chef de police (JF), Paul Mendelson: Das Gute stirbt, das Böse lebt (AM), David Graeber: Bürokratie (AM), Eva Ehley: Sünder büßen. Ein Sylt-Krimi (JF), Gregg Hurwitz: Orphan X (AM). Viel Vergnügen.
 Subtil und vielschichtig
Subtil und vielschichtig
(JF) Klassikerlektüre kann gefährlich sein. Zumindest für professionelle Rezensenten. Leichtfertig nimmt man Balzacs „Verlorene Illusionen“ zur Hand, beginnt zu lesen und mag, hat man das Buch beendet, kaum noch einen Blick in all die Neuerscheinungen werfen, die der kritischen Begutachtung harren. Wer sich also in nächster Zeit unvoreingenommen aktueller Spannungsliteratur widmen will, sollte die Neuübersetzung von Graham Greenes Kriminalnovelle „Der dritte Mann“ meiden. Angesichts der erzählerischen Raffinesse dieses kleinen Meisterwerkes, das eigentlich nur als notwendige Vorarbeit zum Drehbuch für den bekannten Film dienen sollte, erscheinen selbst gelungenere Beispiele zeitgenössischer Genreprosa seltsam bemüht. Es sind gleich zwei unerhörte Ereignisse, die dem Leben des englischen Schriftstellers Rollo Martins, eine seltsame Wendung geben. Während der Umstand, dass man ihn, den Verfasser von Wildwestschmökern, für einen renommierten Autor hält, vor allem Anlass zu peinlich-komischen Situationen gibt, hat der scheinbare Tod seines Jugendfreundes Harry Lime, dessen Einladung ihn in das von den Alliierten besetzte Nachkriegswien geführt hat, existentielle Konsequenzen für den „fröhlichen Trottel“. Als einen solchen nämlich charakterisiert ihn der britische Offizier Galloway in einer Aktennotiz. Da hat er ihn allerdings gerade erst kennengelernt.
Greenes Kunstgriff, Galloway als auktorial agierende, aber dennoch fragwürdige Erzählinstanz einzusetzen, verhindert eine vorschnelle Identifikation mit dem Protagonisten, beraubt den Leser aber nicht seiner Empathie. „Ich habe die Affäre aus meinen Akten und aus dem, was Martins mir erzählt hat, so gut es ging, rekonstruiert“, heißt es im ersten Kapitel. So mag man seine Rolle auch als ironischen Kommentar zur „Bewusstseinsstromtechnik“ und anderen avancierten narrativen Verfahren lesen. Rollo Martins verehrt den Westernautor Zane Grey, von James Joyce oder Virginia Woolf scheint er noch nie gehört zu haben. Und wenn, dann würde es ihn nicht interessieren. Er lese „keine Romane“, teilt er einem Journalisten mit, als er zum ersten Mal für jenen berühmten Schriftsteller mit dem „subtilen, vielschichtigen, schweifenden Stil“ gehalten wird.
Graham Greene erzählt subtil und vielschichtig, aber zum Glück nicht „schweifend“. Ob das, was hier berichtet wird, tatsächlich „düster, traurig und ohne Lichtblick“ ist, wie Galloway meint, darf man nach der Lektüre selbst beurteilen. Schließlich verschwindet Rollo Martin, dieser „wie ein Parcival durch das Geschehen“ (Hanns Zischler) irrende Antiheld nicht allein aus unserem Blickfeld. Doch das ist eine andere Geschichte.
Graham Greene: Der dritte Mann. Roman. Aus dem Englischen von Nikolaus Stingl. Mit einem Nachwort von Hanns Zischler. Zsolnay Verlag, Wien2016. 139 Seiten, 18,90 Euro.
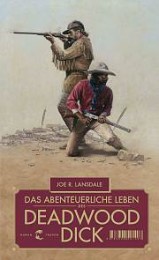 Wie Mythen gemacht werden
Wie Mythen gemacht werden
(TW) Vom Großmeister der Genre-Hybride, Joe R. Lansdale, gibt es neues Epos. Deadwood Dick (ja, genau, dieses Deadwood, das wir aus der genialen, unvollendeten HBO-Serie mit dem dito genialen Ian McShane kennen, ein paar Figuren wie Wild Bill Hickok, Charlie Utter und Al Swearengen begegnen uns auch hier) war eine historische Person namens Nat Love. Ein schwarzer Scharfschütze und Cowboy, der zu den mythischen Gestalten des Wilden Westens gehört.
Endgültig berühmt wurde der historische Nat Love durch seine Autobiographie mit dem unwahrscheinlichen Titel “Life and Adventures of Nat Love, Better Known in the Cattle Country as „Deadwood Dick,“ by Himself; a True History of Slavery Days, Life on the Great Cattle Ranges and on the Plains of the „Wild and Woolly“ West, Based on Facts, and Personal Experiences of the Author”. Lansdale setzt dagegen ein alternatives Narrativ mit dem bewusst lakonischen Titel „Paradise Sky“, das von Loves Suche nach einem Mörder und Vergewaltiger getrieben wird.
Lansdale übernimmt das Erzähler-Ich der Autobiographie, bricht es ironisch durch einen „naiven“, unheroischen Erzähl-Gestus – brillant von Conny Lösch übersetzt -, und zieht auch noch eine dritte biographische Ebene ein: Deadwood Dick ist der, allerdings weiß-gewaschene, Held von Westernheftchen, die sein Kollege Bronco Bob auf den Markt wirft. Insofern ist Deadwood Dick ein Roman über die Entstehung von populären Mythen, in denen sich Fakten und Fiktionen untrennbar verwischen. Das funktioniert prächtig, weil die Story so stark ist, sich über diesen Subtext, hinwegzusetzen. Deadwood Dick ist ein teilweise grausames, teilweise sehr komisches, teilweise tragisches Buch voller action und suspense. Lansdale, nach seinen etwas retardierenden coming-of-age-Romanen aus dem Sabine River-Universum, endlich mal wieder in Hochform.
Joe R. Lansdale: Das abenteuerliche Leben von Deadwood Dick („Paradise Sky“, 2015). Roman. Dt von Conny Lösch. Stuttgart: Tropen 2106, 473 Seiten, € 24,95
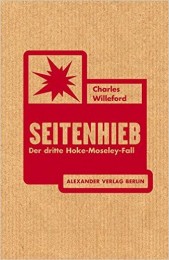 Hunde vergiften im Park
Hunde vergiften im Park
(AM) Vor ziemlich genau einem Jahr galt unser Klassiker-Check – wie der für Ambler in dieser CrimeMag-Ausgabe – dem großen Charles Willeford (CM-Artikel hier, hier, hier, hier und hier). Anlass war die Neuausgabe von „Miami Blues“ im Alexander Verlag Berlin, wo man sich auch verdienstvoll um Ross Thomas kümmert. Nun liegt bereits Band Drei des Miami-Quartetts vor, wieder ist es ein Fest, Willefords herrlich schwarzem Humor zu begegnen. 67 war er, als „Seitenhieb“ erschein, es ist der wohl extremste der vier Romane mit dem Polizisten Hoke Moseley. Und er hat – was bei Willeford etwas heißen will – den nettesten all seiner Psychopathen. Troy Louden, blaue Augen wie Paul Newman, weiß: „Ich bin ein krimineller Psychopath; deshalb bin nicht verantwortlich für das, was ich tue… Ich kenne den Unterschied zwischen gut und böse, aber er spielt keine Rolle für mich… Ich kann auch anders, aber es ist mir scheißegal.“
Das Buch beginnt mit einem Schock. Hoke, der sich die Wohnung mit seinen beiden Töchtern im Teenageralter und seiner hochschwangeren Kollegin Elitta Sanchez teilen muss, sitzt eines Morgens regungslos in seinem Sessel, rührt sich nicht, hat in seine Shorts uriniert. Seine Augen sind offen, er starrt die Wand an, sieht sie aber im Grunde nicht. Sein Vorgesetzter Bill Henderson hat so etwas schon in Vietnam mehr als einmal gesehen – „Kriegsmüdigkeit“. Wenn der Verstand einfach abschaltet. „Wir schickten sie ins Lazarett, wickelten sie drei Tage lang in feuchte Tücher, ließen sie schlafen, und wenn sie aufwachten, waren sie wieder okay. Sie waren voll einsatzfähig, als wäre nichts passiert.“
Hoke erhält 30 Tage Urlaub, landet bei seinem Vater auf Singer Island, kommt allmählich auf die Beine, versucht sich als Hausmeister. Der zweite Handlungsstrang folgt dem simpel gestrickten Pensionär Stanley Sienkiewicz. Stanley vergiftet Hunde. Wegen einer komischen Sache landet er für eine Nacht im Gefängnis und in den Fängen von Troy Louden. Erst auf den letzten 40 Seiten verschränken sich die Fäden, dies bei einem blutigen „Supermassaker im Supermarkt“, bei dem Elitta schwer verletzt wird, aber einen gesunden Jungen entbindet.
Ich entsinne mich heute noch an die erste Lektüre von „Seitenhieb“, und wie mir die Spucke wegblieb angesichts der Coolness und Lakonie, mit der Willeford über die Absurditäten des Lebens schreibt.
Charles Willeford: Seitenhieb (Sideswipe, 1987). Deutsch von Rainer Schmidt. Mit einem Vorwort von Elmore Leonard und einem Nachwort von Jochen Stremel. Alexander Verlag, Berlin 2016. 352 Seiten, 14,90 Euro. Verlagsinformationen zu Buch und Autor.
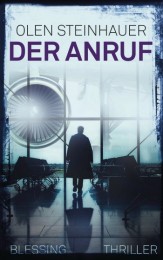
Kalbfleisch, final
(TW) Ein klassischer Spionageroman als Kammerspiel. Zwei Menschen treffen sich zum Abendessen in einem Restaurant und diskutieren, wer wohl der Maulwurf war, der eine Geiselbefreiungsaktion der CIA in Wien verraten hat, die zur Katastrophe wurde. Der Anruf heißt dieser kompakte Roman von Olen Steinhauer, denn wer einen einzigen Anruf gemacht hat, der einhundertzwanzig Menschenleben gekostet hat, das ist die zentrale Frage.
Eigentlich ist die Affäre schon erledigt und bei den Akten, aber ein paar beunruhigende Widersprüchlichkeiten sind übriggeblieben und sollen endgültig aufgeräumt werden. Deswegen wird Henry Pelham von der Wiener Station losgeschickt, um seine aus dem Dienst ausgeschiedene Ex-Geliebte Celia Favreau noch einmal auf Herz und Nieren zu vernehmen. In aller alter Freundschaft, in einem In-Restaurant in dem In-Städtchen Monterey in Kalifornien. Bei Red Snapper, Kalbsbrust und Chardonnay beginnt ein Rededuell über Liebe, Verrat, Loyalität und den human factor im eisigen Geheimdienstgeschäft. Die Weltgeschichte scheint beim intimen Tête à Tête zu einer Beziehungskiste zusammen zu schnurren.
Aber der Anschein ist lediglich ein wichtiger Faktor in den Rochaden um Leben und Tod. Die Suche nach dem Maulwurf, die den eigentlichen Kern des Spionageromans ausmacht, ist normalerweise eine epische Veranstaltung, aber Olen Steinhauers verdichtende Étude gibt dem topischen Thema einen neuen Reiz. „Liebe kann tödlich sein“, heißt es einmal bei seinem Kollegen James Grady. Wie giftig, wird sich am Ende erweisen, nachdem sich unser Paar nach aller Kunst der Manipulation und unter Einsatz sämtlicher Psychotricks einer Zimmerschlacht beharkt und ineinander verbissen hat. Da sitzt jedes Wort, jedes Detail, jede Nuance. Das ist die Hohe Kunst der Reduktion, Komplexität auf engstem Raum. Und ziemlich gemein.
Olen Steinhauer: Der Anruf. (All the old knives, 2015). Roman. Dt von Friedrich Mader. München: Blessing 2016, 270 Seiten, € 19,99
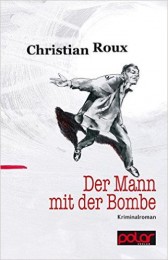 Befreiungsschlag mit Kollateralschäden
Befreiungsschlag mit Kollateralschäden
(AR) Larry hat seine große Liebe verloren und versucht seit Jahren, sich mit Job, Frau und Kind davon abzulenken. Als er in die Arbeitslosigkeit abrutscht und seine neue Familie es nicht mehr mit ihm aushält, marschiert er mit einer selbstgebastelte Bombenattrappe zum Vorstellungsgespräch und geigt seinen Vorgesetzten in spe mal so richtig die Meinung. Danach überschlagen sich die Ereignisse: Larry testet die Wirkung seines neuen Spielzeug in der nächstbesten Bank, die aber genau zu diesem Zeitpunkt von Lu und ihrer Bande überfallen wird. Er nimmt die junge Frau aus Mangel an Alternativen als Geisel, sackt die Kohle ein und verschwindet mit ihr im Fluchtwagen Richtung Horizont.
Dieses schmale Büchlein erzählt die Geschichte eines Mannes, dessen innerer Kompass zum Rotorblatt wird. Der von den Mechanismen eines erbarmungslosen Marktes in die Ecke gedrängt und von seinen Gefühlen erdrückt wird, der versucht, sich mit einer Verzweiflungstat von materieller und emotionaler Armut zu befreien. Es erzählt aber auch von einer Frau, die nie eine Chance auf Normalität hatte, die ihr unstetes Leben bereitwillig gegen ein Spießerdasein eintauschen würde, die sich nichts sehnlicher wünscht als das, was ihr Entführer wider Willen gerade in Begriff ist wegzuwerfen. Aber welcher Weg führt zum Glück?
„Der Mann mit der Bombe“ von Christian Roux provoziert seit Erscheinen Bonnie und Clyde Vergleiche – dabei erinnert sein duo infernale eher an das Filmpärchen Marianne Renoir und Ferdinand Griffon aus Godards „Elf Uhr nachts“. Denn das Buch ist weder sexuell aufgeladene Gewaltorgie, noch romantisch verklärter Outlaw-Mythos, sondern ein geradliniger, wenn auch träge Richtung Showdown taumelnder, melancholisch-verträumter, aber die soziale Realität entlarvender Noir französischer Schule. Und die Lektüre dieses Krimi-Konzentrats fühlt sich an wie der Moment, in dem Larry den Auslöser drückt: Wenn man bemerkt, dass der große Knall ausbleibt, ist im Kopf schon längst etwas explodiert.
Christian Roux: Der Mann mit der Bombe. Aus dem Französischen von Cornelia Wend. Mit einem Vorwort von Frank Göhre. Klappenbroschur. Polar Verlag, Hamburg 2016. 160 Seiten, 12,90 Euro.
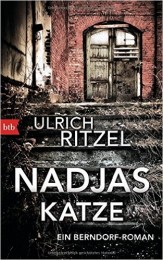 Historische Wahrheit erfahrbar machen
Historische Wahrheit erfahrbar machen
(JF) Eine Frau wendet sich an einen Privatdetektiv. Sie möchte herausfinden, wer ihre wirklichen Eltern sind. Der Ermittler, ein ehemaliger Kriminalbeamter, akzeptiert den Auftrag und verlangt zunächst noch nicht einmal ein Honorar. Dass er die Nachforschungen auch aus ganz persönlichem Interesse übernimmt, verrät er seiner Klientin nicht. Doch schon bald hat sie einen Verdacht. Aber die Wahrheit macht die Sache nicht besser. Je erfolgversprechender sich die Recherche gestaltet, desto problematischer wird das Verhältnis zwischen dem Detektiv und seiner Auftraggeberin.
„Nadjas Katze“, Ulrich Ritzels achter Roman um den eigenwilligen Ermittler Hans Berndorf, variiert ein klassisches Handlungsmuster des Genres. Doch das Ergebnis ist alles andere als spannungsliterarische Durchschnittskost. Und das verdankt sich einer gleichermaßen subtilen wie diskreten Erzählweise. Ritzel nimmt seine Figuren ernst, gönnt ihnen ihre inneren Widersprüche und gelegentlich auch ein erratisches Verhalten. Wer die Berndorf-Reihe von Anfang an verfolgt hat, weiß um den Schuldkomplex des Ermittlers, der ihn auch in diesem Roman heimsucht und dazu bringt, etwas zu tun, was er selbst als „dumm und ungehörig“ empfindet. Und man ist geneigt, ihm beizupflichten, würde sich nicht später herausstellen, dass er instinktiv richtig gehandelt hat. Hier zeigt sich, was ein auktorialer Erzähler, der auf Allwissenheit verzichtet und seine Protagonisten respektiert, zu leisten im Stande ist. Zum Beispiel, dass sich eine Hauptfigur, in diesem Fall Berndorfs Auftraggeberin, die pensionierte Gymnasiallehrerin Nadja Schwertfeger, hartnäckig weigern darf, als Sympathieträgerin aufzutreten.
Berndorfs Ermittlungen gelten lange zurückliegenden Ereignissen kurz vor Ende des zweiten Weltkriegs, die aber bis in die Gegenwart nachwirken. Ein winziges Detail in einer Erzählung aus den letzten Kriegstagen ist es, das Nadja Schwertfeger veranlasst, die Suche nach ihrer Herkunft aufzunehmen. Dass sie am Ende Gewissheit hat, wird angedeutet. Schließlich ist Berndorf ein guter Detektiv. Auch in eigener Sache. Vieles, was die Nachforschungen außerdem zutage fördern, kann man auch in den zitierten Geschichtsbüchern, deren bibliografische Angaben sich einem kurzen Literaturverzeichnis hinten im Buch entnehmen lassen, nachlesen. Ulrich Ritzel, der mit seinem Helden wohl nicht nur das Geburtsjahr teilt, geht es darum, historische Wahrheit im fiktionalen Kontext erfahrbar zu machen. Und das ist ihm mit diesem großartigen Kriminalroman gelungen.
Ulrich Ritzel: Nadjas Katze. Ein Berndorf-Roman. btb Verlag, München 2016. 441 Seiten, 19,99 Euro.
 Wenn Frodo das Haus verlässt …
Wenn Frodo das Haus verlässt …
(AM) Das Verlagshaus Ecowin gehört zum Red Bull Media House. Leute mit viel Angst sind in den Extremsportfilmen der Marke fehl am Platze; den fulminant gedrehten und geschnittenen Film „One Hell of a Ride“ über die weltheftigste Schussfahrtpiste, „die Streif“ in Kitzbühl, werde ich so schnell nicht vergessen. Er sparte auch die Verletzungsgefahren des Skisports nicht aus, das hat mir imponiert.
Nun also „Angst“. Ein 632-Seiten-Werk, weithin verständlich geschrieben, aber den Bemühungen der Wissenschaften um Differenzierung nicht aus dem Wege gehend, mehr Lehrbuch als Populärpsychologie. Joseph LeDoux, angesehener Hirnforscher und Professor an der New York University, Leiter des Instituts für Neurowissenschaften und mit „Das Netz der Persönlichkeit“ (Synaptic Self) und „Das Netz der Gefühle“ (The Emotional Brain) internationaler Bestsellerautor, schreibt anschaulich, hat zudem Vieles in Grafiken und Zeichnungen umsetzen lassen – man würde sich das als Laie für manch anderes Thema so wünschen. Angelsächsische Schule eben.
LeDoux zeigt, wie Angst und wie unser Gehirn funktioniert, warum Angst entsteht und was ihre nützliche Seite ist, zitiert dazu auch aus der Popkultur, etwa Alfred E. Neumans Auftritt von 1956 auf dem Titel von „Mad“ („What? Me worry?“), Woody Allen in „Der Stadtneurotiker“ oder Hitchcocks „Vertigo“. Das englische „anxiety“ deutet auf die Verbindung von Angst und Furcht. Das altgriechische „angh“ umschließt körperliche Empfindung wie Enge, Einschränkung oder Unbehagen, auch die „Angina“ mit dem Schmerzempfinden in der Brust hat diese sprachliche Wurzel.
Schöne Zitate quer durch die Geistes- und Literaturgeschichte sind den Kapiteln vorangestellt. „Wer fürchtet, dass er leiden wird, erleidet schon, was er fürchtet“, wusste Michel de Montaigne. Emily Dickinson meinte: „Zu wissen, dass es bevorsteht, ist schwerer als zu wissen, dass es da ist.“ Gehirnmechanismen, Furchtkonditionierung, Abwehr im Dienste des Überlebens, Kierkegaard formulierte. „Wer durch die Angst gebildet wird, der wird durch die Möglichkeit gebildet.“
Wer Kriminalromane liest, trainiert klar seine Angstlustkapazitäten. Schon J.R.R. Tolkien warnte: „Es ist eine gefährliche Sache, Frodo, aus deiner Tür hinauszugehen.“
LeDoux ist Sänger, Songwriter und Gitarrist der Band „Amygdaloids“, benannt nach der Amygdala, dem Mandelkern des Gehirns, wo die Angst ihren Sitz hat. Ihr neues Album „Anxious“ wurde zeitgleich mit diesem Buch veröffentlicht.
Joseph LeDoux: Angst. Was im Gehirn passiert, wenn wir uns fürchten (Anxious: Using the Brain to Understand and Treat Fear Anxiety, 2015). Aus dem Amerikanischen von Sebastian Vogel. Ecowin Verlag, Salzburg 2016. 632 Seiten, 26 Euro.
 Gelungener Perspektivwechsel
Gelungener Perspektivwechsel
(KH) In seinem weltberühmten Roman „Der Fremde“ erzählt Albert Camus von dem fast beiläufigen Mord seines absurden Helden Mersault an einem namenlosen Araber im Jahr 1942, dem Jahr, in dem auch dieses wichtige Buch der Moderne erschien. Jahrzehnte später liefert der Algerier Kamel Daoud nun eine „Gegendarstellung“ zum Fall Mersault und gibt dem Opfer einen Namen und eine Geschichte.
Erzählt wird diese Geschichte siebzig Jahre später in einer Bar in Oran vom jüngeren Bruder des Opfers – in Zwiesprache mit dem ebenso bewunderten wie gehassten Autor Camus und dem gleichgesetzten Mörder Mersault sowie mit unbenannten weiteren Gästen. Es ist eine Geschichte voller Trauer und Verzweiflung, denn zeitlebens litt er unter dem Mord an seinem Bruder, wurde gleichsam mit getötet, weil die Mutter nur noch für den Toten lebte: „Der Versuch, das Verbrechen an den Orten, an denen es begangen wurde, zu rekonstruieren, führte in eine Sackgasse, zu einem Gespenst, zum Wahn.“ Es ist aber auch eine Geschichte voller Wut, weil der Mörder Mersault weltberühmt wurde und der Tote in der Anonymität verschwand.
So hören wir nun von Moussa, dem Erstgeborenen und großen Vorbild, der in einer „Zeit der Epidemien und Hungersnöte“ schnell die Rolle des früh verschwundenen Vaters übernimmt und die Familie als Tagelöhner durchbringt – bis er an einem heißen Sommertag am Strand Mersault begegnet. Der bei Camus so motivlose Mord bekommt hier einen Kontext, und es wird spekuliert, ob es sich vielleicht nicht doch um eine aus dem Ruder gelaufene Abrechnung um ein Mädchen handelte.
Geschickt bettet Kamel Daoud den Mordfall in Algeriens Unabhängigkeitskrieg von der Kolonialmacht Frankreich in den Jahren 1954 bis 1962 ein. Lange hatten die Algerier sich mit der Präsenz der „Roumis“, der Fremden im eigenen Land abgefunden „und warteten mit dem Rücken zur Wand“. Als die Roumis aus dem Land fliehen, kommt es zu einem weiteren Mord, einer „Restitution“, wie der Erzähler präzisiert.
So gleicht dieser Roman einer Urgeschichte, der „Geschichte von Kain und Abel, nur am Ende der Welt“. Er liefert eine philosophische Reflexion über den Mord – der einzigen Frage, „die ein Philosoph sich stellen muss“ -, über Rache und Vergebung und das abgrundtief Absurde des Lebens.
„Der Fall Mersault“ ist aber auch eine Geschichte über die Sprachermächtigung des Erzählers, der sich die ihn wie ein Rätsel faszinierende französische Sprache aneignete, sie zum „Mittel einer pedantischen und manischen Untersuchung“ macht und sich so eine individuelle und geschichtliche Interpretationshoheit erobert. Albert Camus‘ Roman „Der Fremde“ hat so einen späten Zwillingsbruder bekommen, der ihm in literarisch-philosophischer Hinsicht in nichts nachsteht und eine ganz neue Perspektive eröffnet.
Kamel Daoud: Der Fall Mersault. Eine Gegendarstellung. Aus dem Französischen von Claus Josten. KiWi, Köln 2016. 200 Seiten, 17,99 Euro.
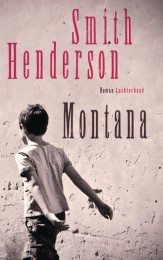 Das Zeug zum Klassiker
Das Zeug zum Klassiker
(AM) Mit den Orten der Weltliteratur ist das so eine Sache. Längst nicht jeder Roman vermag seinem Realschauplatz gerecht zu werden oder einen fiktiven derart zu evozieren, dass er sich uns einbrennt. Tenmile in hintersten Montana, am Zusammenfluss des realen Kootenay River und des fiktiven Deerwater Creek, hat das Zeug dazu. Wer dort lebt, kommt nicht mehr weg. Ein paar hundert Holz- und Minenarbeiter kratzen hier in den kläglichen Überresten des amerikanischen Traums ein erbärmliches Leben zusammen.
Vom ökonomischen Untergang ist es nicht weit zu Beschwörungen biblischer Apokalypse. „Regierung“ ist ein fernes und böses Wort. Wir sind in den 1980er Jahren, dem Anfang der Reagan-Zeit, der ja angeblich Amerika wieder zur Blüte brachte. Pustekuchen. Die Welt von Tenmile erzählt etwas ganz anderes. Autor Smith Henderson lässt sie uns mit den Augen des Sozialarbeiters Pete Snow sehen, sein Gegenpol ist der „Survivalist“ und „Abtauch-Champion“ Jeremiah Pearl, dazwischen dessen elfjähriger Sohn Benjamin. Ein Sozialarbeiter als Hauptfigur eines Romans? Gähn? Nein, es funktioniert. Und wie!
Smith Henderson, der gut zehn Jahre an diesem Buch saß, gelingt in seinem Erstlingsroman ein Erzählgestus, der so genau und „down to earth“, so verhalten und gleichzeitig selbstsicher daherkommt, als müsse diese Geschichte unbedingt erzählt werden. Und zwar genau so. Ein großes Buch. Schon das Einstiegskapitel macht das klar. Die restlichen 580 Seiten halten das Versprechen. Sie erzählen – in drei Strängen raffiniert choreografiert – von Amerikas dunklen Träumen, von Hoffnungen und Sackgassen, Armut und Paranoia.
Smith Henderson kommt wie Salman Rushdie oder Peter Carey aus der Werbetexterbranche, hat für Erzählungen etliche Preise gewonnen, etwa den Pushcart Prize oder einen PEN Emerging Writers. „Montana“ zählte nicht nur für die „Washington Post“ zu den zehn besten Büchern des Jahres 2014. Weil das gerade auch als Spannungsroman überragend funktioniert, gab es 2015 den „New Blood“ Dagger der Crime Writers Association.
Smith Henderson: Montana (Fourth of July Creek, 2014). Aus dem Amerikanischen von Walter Ahlers und Sabine Roth. Luchterhand Verlag, München 2016. 608 Seiten, 24,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch. Internetseite des Autors.
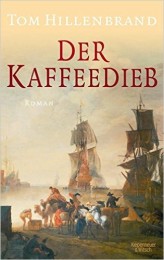 Ein Schmöker im besten Sinne
Ein Schmöker im besten Sinne
(JF) Ob die Kaffeepflanze schon 1658 oder erst 1690 von Arabien in das damalige Niederländisch-Indien gelangte, ist umstritten. Tom Hillenbrand jedenfalls, bislang als Autor gutverkaufter und preisgekrönter Kriminalromane bekannt, hat sich für das spätere Datum entschieden. Sein spektakulärer Abenteuerroman „Der Kaffeedieb“ erzählt die (fiktive) Geschichte des jungen Engländers Obediah Chalon, der sich im Auftrag der Vereinigten Ostindischen Compagnie aufmacht, den Osmanen das eifersüchtig bewachte Gewächs zu entwenden und nach Europa zu transportieren. Wehren kann er sich nicht gegen diese gefährliche Mission, der geniale Fälscher, Spekulant und Freigeist ist nach einer gescheiterten Börsenmanipulation erpressbar geworden. Also macht sich Chalon zusammen mit einem Team von Spezialisten auf den Weg ins Morgenland. Den benötigten „Meisterdieb“ können sie allerdings erst unterwegs rekrutieren. Es handelt sich den Comte de Vermandois, einen illegitimen Sohn Ludwigs XIV, der in einer Festung gefangen gehalten wird.
Während der historische Louis de Bourbon bereits 1683 verstarb, ist sein literarischer Wiedergänger ein quicklebendiger Tausendsassa, dem nur bedingt zu trauen ist. Zudem sorgt die „Entführung“ eines, wenn auch in Ungnade gefallenen, Mitglieds der französischen Königsfamilie für diplomatischen Wirbel, und Obediah Chalon gilt einmal mehr als Kopf einer europaweiten Verschwörung. Wie die Expedition allen Widrigkeiten zum Trotz an ihre Ziel gelangt, um letztendlich doch zu scheitern, wird auf raffinierte Weise erzählt. Hillenbrand beherrscht sein Handwerk und sichert sich die Aufmerksamkeit des Lesers durch unvermutete Perspektivwechsel, eingestreute „Briefdokumente“ und gelegentliche Zeitsprünge. Auf eine übertriebene Historisierung der Sprache wird glücklicherweise verzichtet.
Allerdings schleichen sich in den angenehm kultivierten Erzählton ab und an umgangssprachliche Wendungen ein, die besonders dann auffallen, wenn sie sich (wie das Verb „aufrappeln“) innerhalb von drei Zeilen wiederholen. Doch das sind lässliche Sünden angesichts der furiosen Handlung und des liebevoll ausgestalteten Zeitkolorits. Außerdem gönnt der Autor seinem Helden ein geschickt eingefädeltes Happy End. Was kann man von einem Schmöker im besten Sinne mehr verlangen?
Tom Hillenbrand: Der Kaffeedieb. Roman. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2016. 470 Seiten, 19,99 Euro.
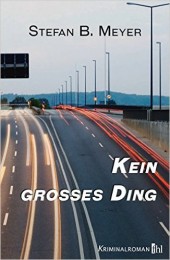 Aufschwung Ost
Aufschwung Ost
(AR) Stefan B. Meyer war mal Baumonteur. Das merkt man. Getreu dem Motto „write what you know“ geht es in seinem Debüt, das letztes Jahr vom Leipziger fhl-Verlag neu aufgelegt wurde, um einen gelernten Architekten, der sich auf „Ermittlungen am Bau“ spezialisiert hat, und der für einen Bauunternehmer aus Süddeutschland einen Bauleiter aus Dresden beschatten soll. Rauputz-Detektiv Hans Staiger macht sich auf, das boomende Bauwesen der sächsischen Landeshauptstadt zu ergründen, und stößt, Sie ahnen es, auf jede Menge Korruption. Bald schon tritt er den falschen Leuten auf die Füße – und stolpert kurzerhand über eine Leiche.
Selbst wenn der Protagonist sich gerade mal fünf Minuten nicht mit Gebäuden und deren Entstehung beschäftigt, bleiben Sätze „im Raum stehen wie einen Kubikmeter Granit“, oder es schießt von irgendwoher ein Blick heran, „mit dem man Stahlplatten hätte verschweißen können.“ Trotzdem muss man nicht unbedingt leidenschaftlicher Heimwerker sein, um diesen Krimi zu mögen. Im Kern handelt es sich bei „Kein grosses Ding“ nämlich um eine, wie der Autor es selbst treffend beschreibt, „straighte Detektivgeschichte“. Wir haben den reichen Auftraggeber, die femme fatale, den rauchenden Ermittler und ein Indiz, das nie aus der Mode zu kommen scheint: Den Namen einer Kneipe auf einer Streichholzschachtel.
Jetzt kommen aber zwei Dinge hinzu, die das Buch vom private eye Einheitsbrei abheben. Erstens: Der Humor. Die Streichholzschachtel gehört zum Beispiel einem gewissen Oskar Wild (!), und die Kneipe, aus der sie kommt, hört auf den Namen „Shakes’n’Beer“ (!!). Zweitens: Dieser Stefan B. Meyer schreibt so lebendig über die sommerliche Stadt, über Bierbänke am Elbufer und die gute alte Eckkneipe, dass man das Gefühl hat, während der Lektüre sowohl leicht braun, als auch ordentlich besoffen zu werden. Das mag zu wenig sein für den ganz großen Wurf – aber manchmal will man ja auch einfach nur gut unterhalten werden.
Stefan B. Meyer: Kein grosses Ding. Kriminalroman. Klappenbroschur. fhl Verlag, Leipzig 2015. 274 Seiten, 13 Euro.
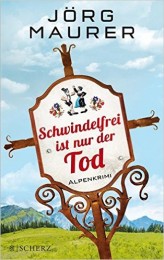 Der Mann mit der Kombizange
Der Mann mit der Kombizange
(JF) Ich hätte es wissen müssen: Natürlich gibt es neben Bretagne- und Provence- auch längst Normandie-Krimis. Sie tragen Titel wie „Kein Tag für Jakobsmuscheln“ oder „Der Kommissar und der Orden vom Mont-Saint-Michel. Schade. Noch eben dachte ich, hier sei eine Marktlücke zu füllen. Und den richtigen Autor meinte ich auch schon gefunden zu haben. Anlass waren diese wunderbaren Sätze: „‘Oh, là, là‘, sagt Kommissar Delacroix, kippte den Pastis in einem Zug hinunter und blickte hinaus aufs Meer. Die Brandung donnerte gegen die Steilküste der Normandie an, seine Assistentin Madeleine Dujardin trippelte ins Zimmer.“ Da möchte man doch sofort wissen, wie es weitergeht.
Leider folgt auf diesen fulminanten Einstieg nur eine Büroszene von anderthalb Seiten. Und die findet sich in einem Roman, dessen Umschlag- und Titelgestaltung eher abschreckend wirken. Es handelt sich um einen so genannten „Alpenkrimi“, ein Genre, das sich wahrscheinlich dieselben Marketingexperten ausgedacht haben, die uns seit Neuestem mit französelnden Provinzermittlern beglücken. Doch der Eindruck täuscht. Jörg Maurers neuer Fall für Kommissar Hubertus Jennerwein ist ein ausgefuchstes, lehrreiches und hochkomisches Stück Erzählprosa, das seinesgleichen sucht. Wer nun wissen will, warum eine Spur tatsächlich bis in die Normandie zu Kommissar Delacroix und der bezaubernden Mademoiselle Dujardin führt, muss es selbst lesen. Das Stichwort lautet: „Kombizange“.
Jörg Maurer: Schwindelfrei ist nur der Tod. Alpenkrimi. Scherz Verlag, München 2016. 422 Seiten, 14,99 Euro.
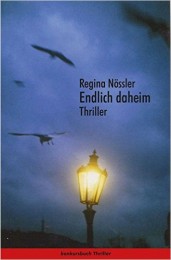
Wenn die Welt Risse bekommt
(AM) Kim lebt in einer Art Parallelwelt, oft nimmt sie Dinge wahr, die den anderen verborgen bleiben – so wie den Fuchs, der über den Schulhof läuft, und mit dem alles beginnt. Regina Nössler, die bereits mit „Wanderurlaub“ oder „Auf engstem Raum“ glänzte, versteht es – ja, doch, ich schreibe das Wort – meisterlich, mit kleinen Mitteln und ohne großes Tamtam einen Sog zu erzeugen, der gefangen nimmt. Ihre Welt ist die ganz alltägliche. Schrecken und Suspense liegt in den feinen Rissen, die sich auftun. „Endlich daheim“, dessen Kapitel im Minutentakt vorrücken, beschreibt innerhalb von 25 Stunden und mit überschaubarem Personal den Heimweg ebenjener Kim von ihrer Schule am Tag vor ihrem 14. Geburtstag. „25.63 Uhr“ ist es da plötzlich auf der elektronischen Anzeige über dem U-Bahneingang, die Farbe verschwindet aus Menschen und Häusern, es wird monochrom, trostlos und grau wie im Sozialismus, der lange vor Kims Geburt gestorben war. Ein Ampelmast bricht durch, liegt auf der Straße. Der Schlüssel zu ihrer Wohnung passt nicht mehr, auf Briefkasten und Klingelschildern sind all die vertrauten Namen verschwunden. Im Haus geirrt? Nein. Dreimal nein. „In meinem Kopf ist zu viel. Oder zu wenig. Oder alles durcheinander“, ruft Kim sich zur Ordnung.
Haarscharf an den Parallelwelten der Phantastik vorbei, ganz hier und jetzt im heutigen Berlin, evoziert Regina Nössler einen ziemlich ver-rückten Schwebezustand. 14. November, 11.30 Uhr, ist es zu Beginn, um 14.02 Uhr sind wir auf Seite 73, auf 187 bei 22.35 Uhr. „Ein Kind sagt, sein Haus sei verschwunden“, das in der Nostitzstraße in Kreuzberg, schmunzeln sie bei der Polizei. Kim kommt für die Nacht bei Alex unter, ihre Tante Felicitas weicht nachts mit dem Fahrrad einem Fuchs aus. Immer mehr glaubt Kim, dass sie nicht mehr bei Verstand sei. Aber es ist ein wirkliches Verbrechen geschehen. Die Auflösung ist logisch. Auch der Fuchs taucht noch einmal auf. Und dann gibt es Bratkartoffeln. Daheim. Endlich daheim.
Regina Nössler: Endlich daheim. Thriller. Konkursbuch Verlag Claudia Gehrke, Tübingen 2015. 316 Seiten, 10,90 Euro.
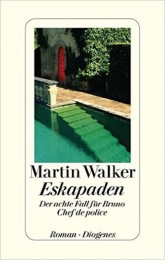 Gehobene Reiseführerprosa
Gehobene Reiseführerprosa
(JF) Niemand scheint wirklich überrascht, als ein ehemaliger Offizier der französischen Luftwaffe nach einer Feier tot in seinem Erbrochenen gefunden wird, schließlich war er schon lange als unmäßiger Trinker bekannt. Dem Chef der örtlichen Polizei allerdings, der ebenfalls bei dem Fest zugegen war, fallen bald einige Ungereimtheiten auf. Dummerweise ist der Leichnam bereits eingeäschert, bevor die Ermittlungen beginnen können. Die Aufklärung des Falles gestaltet sich also ziemlich schwierig, zumal in der Vergangenheit des Gastgebers, eines hochdekorierten Kriegshelden, gegraben werden muss.
Es ist ein immer wieder gerne variierter Krimi-Plot, den der britische Autor Martin Walker im achten Band seiner international erfolgreichen Reihe um Bruno, den Chef de police der fiktiven Kleinstadt Saint Denis im Périgord, angenehm routiniert zu Besten gibt. Dass er dafür beinahe 400 Seiten braucht, könnte man dem getrübten Gedächtnis seines Ermittlers zuschreiben. Dieser trifft zu Anfang des Romans auf einen zwielichtigen, ihm offenbar unbekannten Wildhüter, den er, wie auf Seite 253 mitgeteilt wird, „schon häufig Rugby“ hat spielen sehen. Glücklicherweise ist Brunos Geistesgegenwart unbeeinträchtigt, als ihm der üble Bursche nur wenig später ans Leben will.
Allein, diese Theorie ist falsch. Martin Walker hält sein Lesepublikum nicht bei Laune, indem er es an langwierigen Ermittlungsarbeiten teilhaben lässt. Ihm geht es darum, „einem Lebensstil, der geprägt ist von den herrlichen Gerichten und Weinen der Region, von Rugby und von der Jagd, von Markttagen und Festlichkeiten“ (Nachwort des Autors) Ausdruck zu geben. So bleibt kein Wein ohne genaue Herkunftsangabe und keine Speise wird verzehrt, ohne deren Zubereitung zu erläutern. Das dauert. Und der gefällig-behäbige Erzählstil tut sein Übriges: „Obwohl ihm der Ort vertraut war, hielt Bruno vor dem Anwesen an und bewunderte Jack Crimsons Haus am anderen Ende der mit Kies bestreuten und auf beiden Seiten von Obstbäumen flankierten Zufahrt.“ Die Bewunderung des Vertrauten also: Ein menschliches Bedürfnis, das vielleicht auch die Popularität gehobener Reiseführerprosa dieser Art erklärt.
Martin Walker: Eskapaden: Der achte Fall für Bruno, Chef de Police (The Dying Season). Aus dem Englischen von Michael Windgassen. Diogenes Verlag, Zürich 2016. 400 Seiten, 24 Euro.
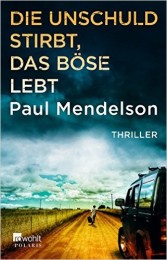 Poker und Bridge zum Training
Poker und Bridge zum Training
(AM) Diese willkommene Ergänzung zur Kriminalliteratur aus und über Südafrika ist bei uns leider trotz der guten Übersetzung von Jürgen Bürger relativ untergegangen. Der brave Titel „Die Unschuld stirbt, das Böse lebt“ mag dazu beigetragen haben, bei einem Originaltitel namens „The First Rule of Survival“ muss man auf so etwas erst einmal kommen. Paul Mendelson, ein Bridge- und Poker-Spieler mit einem Dutzend Bücher zum Thema (und nicht mit dem gleichnamigen TV- und Bühnenautor zu verwechseln), ist Brite mit Wohnung in Kapstadt, wo er sich einen Teil des Jahres aufhält. Freilich, um noch einmal die Etikettierung zu kritisieren, ist dieser Erstlingsroman nicht unbedingt ein Thriller, es ist ein packender Polizeiarbeitsroman – mit einem Twist am Ende, der möglicherweise nicht allen gefällt, aber keineswegs, noch einmal Rowohlt, „die Grenzen des Genres sprengt“. Bridge und Poker, sagt Mendelson, haben viel mit Kriminalliteratur zu tun: „Beide Spiele erfordern viele kleine Informationen, zusammengesetzt erbringen sie ein logisches Ergebnis, so wie das auch fundamental für eine spannenden Geschichte ist.“
Mendelsons Colonel Vaughn de Vries vom South African Police Service (SAPS) war bereits zur Zeit der Apartheid im Dienst. „Das neue Südafrika braucht manchmal die Polizei des alten Südafrika“, heißt es einmal. Natürlich ist das bröckelnder Grund, Mendelson macht guten Gebrauch von Allianzen, Altlasten, Intrigen, Karriere- und Politikinteressen, Klassen- und Rassengegensätzen. „Genießen Sie Ihren letzten Fall“, sagt der Zulu-Cop von der Dienstaufsicht. Der Fall, das sind zwei ermordete weiße Jungs, über Jahre missbraucht, mit einem dritten vielleicht noch am Leben, die Aufklärung von höherer Stelle aus massiv behindert. „Was wir auch wissen – es ist gar nichts. Es ist nur der Anfang“, gesteht sich de Vries auf Seite 271. Und 150 Seiten weiter dann das niederschmetternde Gefühl, das Beste gegeben, aber nicht genug erreicht zu haben. „Die Medien wollen einen Anfang, eine Mitte und ein Ende, das haben wir ihnen gegeben“, sagt sein Vorgesetzter. De Vries gibt sich damit nicht zufrieden, das Ende wird heftig.
Im Dezember 2016 folgt de Vries Nr. 2 mit „Die Straße ins Dunkel“.
Paul Mendelson: Die Unschuld stirbt, das Böse lebt (The First Rule of Survival, 2014). Deutsch von Jürgen Bürger. Rowohlt Polaris, Reinbek 2015. 480 Seiten. 14,99 Euro. Internetseite des Autors.

„Mr. Wambaugh wird sehr unglücklich sein …“
(AM) David Graeber, in vielen Feuilletons wegen der von ihm beförderten Occupy-Bewegung als Neo-Anarchist mit etwas spitzen Fingern angefasst, nimmt sich nach „Schulden“ mit „Bürokratie“ nun das nächste Monster vor. Eine linke Bürokratiekritik fehlt ihm schmerzlich; der Anthropologe Graeber sieht sein Buch jedoch nicht als einen Entwurf dafür, er hat keine zentrale These, sammelt Ansätze und Perspektiven, schreibt über Gewalt, Technologie, Rationalität und Werte, die Macht der Investoren, den Quartalsbericht als Henkersfallbeil, die Kultur der Komplizenschaft und über strukturelle Dummheit. Er formuliert als „das eherne Gesetz des Liberalismus: Jede Marktreform, jede Regierungsinitiative, die den Amtsschimmel bändigen und die Marktkräfte fördern will, resultiert in der Zunahme von Vorschriften, Verwaltungsarbeit und der vom Staat beschäftigten Bürokraten.“
Graeber wühlt sich durch die Ideengeschichte der „Utopie der Regeln“. Max Weber sah bürokratische Organisationsformen gewissermaßen als Verkörperung der Vernunft. Foucault äußerte sich zwar etwas subversiver, schrieb aber der bürokratischen Effizienz noch mehr, nicht weniger Macht als Weber zu. Dann folgt eine lange Passage, die uns Lesern der Kriminalliteratur hinter die Ohren geschrieben gehört – nämlich Distanz zur vorgeblichen Ordnungskraft der Polizei, wie sie uns tagtäglich von „Tatort“, „CIS“ und 200.000 anderen TV-Filmen sowie der literarischen Parallelwelt eingeimpft wird. Polizisten sind für Graeber „Bürokraten mit Waffen“. Nur ein kleiner Teil der Polizeiarbeit habe etwas damit zu tun, das Strafrecht durchzusetzen. „Die Polizei reguliert oder unterstützt großteils die Lösung administrativer Probleme, indem sie physische Gewalt anwendet oder androht.“ In der Populärkultur der vergangenen fünfzig Jahre ist, so Graeber, „die Polizei zu einem fast zwanghaften Objekt imaginativer Identifikation geworden“, mehrere Stunden am Tage sieht er die Bürger der modernen Industriegesellschaft mit den Heldensagen der Polizei verbringen.
Lange her, dass der Filmregisseur Robert Aldrich bei der Verfilmung von Wambaughs „Chorknaben“ (1975) zu Protokoll gab: „Ich denke, Mr. Wambaugh wird sehr unglücklich sein mit diesem Film. Seine Gefühle für die Probleme der Polizisten sind vermutlich ehrlich und echt, aber ich sehe das nicht auf die gleiche Art. Ich finde die Tatsache, dass Polizisten „nicht klarkommen“ nicht besonders produktiv. Ich weiß nicht, wie man Bedauern fühlen soll für einen Polizisten. Um es klar zu sagen, ich widerspreche Mr. Wambaugh sogar soweit, dass ich nicht glaube, dass Leute Polizisten wirklich mögen.“
David Graeber: Bürokratie. Die Utopie der Regeln (The Utopia of Rules. On Technology, Stupidity, and the Secret Joys of Bureaucracy, 2015). Aus dem Amerikanischen von Hans Freundl und Henning Dedekind. Klett-Cotta, Stuttgart 2016. 329 Seitem, 22,95 Euro.
 Außerdem wird ein Mörder gesucht
Außerdem wird ein Mörder gesucht
(JF) Alexander Bürgli reißt sich die Kleidung vom Leib, stopft sie in die Waschmaschine und stellt der Kochgang ein.
Alexander Bürgli hängt über der Toilettenschüssel und kotzt sich die Seele aus dem Leib.
Alexander Bürgli flucht verhalten.
Alexander Bürgli wirft noch einen Blick nach oben.
Alexander Bürgli gerät aus dem Gleichgewicht.
Alexander Bürgli beißt die Zähne zusammen.
Alexander Bürgli konzentriert sich.
Alexander Bürgli schaudert bei dem Gedanken.
Alexander Bürgli greift noch einmal zur Wasserflasche und füllt sein Glas.
Und das ist längst nicht alles, was Alexander Bürgli, der in Eva Ehleys sechstem „Sylt-Krimi“ mit dem hoffnungsfrohen Titel „Sünder büßen“ eine zentrale Rolle spielt, so treibt. Wer nach dieser Textmontage – die Sätze finden sich in anderer Reihenfolge auf den letzten 50 Seiten des Romans – neugierig geworden ist, sollte unbedingt das just erschienene Fischer-Taschenbuch erstehen, in dem außer Alexander Bürgli auch noch ein masochistisch veranlagter religiöser Fanatiker, ein Journalist, der schon bessere Tage gesehen hat, eine zickige, aber liebebedürftige Staatsanwältin und ein Ermittlertrio mit Privatleben auftauchen. Ach ja, außerdem wird ein Mörder gesucht. Lassen Sie sich überraschen. Und fiebern Sie mit, wenn Alexander Bürgli „triumphierend“ denkt: „Na endlich, wird auch langsam Zeit, dass ihr mir auf den Leim geht.“
Eva Ehley: Sünder büßen. Ein Sylt-Krimi. Fischer Verlag, Frankfurt 2016. 365 Seiten, 9,99 Euro.
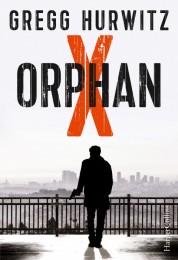 Das Zielfernrohr im Dim-Sum-Servierwagen und andere Waisenkinder der Logik
Das Zielfernrohr im Dim-Sum-Servierwagen und andere Waisenkinder der Logik
(AM) Die überdimensionierten Hüpfburgen, es gibt sie auch in Buchform. Was immer ihre Form und Farbe sein mag, sie sind im Prinzip auf die immergleiche Sprunghöhe ausgelegt, höher geht es da nicht, und ihre Füllung besteht naturgemäß (?) aus viel heißer Luft. Robert Crais, der – sorry to say – auch mal wieder frischere Luft für seine Plots gebrauchen könnte, hält den auf Serie angelegten „Orphan X“ für den besten Roman seit „Die Bourne Identität“. Sei’s drum.
Hier nun also Evan Smoak, wie Nikita und Hannah und manch andere vor ihm schon als Kind „von der Regierung“ zum tödlichen „Regierungsattentäter“ ausgebildet, Schmerz aushalten, Befehle ausführen, Akronyme wie LAPD, CLERS, NCIC, CODIS und anderes jonglieren und dann eines Tages als Killer überflüssig werden inklusive. Evan, der Nowhere Man, wahlweise Orphan X genannt. wohnt in L.A. auf 650 Quadratmetern, hat ein Hauptkonto in Luxemburg, tausend exklusive Sachen und eine Victorinox-Taschenuhr, schläft in einem Magnetschwebebett, das von Neodym-Seltenerdmagneten in der Luft gehalten wird, benutzt ein RoamZone-Handy und am liebsten „Gold Dot“-Hohlspitzgeschosse der Firma Speer.
Manchmal allerdings muss man befürchten, dass seine Reaktionszeit durch das warenfetischistische Benennen seiner Ausrüstung beeinträchtigt wird, etwa, wenn er sein Naval-Special-Warfare-Modell Marke Stride ziehen will (vulgo: Messer) oder schnell an sein High-Guard-Hüftholster aus Kydex muss. Freilich vermag er easy, seinen „Inselkortex zu steuern“ und so Schmerz zu unterdrücken, oder bei einem Restaurantbesuch rechtzeitig das Zielfernrohr eines Scharfschützen im dritten Stock gegenüber im Edelstahl eines gerade im an ihm vorbeigeschobenen Dim-Sum-Servierwagens zu erkennen. (Schöne Visualisierungsaufgabe für die Verfilmung, auch das mit dem zerplatzenden Aquarium voller gefesselter Hummer; Bradley Cooper steht angeblich für die Hauptrolle bereit.)
Wie alle guten (Waisenkind-)Attentäter ist Evan eigentlich ein anständiger Kerl, wie neulich auch der bei Chris Holm in „So was von tot“, was natürlich den Bösen in die Hände spielt, von denen eine besonders Böse als Gummi-Domina auftritt und gerne mit Flußsäure hantiert. Als Trick habe ich von Nowhere Man/Orphan X immerhin gelernt, dass der Sniper von Heute stets Mundschutz trägt, weil sonst ein Nasenabstrich die eingeatmeten Pulverrückstände verraten könnte, und dass der Griff eines Sendertrackers ein besonders fieses Versteck für einen Sender wäre. Immerhin gibt es ein Schlussduell am Schwert (ja am, nicht mit) und mit einer Schlägerei, die mit ihren Kampftechniken rund um den Erdball führt. Eröffnet wird „mit dem indonesischen Pencak Silat, in dem die offene Hand eingesetzt wird“.
Für den, der so etwas liebt, gibt es viele zitierte Regeln. Mir gefiel am besten eine aus der Pokerwelt: „Man spielt nicht das eigene Blatt, man spielt immer das Blatt des Gegners.“
Gregg Hurwitz: Orphan X. Aus dem Amerikanischen von Mirga Nekvedavicius. HarperCollins, Hamburg 2016. 432 Seiten, 19,90 Euro.