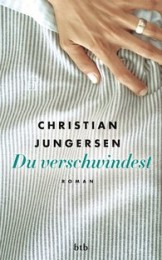 Muss Literatur glücklich machen?
Muss Literatur glücklich machen?
Weit mehr als ein Psychothriller, und doch was für einer. Alf Mayer über Christian Jungersen „Du verschwindest“.
Noch ein Ausnahme-Thriller aus dem Frühjahr 2014, den der Rezensionsbetrieb ebenso wenig wahrgenommen hat wie A.S.A. Harrisons „Die stille Frau“ (zur CM-Besprechung). Zufall, dass beide Spannungsromane eine weibliche Protagonistin als Fixpunkt haben? Ich selbst kenne das ja auch von mir: Wieder ein Frauenkrimi, muss das sein? Aber selbst wenn wir Männer uns alle wirklich verschworen hätten, es gibt ja doch eine Übermacht weiblichen Leser und wehrhafte Kritikerinnen. Dennoch, weithin Fehlanzeige für Rezensionen von „Du verschwindest“ des Dänen Christian Jungersen, am 12. Mai 2014 als btb-Hardcover erschienen. Und von wegen Frauenkrimi. Dieses Buch geht alle an.
„Du verschwindest“ wurde vom sorgfältigen Ulrich Sonnenberg übersetzt, gerühmt für seine Übertragungen von Hermann Bang und Hans Christian Andersen. Kein Fließbandroman, keine Reißbrettgeschichte, ganz bewusst aber das Genre des Psychothrillers, ganz bewusst eine straffe Erzählung über eine Fragmentierung, das Zerbröseln gleich mehrerer Personen – dazu im letzten Drittel des Romans eine Fundamentalkritik herkömmlichen Erzählens (siehe weiter unten). Christian Jungersen arbeitet langsam und skrupulös, acht Jahre liegen zwischen dem 2012 erschienenen „Du forsvinder“ und „Undtagelsen“, 2006 bei Piper als „Ausnahme“ erschienen und der Grund, warum ich mir „Du verschwindest“ besorgte. 667 Seiten waren das damals. Feinstes, genaues, verstörendes Psychodrama (auch dazu unten mehr).
 Extremrecherche
Extremrecherche
Von vier Fassungen weiß ich, die der asketische Workaholic Jungersen für „Du verschwindest“ verschliss, ehe er mit Form und Inhalt zufrieden war. Er hat ausgiebig recherchiert, exzessiv muss man es wohl nennen. Wegen einer kleinen Passage über Spieltheorie drei Tage mit einem wegen Spielsucht Verurteilten telefoniert, viel Zeit an Privatschulen verbracht, das Milieu aufgesogen, sich intensiv mit Lehrern, Wissenschaftlern, Gutachtern, Polizisten unterhalten und beschäftigt, bis in ihre Wohnungen, Gewohnheiten und ihr Privatleben hinein. Sein Anspruch ist die absolute Realitätstüchtigkeit der Erzählung, das bei einem Thema, bei dem es explizit um deren Verlust geht.
Zumindest in der wissenschaftlichen Welt gab es bisher nur Anerkennung, wie anschaulich, genau und differenziert er von den Auswirkungen dessen erzählt, was man als Gehirnschädigung zusammenfassen kann. Jungersen, der in New York, Kopenhagen und auf Malta lebt, ist auf dem neuesten Forschungsstand, hält uns aber keine Vorlesung. Seine Personen wirken ultra-real, er unterhält und erzählt in bester Manier. Dennoch gefror mir sein Buch manchmal in den Händen, geriet mein Innerstes in Aufruhr, wurde die Lektüre – für mich, in Kopf & Bauch – existenziell. „We are our brains.“
Unser Wissen und Fühlen von uns selbst bestimmt uns, macht uns aus. Was wäre wenn? Was wäre, wenn sich da etwas unmerklich verändert? Schon verändert hat? Verändern würde? „Die Welt ist wirklich unendlich. Man kann alles glauben und ebenso gut alles bezweifeln“, heißt es in Hanns Henny Jahnns großem Roman „Fluss ohne Ufer“ (der nächsten Februar neu herausgegeben bei Hoffman & Campe wiedererscheinen wird). Wie ein großer dunkler Wal schwimmt seit der Lektüre von „Du verschwindest“ diese Sache mit der Persönlichkeitsveränderung durch eine Krankheit oder einen Unfall in meinem Kopf. Die Redewendung, dass ein Buch unter die Haut gehen könne, muss für „Du verschwindest“ gesteigert werden: Es geht ins Cerebrum, trifft da, wo das Ich Ich ist. Und Ich sein will. „Du verschwindest“, das ist die Drohung der Selbstauflösung. Auslöschung. Die tieffahrende Erkenntnis der eigenen Verletzlichkeit, des doch dünnen Bodens dessen, was unser Leben ist. Dieses Buch ist existentielle Lektüre, weil es die sinnlichen, psychologischen, neurologischen und philosophischen Ebenen hochelegant durchdekliniert und Jungersens Kunst das alles miteinander verwebt, als wären es pulsende Nervenfäden.
 Abschüssige Fahrt in einen Albtraum
Abschüssige Fahrt in einen Albtraum
Beginnen tut es wie ein Actionfilm. Ein Familienausflug ins mallorquinische Gebirge wird zum Albtraum. Der Mann am Steuer rast wie wahnsinnig, völlig ungerührt von den Bitten und Schreien seiner Frau. Auf der Rückbank hält der 16jährige Sohn das für einen Spaß. Dann steht das Auto endlich, zerdeppert. Mia und Frederik streiten, er stürzt eine Böschung hinab, bewegt sich nicht mehr. Im Krankenhaus stellen sie einen Tumor fest in seinem Kopf. Zurück in Dänemark wird evident, dass dieser hochangesehene und intelligente Mann, Rektor einer Privatschule, mit den ihm anvertrauten Vermögenswerten hochgradig riskant spekuliert und die Schule und damit sich und seine Familie ruiniert hat. Mit krimineller Energie ging er vor, hat fremde Werte beliehen, Mias und andere Unterschriften gefälscht, Scheinkonten eingerichtet, Freunde und Kollegen betrogen und ins Unglück mitgerissen, völlig rücksichtslos gehandelt – während alle ihn für einen wunderbaren Menschen hielten.
„Vor allem müssen Sie darauf vorbereitet sein, dass Ihr Mann jegliches Einfühlungsvermögen für Sie und Ihr Befinden verliert“, hat der Arzt auf Mallorca zu Mia gesagt. „Es könnte ihm deutlich schwerer fallen, seine primitiveren Impulse zu steuern, es kann zu plötzlichen Wutanfällen kommen, und er wird jeden Gedanken, dass er krank ist, weit von sich weisen. Das sind die typischsten Symptome bei einer Beeinträchtigung im Orbifrontalbereich.“
Während Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln, Wohnung und Inventar geschätzt und schließlich verkauft wird, Leben und Freundeskreis der dreiköpfigen Familie zerfällt, muss Mia nicht nur alle Sinne beisammen halten, Frederiks Verteidigung organisieren und den Schaden so begrenzt wie nur möglich halten, sondern auch damit klar kommen, dass sie mit einem Unbekannten zusammen ist und war, dass nichts mehr von dem stimmt, was sie für normal gehalten hat. An all ihrer bisherigen Wahrnehmung muss sie zweifeln, gleichzeitig sensibel für alle neue Entwicklung sein. Hellwach, erschüttert, verwundet, verunsichert, auf schwankendem Boden, mit rasendem Gehirn. Der hyperaktive Frederik, der so viele Abende im Schulbüro verbrachte, hat nicht nur mit Geld spekuliert, er hat sie über Jahre mit anderen Frauen betrogen. „Ich dachte, ich würde mich den Kindern in der Schule opfern“, muss sie sich eingestehen, „während er in Wahrheit Verhältnisse mit anderen Frauen hatte. Das waren meine besten Jahre… Wer zum Teufel ist dieser fremde Mann?“
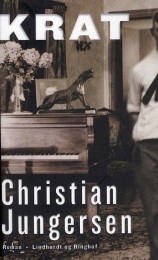 Das Leben, vor und zurück
Das Leben, vor und zurück
Sie aber liebt ihn, liebt ihn fort. Auch ihrem bisherigen Leben und ihrer Familie zuliebe. Sie kann sich nicht sicher sein, wieviel davon „er“ war, im Guten wie im Schlechten, denn so ein Gehirntumor ist persönlichkeitsverändernd. Gefangen in einem double bind, muss und will sie sich selbst und den zu rettenden Scherben ihrer Existenz zuliebe, ihren Mann als Kranken sehen, nicht als bösen Täter, gleichzeitig jedes Detail ihrer 18 Ehejahre anders denken. Sie geht in eine Selbsthilfegruppe für Angehörige von Gehirngeschädigten (aus dieser Gruppe gibt es einen großen Zuspruch für Jungersens Roman, so etwa auf „brainline“).
In den USA ist der Zuspruch für „You disappear“ insgesamt groß, Jungersen ist dort anerkannt. Ich warte auf eine wenigstens englische Übersetzung seines Erstlingsromans „Krat“ (Undergroth/ Unterholz). Mia muss feststellen: „Die anderen sind nicht wütend. Wie vertreiben sie ihre Wut?“ Sie beobachtet sich dabei, wie sie mit ihrem Sohn plötzlich Boxkämpfe schaut. Sie kämpft damit, dass sie nicht mehr weiß, für wen sie sich da opfert. Sie sieht sich tot, sie sieht sich glücklich, sie sieht sich mit anderen Männern, sie sieht ihr Leben im Schnelldurchlauf, spult zu Knotenpunkten, vor und zurück, sieht sich andere Wege nehmen. Die Bilder im Kopf rasen, probieren bisher nicht zugelassene Gefühle. Das ist manchmal nur ein Satz, mitten im Erzählverlauf.
Jungersen gelingt die Balance, das erzählerisch auf Linie zu halten. „Du verschwindest“ liest sich fast tagebuchartig, wie das Journal einer hochreflexiven Person, die sich mit Nachdenken und Ehrlichkeit gegenüber sich selbst über der Wasserlinie hält, die kämpft und zweifelt, um klaren Kopf ringt, während die Gefühle Sturm laufen. „Fast sind wir wieder eine richtige Familie, abgesehen davon, dass kein Sexualleben stattfindet und es meinem Ehemann egal ist, was ich denke und fühle. Genau wie in vielen anderen Familien, sage ich mir. Innerlich muss ich lachen.“ Sie verliebt sich in einen Mann aus der Selbsthilfegruppe, der ihnen als Anwalt hilft, wehrt sich dagegen und leidet und gibt dem Verlangen nach, während sie ihrem Ehemann beisteht im Gutachterzirkus, der für das Gerichtsverfahren ausschlaggebend sein wird. Mia „wird eine erfahrene Besucherin von Wartezimmern“.
Eine geheime Welt aus tausenden Familien
Als Erzählerin bewahrt sie sich einen feinen Sinn für die Absurditäten des Lebens, jene Prise Ironie und Selbstdistanz, die (auch uns Lesern) all die Psychoabgründe erträglich machen. Zum Beispiel: „Nie zuvor habe ich so viel ferngesehen wie in diesen Tagen, an denen ich versuche, mir darüber klar zu werden, wie ich meinen Mann am besten verlassen kann.“ Oder: „Der Mörder in der englischen Fernsehserie wird zwar erst in ein paar Minuten entlarvt, aber ich stelle den Fernseher sofort ab, als mein Sohn nach Hause kommt.“ Über eine mögliche frühere Konkurrentin bemerkt sie: „Ihr Gesicht ist faltenfrei wie bei einer Sexpuppe.“
Frederik, der sich früher so an Musik begeistern konnte, hat die Fähigkeit zum Zuhören verloren, die Töne sagen ihm nichts mehr, „die Musik hat ihre Schönheit für ihn verloren, jetzt zerlegt er Lautsprecher, will ihre Funktion begreifen, bessere konstruieren“, während draußen an die Hauswand „Hier wohnt ein Verbrecher!“ gesprüht wird. Eine Kriminalermittlung verschränkt sich in diesem Buch mit einer Erforschung innerster Motive, das geht weit über Herkömmliches von Schuld und Wille, Trieb und Forensik hinaus. Die Unterwelt, die sich hier enthüllt, ist das eigene Gehirn, die Subkultur „eine geheime Welt aus tausenden Familien, die mit Hirngeschädigten leben müssen“.
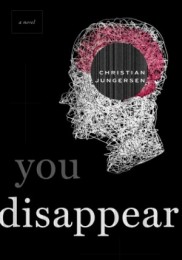 Bruch mit Erzähltraditionen – geradezu ein Manifest
Bruch mit Erzähltraditionen – geradezu ein Manifest
Sparsam dosiert, enthält dieser spannungspralle Journalroman „weiterführende“ Einsprengsel, kleine wissenschaftliche Artikel in Sachen Hirnforschung, neurologische Krankheitsformen, Anomalien, Mails anderer Personen mit ihrer Sicht auf die Dinge, Zeitungsmeldungen (etwa: „Viele Hirnschäden werden nicht entdeckt“), eine Betrachtung über Spieltheorie, die bedenkenswerte Forderung nach einer radikal neuen Neurophilosophie, die den herkömmlichen Denkansätzen mit den Methoden der Hirnforschung begegnen müsse. Und dann, auf Seite 372 ff. ein (fiktiver?) Artikel aus einer „Zeitschrift für Kulturanalyse“ mit dem Titel „Worauf fußt die zeitgenössische Erzählung?“ (in der englischen Ausgabe „Storytelling’s Crutch Is Broken“). Die Erzählungen des 20. Jahrhunderts seien in ihrer Struktur, Personenzeichnung und Symbolik untrennbar mit der Psychoanalyse verbunden, mit einem hinfällig primitiven Erkenntnissystem.
„Wenn die Kunst des Erzählens in Literatur, Film und Fernsehen nicht die Kraft entwickelt, auf eigenen Füßen zu stehen, ohne sich auf die Psychoanalyse zu stützen, sind die Erzählungen unserer Epoche zur Rolle von alten Staatslenkern in einer Diktatur verdammt: eine dezidiert antimoderne Kraft, die es zu meiden gilt bzw. die ausgelöscht werden muss, wenn irgendeine Form von realer kultureller Entwicklung erreicht werden soll.“
Essentiell in einer „gut erzählten Geschichte“ sei, liest uns Jungersen die Leviten, dass sich die Ingredienzien, die in ihrem Verlauf eingeführt werden, später als absichtlich platziert erweisen. Jeder Leser habe ein intuitives Gefühl dafür – erworben unter anderem durch unsere Volksmärchen –, das selbst schon Kinder in die Lage versetze, die Schilderung zufälliger Begebenheiten von einer „Erzählung“ zu unterscheiden. Das Volksmärchen des 20. Jahrhunderts für Erwachsene sei der psychologische Roman, sei die geordnete Erzählung.
„Die große Mehrheit der Romanschriftsteller und Film- und Fernsehautoren haben nie eine Vorlesung über den wissenschaftlichen Fortschritt innerhalb der Psychologie, Psychiatrie und Neurologie in den letzten 30 Jahren beigewohnt. Aber sie alle wurden … über die Psychoanalyse unterrichtet, die zufälligerweise die perfekte Struktur für sonst strukturell unreflektierte Erzählungen liefert. Der Schaden für die moderne Fiktion ist kolossal – und zieht größere Konsequenzen nach sich, als wäre der Autor Kreationist.“
 Muss Literatur glücklich machen?
Muss Literatur glücklich machen?
Als Vorspiel zu diesem Paukenschlag gibt es zunehmend ironische Betrachtungen Mias zur Rolle des Wassers und des Regens in unseren kulturellen Bildern. Freihändig zitiert: „Jetzt müsste es eigentlich regnen/ An dieser Stelle müssen jetzt Wellen ans Ufer schlagen…“ Jungersens ambitioniertes literarisches Unternehmen ist es, uns aus einer sich fragmentierenden Welt zu erzählen – das zieht einem als Leser den Boden weg. Wenn das Buch dann Mia und Frederick und Niklas und Bernard verlässt, am Vorabend des Prozesses, mit offenem Ausgang also, bleibt man schmerzlich auf sich geworfen.
Literatur und vor allem Kriminalliteratur ist nicht unbedingt dazu da, nur glücklich zu machen. Dieses Buch schon gleich gar nicht. Es bringt einem nahe, wie groß und unendlich doch unser Innenleben ist, aber eben auch wie fragil und verletzbar. Man kann da staunen und fürchten, besorgt sein und lieben, den Wert des eigenen Glücks schätzen und die Stabilität einer Beziehung, zugleich in viele Abgründe schauen und schaudern. Dies ist ein reiches, wirklich reiches Buch. So sehr es zum Fürchten ist, so glücklich macht es als Lesegenuss, als Reise und Anstoß. Das lässt sich nicht über jede Lektüre sagen.
In einem Interview gefragt, was der Punkt seines Romans denn sei, meinte Jungersen: „Genau das ist Grund, warum so viele Interviews mit Schriftstellern unbefriedigend bleiben. Wenn man einem Journalisten nicht kurz und bündig sagen kann, worum es geht, heißt es, man habe keine Haltung, keinen Standpunkt. Für Schriftsteller ist es das Gegenteil: Wenn man, was man auszudrücken versucht, in ein paar Sätzen sagen könnte, bräuchte man keinen Roman.“
PS. „Ausnahme“, Jungersens zweiter Roman, 2006 von Ulrich Sonnenberg übersetzt bei Piper erschienen, entstand nach drei Jahren Recherche und hinterließ bei mir einen bleibenden Eindruck. In einem Mikrokosmos von vier Frauen in einem Büro bündelt sich, was wir an Terror, Grausam- und Mitleidslosigkeit in der Welt haben. Das Politische sei privat, das entfaltet sich geradezu ungeheuerlich in diesem wie mit dem Skalpell geschriebenen Kammerspielroman mit den vier Frauen Iben, Malene, Anne-Lise und Camilla. Gut, es ist kein normales Büro, es handelt sich um das (fiktive) Dänische Zentrum für Information über Völkermord, wo jeden Tag Berichte des Grauens aus der ganzen Welt einlaufen. Eines Tages trifft per E-Mail eine Morddrohung gegen eine der Frauen ein. Der Anfangsverdacht richtet sich gegen einen serbischen Kriegsverbrecher, aber dann wird aus den Verdächtigungen ein erbarmungsloser Krieg unter den vier Frauen selbst. „Das Böse“, sagt Jungersen, „ ist oft wirklich banal. Es wird es von Menschen verübt wie du und ich, sie glauben von sich, dass sie das Richtige tun und im Vollbesitz ihrer Vernunft sind. Mit dieser Bürogeschichte wollte ich nachvollziehbar machen, dass wir alle im Stande sind, absolut böse zu sein und gleichzeitig überzeugt davon, dass wir genau das nicht sind – böse.“
PPS. Charakterveränderungen nach Verletzung bestimmter Hirnanteile wurden bereits Mitte des 20. Jahrhunderts beschrieben. Die Erfahrungen vieler Kriege mit ihren zahlreichen Geschoß- und Splitterverletzungen des Gehirns zwangen zur intensiveren Erforschung. Neben den Schädel-Hirn-Verletzungen durch äußere Einwirkungen und ihren Folgen gibt es auch die seelischen, körperlichen und psychosozialen Folgen durch Gehirntumoren (raumfordernde Hirnprozesse, im Fachjargon). Wer hierzu googelt, gerät auf eine schwindelerregende Reise: Verlust zwischenmenschlicher Schwingungsfähigkeit, Angstzustände, Zwänge, Überempfindlichkeit, rasche Kränkbarkeit, Unzufriedenheit, Vorwurfshaltung, Reizbarkeit, Missmut, Schuldgefühle, Beziehungsstörungen, Verhaltensänderungen… Du verschwindest.
Alf Mayer
Christian Jungersen: Du verschwindest (Du forsvinder, Kopenhagen 2012) Roman. Aus dem Dänischen von Ulrich Sonnenberg. Btb Verlag, München 2014. 474 Seiten. 19,99 Euro. Zur Homepage des Autors. Autorenfotos: © Iben Mondrup











