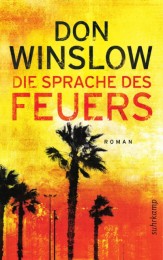 Die Poesie des Realen
Die Poesie des Realen
– Gute Kriminalliteratur entsteht meistens aus genau beobachteter Realität. Wir kennen das Prinzip aus Don Winslows neuen Büchern über die narcos südlich und nördlich der Grenze zwischen USA und Mexiko. Aber auch an seinen älteren Romanen kann man sehen, wie gute Kriminalliteratur funktioniert – zum Beispiel an „Die Sprache des Feuers“. Thomas Wörtche hat ihn gelesen …
Dana Point liegt südlich von Los Angeles, im berühmten Orange County, wo der Flughafen John Wayne heißt und wo die County-Politicos auch schon mal die ganze Kohle mit schrägen Fonds verzockt haben. Hartgesottenes Republikaner-Land. Atemberaubende Strände, hügelige Canyons mit grandiosem Panaroma-View. Natürliches Buschbrandgebiet, während der Santa-Ana-Winde im Oktober/November. Landslides an den Hängen, also Erdrutsch-Gegend, weil die Böden kaputt sind. Aber ein einmaliger Surf und an manchen Ecken immer noch der kalifornische Traum, der amerikanische Traum in Breitwand und Multicolor. Immobilienspekulationsobjekt in ganz großem Maßstab. Die berühmte Goldgrube! Also ein El Dorado der Begehrlichkeiten, auf dem halben Weg nach San Diego und der mexikanischen Grenze. Alle tummeln sich hier, die Triaden, die Narcos und die Russen, die Armenier und natürlich die ganz normalen WASP-Geschäftsleute, Politiker, Banken, Ärzte, Investoren, real estate developer und andere Teilnehmer am ökonomischen Kreislauf. Gierschlünde, Raffzähne und profitgeil allesamt, denn Orange County ist very american.
It often burns in Southern California
Es wird viel gezündelt in solchen Gegenden. Heiße Sanierungen sind an der Tagesordnung, Lagerhäuser mit (angeblich?) wertvollen Warenbeständen gehen schnell in Flammen auf, begehrte Grundstücke mit unbequemen Besitzern werden flugs feuergerodet und so weiter. Eine Menge Arbeit für die Brandermittler der Versicherungsgesellschaften. So weit die Realität, die für 1999 präzise stimmt – noch saß den Leuten in Südkalifornien der Schrecken der großen Brand- und Erdrutsch-Katastrophen der 9oer Jahre in den Knochen, die Konjunktur brach ein, Gewinn machte, wer auf Baisse spekulierte, und das Ende des Kalten Krieges brachte strukturelle Bewegung in die verschiedenen Sorten und Branchen des organisierten Verbrechens.
Don Winslows „Die Sprache des Feuers“ beschreibt jene Jahre mit derselben Präzision, die heutzutage seine großen Drogen-Romane auszeichnen. Da sitzt jedes Detail, da sind lokale Gegebenheiten und wirtschaftliche, soziale und politische Umstände nicht nur Dekor, sondern konstitutiv für die Handlung, Handlungselemente wie Figuren und Plotlines auch. Deswegen ist das Alter des Buches völlig egal. Es funktioniert heute bestens, gerade weil es so zeitgebunden ist.
Hier liegt der Unterschied zum regional basierten Wald-und-Wiesen-Krimi jeglicher Provenienz: Die poetische Gültigkeit von ganz genau, aber ingeniös erfasster, durchdachter und arrangierter Realität und deren künstlerische Kombination mit Fiktion. Winslows Handlung, obwohl strikt an den Schauplatz Orange County gebunden, zeigt Ort und Zeit im globalen Verbund. Denn darum geht in den Roman auch: Der Brandermittler Jack Wade, der für die California Fire & Life Versicherungsgesellschaft arbeitet, kann exakt rekonstruieren, dass der russische Gangster Dasjatnik Valeshin in seiner Persona als guter, amerikanischer Geschäftsmann Nicky Vale seine Frau Pamela nebst Haus abgefackelt hat. Nur beweisen kann er es nicht. Valeshin ist das Gelenk der Geschichte, die weit in die alte Sowjetunion zurückreicht, ihren dramatischen Kern noch während des Kalten Kriegs hatte, als KGB-Leute anfingen, ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen und alte Strukturen neue Etikette bekamen („Russenmafia“). Jetzt möchte der zu Nicky Vale gewordene Valeshin seinen amerikanischen Traum im amerikanischen Paradies leben. Koste es, was es wolle …
Zum Duell gehören nur zwei …
Das Duell zwischen Vale und Wade, dem Brandstifter und dem Brandermittler, steht, so scheint es, ganz im Mittelpunkt des Romans. Auch da lässt Winslow sich von der Realität gern die Feder führen: Wir lernen so ziemlich alles, was wir über Brände wissen müssen und was die Analyse eines Brandortes so faszinierend macht. Das Feuer spricht zu dem, der seine Sprache versteht. Dafür sorgt Winslow. Detail auf Detail breitet er aus – wie schnell brennt was, welche Spuren legt das Feuer, was können wir aus geschmolzenen und verschmorten Materialien lernen, wie viel Hitze braucht man wofür, wie legt man am besten einen Brand, wie sollte man es lieber nicht tun (nach der Lektüre wird man sowieso davon absehen, die eigene Hütte abzufackeln, denn was die Jungs von der Brandermittlung alles rausfinden können … wow!).
Je kleinteiliger, ja, je pedantischer Winslow allerdings wird, desto faszinierender wird das Ganze – die Poesie des ganz Konkreten, sozusagen. An der Stelle zeigt er sich als gelehriger Schüler und Nachfolger von George V. Higgins (mehr hier), dessen berühmter Qualität selbst aus Aktenlagen große Literatur zu machen, Winslows Prosa an solchen anscheinend „trockenen“ Stellen durchaus ebenbürtig ist.
Aber diese Duellebene zwischen Brandstifter und Aufklärer liegt an der Oberfläche des Romans. Darunter kann man nie wissen, wie das Buch läuft. Die Fronten, die klar zu sein scheinen, sind es keinesfalls. Das Verhältnis von Versicherung, Prämien und Erstattungen ist raffiniert und hochkomplex, die Koalitionen der handelnden Personen erleben immer neue, sehr überraschende Sortierungen, Nebenfiguren sind keine und Hauptfiguren haben zum Ende hin immer weniger zu melden. Winslow schält nach dem Zwiebelprinzip (oder dem Matrjoschka-Modell der russischen Steckpuppen, das im Roman auch Wirtschaftsmodelle erklärt) mit eisiger Konsequenz eine tröstliche Konflikt-Lösung nach der anderen ab. Sowohl für Jack Wade als auch für den verblüfften Leser, der auch nicht viel mehr weiß als der hilflose „Held“.
Am Ende, wenn es ans große Töten und ans große Verdienen geht, erweist sich die wahre Konstellation als beinahe monströs. Das Ausmaß an völlig plausibler Korruption, die Methoden des Gelderwerbs und der Umverteilung, die weitreichenden sich gegenseitig bedingenden Strukturen von Kriminalität und Kriminalitätsbekämpfung, von Konkurrenz und Kooperation ist gigantisch. Dazu kommt die völlig ubiquitäre Bereitschaft zur extremen Gewaltanwendung von allen Seiten. Und überhaupt die ganze Unsortierbarkeit von „Seiten“, „Parteien“, geschweige denn von Moral oder „gut“ und „böse“. Selbst das berühmte „das Richtige Tun“ kann in diesem Kontext das Allerfalscheste sein.
Seltsamerweise aber scheint das alles völlig normal, hat keinen Beigeschmack von Paranoia oder Hysterie. Dieses feeling herzustellen, gelingt Winslow mittels seiner intellektuellen Lakonie prächtig.
Konzept von Kriminalliteratur
Auf dem grimmigen, pragmatischen Realismus (der wie jeder gute Realismus poetisch sein kann, wenn er die Sprache dafür hat –Winslow hat sie) basiert Winslows Konzept von Kriminalliteratur. Aufklärung, Gerechtigkeit, all diese Kategorien lässt er an der Welt scheitern, ohne dass dieses Scheitern ein großes Thema wäre. Deswegen muss er auch nicht – wie in den Büchern seiner formal, ästhetisch und ideologisch eher konservativen Counterparts wie Fred Vargas etwa – zu den berühmten Standardlösungen wie Happy End (noch nicht mal ein unhappy-happy-ending, sondern ein diffuses ending), deus-ex-machina, den genialen Dreh und anderen Werkzeugen aus dem Kistchen „poetische Gerechtigkeit“ greifen. Manche der Figuren sind am Ende tot, manche überleben, manche profitieren, manche verlieren.
That’s how it goes, everybody knows, singt Leonard Cohen. „Die Sprache des Feuers” erzählt die passende Geschichte dazu.
Thomas Wörtche
Don Winslow: Die Sprache des Feuers (California Fire & Life, 1999). Roman. Deutsch von Chris Hirte. Berlin: Suhrkamp Verlag 2012. 419 Seiten. 14,99 Euro. Eine Hörprobe des Buches finden Sie hier. Mehr zu Don Winslow bei CM gibt es hier (Tage der Toten), hier (Zeit des Zorns), hier (Satori) und hier (Don Winslow im Gespräch). Zur Webseite von Don Winslow geht es hier, zur Verlagsseite hier.














