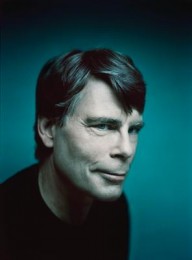 Vom King lernen?
Vom King lernen?
Wie man glaubwürdig erzählt und wie nicht … Ein paar Gedanken zum Handwerk des Schriftstellens von Ulrich Baron.
Es ist nicht immer schön, wenn Schriftsteller sich auch einmal explizit Gedanken über Geschichten im Allgemeinen machen. „Geschichten“, so will uns etwa Zoran Drvenkars Roman „Du“ weismachen, „werden nicht mehr mündlich überliefert, sie werden uns mit rasender Geschwindigkeit in Kilobytes präsentiert, so dass wir den Blick nicht abwenden können. Und wenn es uns zu viel wird, reagieren wir wie die Barbaren und verwandeln dieses Chaos in Mythen.“
Die Älteren von uns erinnern sich natürlich an die gute alte Zeit, als Raymond Chandler und Dashiell Hammett ihre Stories noch mündlich überliefert haben. Aber wenn wir sie heute schon „mit rasender Geschwindigkeit in Kilobytes präsentiert“ bekommen, warum hat man dann ausgerechnet eine der schwächsten der letzten Jahre noch in Buchform veröffentlicht? (Siehe „Du“-Rezension bei Crimemag) Warum bringt Drvenkar Barbaren und Mythen zusammen, obwohl doch die Griechen, die den Begriff des Mythos geprägt und mit Inhalt gefüllt haben, unter „Barbaren“ stets nur die Anderen verstanden haben? Und warum bemüht er die Informationsflut des Internet-Zeitalters für einen Fall herauf, der im Jahre 1995 beginnt, als E-Mails und world wide web für die meisten Menschen noch Zukunftsmusik waren?
„Du“ beginnt mit der von jener bereits zitierten Pseudo-Philosophie umwaberten Geschichte eines Massenmordes auf der A4, bei dem ein Einzeltäter während eines schneebedingten Staus sechsundzwanzig Menschen mit bloßen Händen umbringt. Zwar insistiert der Erzähler darauf, dass dieses Verbrechen sich bald zum Mythos ausgewachsen habe und Mythen sich „nicht an Daten“ hielten, doch kann er selbst der Versuchung nicht widerstehen, mit einigen näheren Angaben aufzuwarten und zu verraten, dass sich das Ganze vor „vierzehn Jahren auf der A4 zwischen Bad Hersfeld und Eisenach“ abgespielt habe. Und weil ihm das nicht drrramatisch genug erscheint, raunt er:
„Wir gehen zurück in die Vergangenheit und machen sie zum Jetzt.
Es ist November.
Es ist das Jahr 1995.
Es ist Nacht.“
Wir, sie, es, es es – sieht man exzessiven Missbrauch solcher Personalpronomina ab, der bei einem Buch dieses Titels ja erwartbar ist, hat es im November 1995 auf der A4 bekanntlich keinen Massenmord gegeben. Und deshalb auch keinen Mythos. Drvenkars Erzähler jedoch beharrt starrsinnig darauf: „In den darauffolgenden Monaten sind unzählige Theorien darüber aufgestellt worden, was in jener Nacht geschehen ist. War es Streit? Waren es Drogen, Rache oder Wahnsinn?“ Was der Unterschied zwischen Spekulationen und Theorien ist, weiß Drvenkars Erzähler nicht. Weiß Drvenkar es? Was bei anderen Autoren ganze Kriminalromane füllt, fasst er in einem Satz zusammen: „Die Kripo gab sich Mühe, eine Verbindung zwischen den sechsundzwanzig Opfern zu finden.“
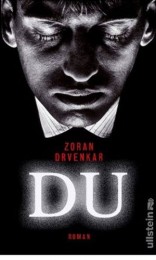 Gewäsch
Gewäsch
Natürlich sind Krimis und Thriller Fiktionen, Geschichten, die nicht wirklich stattgefunden haben, aber statt zu erzählen, stellt Drvenkar zunächst einmal nur Behauptungen auf, die ohne viel Mühe zu widerlegen sind. Das ist ein unverzeihlicher handwerklicher Fehler, denn wer will schon Geschichten lesen, denen er nicht glaubt? Zwar gibt es talentierte Erzähler, die einem weismachen könnten, dass die Gebrüder Klitschko hühnerbrüstige Schwächlinge seien, aber Drvenkar versucht das gewissermaßen, während er zwischen den beiden steht.
Wie man eine Art Mythos schafft, wie man ein unerhörtes Ereignis erzählerisch so plaziert, dass einem die Realität nicht gleich Lügen straft, kann man bei Stephen King studieren. Zwar schreibt der Meister des provinziellen Horrors überwiegend fantastische Literatur, also Geschichten, die mit der Wirklichkeit und ihren Naturgesetzen grundsätzlich unvereinbar sind, aber gerade deshalb kommt es darin auf innere Stimmigkeit an. Bevor die Toten wiederkehren können, muss man sich hier unter den Lebenden wie zu Hause gefühlt haben, sonst funktionieren die Effekte und Affekte nicht.
Bevor Stephen King in „Brennen muß Salem“ eine Kleinstadt von Vampiren entvölkern lässt, erzählt ganz nebenbei, dass verlassene Städte gar nicht so ungewöhnlich seien: „Es ist nicht die erste Stadt in der amerikanischen Geschichte, die schlicht und einfach verschwindet, und vermutlich nicht die letzte, aber sie ist sicherlich eine der Merkwürdigsten unter ihnen“, heißt es über Jerusalem’s Lot. Dann folgen ein paar Bemerkungen über die Geisterstädte im amerikanischen Südwesten, die Gold- und Silberräusche quasi über Nacht hatten aufblühen lassen. Und wer kennt nicht die Bilder von verfallenen Saloons und Hotels in der Wüste?
Doch nach diesem kurzen Seitenblick auf die Wirklichkeit kommt King wieder auf seinen fiktiven Schauplatz zurück und präsentiert gleich den nächsten Trick: „In New England aber ist der einzige Parallelfall zu Jerusalem’s Lot – oder Salem’s Lot, wie die Bewohner es oft nennen – eine kleine Stadt in Vermont namens Momson. Während des Sommers von 1923 scheinen Momson und seine dreihundertzwölf Einwohner sozusagen fortgeblasen worden zu sein.“
Während Salem’s Lot im Roman durch übernatürliche Ereignisse entvölkert wird, bleibt der Fall Momson unaufgeklärt: „Im Warenhaus fand man auf dem Verkaufstisch ein verrottetes Baumwolltuch liegen, und in der Kasse waren 1,22 Dollar markiert. In der Kassenlade lagen fünfzig Dollar.“
Das Rätsel von Momson gibt den fantastischen Ereignissen in Salem’s Lot gewissermaßen Flankenschutz, indem es nahelegt, dass dort schon etwas sehr Seltsames geschehen sein muss. Und während kaum jemand auf die Idee käme, die Vampirattacken in Salem’s Lot für real zu halten, stößt man im Internet immer wieder auf Fragen, ob an der Geschichte von Momson etwas dran sei. Ist es nicht, aber mit Sicherheit lässt sich das nicht so leicht ausschließen wie ein angeblicher Massenmord auf einer deutschen Autobahn im November 1995.
Auf nur wenigen Seiten und ohne pseudophilosophisches Gewäsch hat Stephen King so demonstriert, wie man Geschichten in die Welt setzt, die sich verselbständigen, und in denen Dinge möglich erscheinen, die extrem unwahrscheinlich, ja prinzipiell unmöglich sind. Sie Mythen zu nennen, wäre zu hoch gegriffen, aber immerhin.
Extrem unwahrscheinlich ist auch der Massenmord auf der A4, nur spricht hier wenig für dessen Möglichkeit. Drvenkars Mörder geht von Auto zu Auto, vermeidet Fahrzeuge mit mehreren Insassen und dreht seinen Opfern wohl die Hälse um oder erwürgt sie. Wie er das schafft, bleibt so unerwähnt wie die Schneemassen, die ihm nicht nur seinen Weg, sondern auch das Öffnen der Autotüren erheblich erschweren müssten. Und erst im „Wagen Nummer zehn“ stößt er auf einen Ansatz von Gegenwehr. Immerhin: „In Wagen Nummer sechs hat der Fahrer versucht, auf den Rücksitz zu klettern.“ Doch warum ist er nicht ausgestiegen? „In Wagen Nummer acht hat der Fahrer wiederholt mit dem Kopf gegen das Fenster geschlagen, um auf sich aufmerksam zu machen.“
Auch wenn die McVeighs und Breiviks dieser Welt uns immer wieder schreckliche Überraschungen bereiten werden, gibt es doch erhebliche Unterschiede zwischen dem Morden mit Bomben und halbautomatischen Waffen und dem Töten mit bloßen Händen.
Beim Versuch, sechsundzwanzig Menschen vom Beifahrersitz aus umzubringen, müsste der Täter sich auf unangenehme Überraschungen gefasst machen, auf scharfkantige Schlüssel, Nagelfeilen und auf Opfer, die ihm selbst an die Kehle gehen. Drvenkar beschwört ein schreckliches Ereignis herauf, aber kann es nicht glaubhaft erzählen.
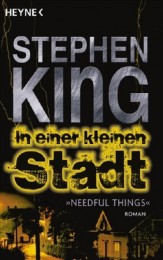 Eskalation
Eskalation
Auch hier kann man viel von Stephen King lernen, der überhaupt ein Meister der Eskalation ist und seine fantastischen Geschichten aus einer Vielzahl realistischer Details heraus aufbaut. Ganz nach dem Motto „Ich glaube nicht an Gespenster, aber ich fürchte mich vor ihnen“ spielt King mit den irrationalen Ängsten und konkreten Bedrohungen des Alltags. Wie schreibt er so schön in seinem Roman „In einer kleinen Stadt“? „Ärger und Zwistigkeiten entstehen zumeist aus ganz gewöhnlichen Umständen“. Das Städtchen Castle Rock wird am Ende von seinen eigenen Einwohnern in Schutt und Asche gelegt, weil ein teuflischer Ladenbesitzer deren Besitzgier und Missgunst bis zur Selbstzerfleischung angestachelt hat. Zwar handelt es sich hier um fantastischen Horror, aber Motivation und Handlungsstruktur erinnern an manche Krimis der Hardboiled-Schule, besonders an Hammetts „Rote Ernte“, wo das Auftreten des Detektivs die latente Gewalt explodieren lässt.
Kings diabolischer Provokateur Mr. Gaunt versteht sich als eine Art Elektriker, der am Ende alle emotionalen Sicherungen zum Durchbrennen bringt: „In einer kleinen Stadt wie Castle Rock waren alle Sicherungskästen säuberlich nebeneinander aufgereiht. Man brauchte nur die Kästen zu öffnen und Querverbindungen herzustellen. Man schloß eine Wilma Jerczyck mit einer Nettie Cobb kurz, indem man die Drähte aus zwei anderen Sicherungskästen anschloß.“
King setzt hier die simple kriminologische Erkenntnis um, dass die meisten Gewaltverbrechen Beziehungstaten sind – oft ausgelöst durch den sprichwörtlichen Tropfen, der das Fass lange aufgestauter Emotionen zum Überlaufen bringt. Ein bisschen Mobbing hier, eine kleine Stichelei da, ein bösartiger Streich, ein Kratzer im Lack eines neuen Pick-ups, ein Stein im Fenster – und schon werden bei King und frei nach Schiller nicht nur Weiber zu Hyänen.
Auch wenn „In einer kleinen Stadt“ das fantastische Motiv des Teufelspakts zur epischen Nummernrevue aufbläst, ist das kriminalpsychologisch doch weit realistischer als die meisten Massen- und Serienmörderkrimis. Das liegt nicht zuletzt auch darin, dass King als solider und sehr pragmatischer Handwerker vor keinem Mittel und auch nicht vor derb-naturalistischen Effekten und hemmungsloser Übersteigerung alltäglicher menschlicher Affekte wie Wut und Hass zurückschreckt. Bei Drvenkars Roman hat man hingegen den Eindruck, er habe beim nächsten Satz schon vergessen, was er zuvor gerade geschrieben hatte.
Da steht nun sein „Du“ auf der verschneiten Autobahn: „Ein Lastwagen kriecht auf der gegenüberliegenden Fahrbahn vorbei und blendet einmal auf, als wollte er dich grüßen.“ Das kann man sich gut vorstellen, wie sich der Wagen da mit heiß gelaufenem Motor durch den Schnee kämpft und einen kurzen Lichtgruß hinübersendet. Aber dann kommt es knüppelhart: „Der Fahrtwind erreicht dich Sekunden später mit voller Wucht.“
Wo einen der Fahrtwind eines kriechenden Lasters „mit voller Wucht trifft“, muss man auch jederzeit damit rechnen, von einem herabstürzenden Wattebäuschchen zerschmettert zu werden. Deshalb lege man dieses Buch besser vorsichtig auf den Boden und suche sein Heil in der Flucht, bevor einem in rasender Geschwindigkeit weitere Kilobytes solchen Dünnsinns präsentiert werden.
Ulrich Baron
Zoran Drvenkar: Du. Ullstein Hardcover 2010. 576 Seiten. 19,95 Euro. (Siehe auch CULTurMAG-Rezension). Thomas Wörtche über Stephen King auf Kaliber38. Foto Stephen King: Amy Guip.












