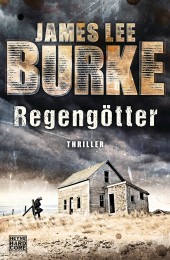 Reinstes Genre, reinste Literatur
Reinstes Genre, reinste Literatur
– Endlich ist er wieder da, James Lee Burke, der wuchtige, kantige, kauzige, spökenkiekerische und grandiose Schriftsteller, der wesentlich dazu beigetragen hat, Genre als Literatur zu etablieren und dabei Genre zu bleiben. Heyne Hardcore startet sein James-Lee-Burke-Projekt mit „Regengötter“. Eine Besprechung von Thomas Wörtche.
„Imperien kamen und gingen. Die unbezwingbare Natur der menschlichen Seele hingegen lebte ewig fort.“ So lautet der vorletzte Satz von James Lee Burkes monumentalem Roman „Regengötter“. Eine philosophischen Sentenz also, die zu dem mythischen Grundakkord des Titels passt.
Ganz und gar prosaisch hingegen ist der Ausgangspunkt des Romans: Irgendwo in Texas, nahe der mexikanischen Grenze werden neun Frauen gefunden, regelrecht exekutiert, mit einem Bulldozer notdürftig im Boden hinter einer Kirche „entsorgt“. Die Frauen, illegal aliens aus Asien, hatten Drogen zwecks Schmuggel im Körper und waren wohl zusätzlich zur Zwangsprostitution vorgesehen. Sherrif Hackberry Holland (der hier seinen zweiten Auftritt seit 1971 hat) und seine Leute tun ihre Arbeit, auch wenn sie vom FBI und anderen „Diensten“ behindert werden und stoßen auf ein unappetitliches Konglomerat aus Menschen- und Drogenhandel, aus Mafia und anderen Formen des organisierten Verbrechens. Und auf einen bemerkenswert psychopathischen Profikiller, der unter dem Namen „Preacher“ operiert. So zusammengefasst erzählt „Regengötter“ einen eher durchschnittlichen Plot ohne besondere Drehs und Wendungen, der aber auch eine Momentaufnahme des ganz normalen Wahnsinns einer schon längst aus den Fugen geratenen Welt ist und insofern keine auf dem Reißbrett zusammengestöpselte Marketing-Revolverschote.
James Lee Burke gehört nicht umsonst – auch wenn er bei uns skandalöserweise seit über zehn Jahren kaum noch präsent ist – zu den ganz Großen der amerikanischen Gegenwartsliteratur. Wir haben es schön öfters betont: Wer immer nur auf die Roths, Updikes, Austers und DeLillos schaut, hat kein wirkliches Bild von der amerikanischen Gegenwartsliteratur, die widerborstiger, kreativer und subversiver ist als alle Lieblinge des Diskurses zusammen.
Tiefenstruktur
Burkes Romane um den (Ex-)Polizisten Dave Robicheaux (hier auf kaliber.38), die allesamt in Louisiana spielten, zeichneten sich durch harte Plots aus, kombiniert mit grandiosen Landschaftsschilderungen und oft mit einem Touch ins Mystisch-mythisch-Gespenstische, erzählt in einer eigenwilligen, poetischen Prosa. Auch in „Regengötter“ ist die durchaus realistische kriminalliterarische Standardsituation nur der Ausgangspunkt für ungewöhnliche Exkursionen in menschliche Dispositionen, in die Erhabenheit der Natur und in völlig eigenständige Denkwelten.
Denn, dass Sheriff Hackberry Holland überhaupt tätig wird, hat mit dem schlechten Gewissen eines der Mittäter an dem Massaker zu tun. Das ist schon einmal bemerkenswert, weil Nebenfiguren mit schlechtem Gewissen im Durchschnittsthriller meistens bald abgeräumt werden, um das Duell von Gut und Böse zu positionieren. Burke jedoch nimmt das moralische Problem „Gewissen“ ernst – umso mehr, als diese Figur ein Irakkriegsveteran ist. Und über das Thema „Gewissen“ verklammert mit Hackberry Holland, ein Koreakriegsveteran, der in nordkoreanischer Gefangenschaft gefoltert und gedemütigt worden war. Verklammert damit nun wieder andere Kriegsthemen und Mythen, zurück bis zum Alamo und dem Genozid an den native Americans, die Burke nur anscheinend nebenbei immer wieder einflicht. So bekommt der Roman seine faszinierende Tiefenstruktur, ohne dass die Komposition aufdringlich sichtbar würde …
Burke individualisiert und seziert alle Hauptfiguren, bis von ihren erwartbaren Motivationen oder Handlungen nichts mehr übrig bleibt. Preacher, der psychopathische Killer, ist in der Tat schwer gestört, aber er kennt Mitleid, Empathie und Glaube. Er lässt sich von Frauen verprügeln, ist zögerlich, tritt notfalls die Flucht an und kann sich einbilden, aus „höheren Gründen zu töten“. Er ist ein Gegenbild zu den Highttech- und Hocheffizienzkillern, die die einschlägige Literatur bevölkern, ohne deswegen ein altmodischer, gar sympathischer Mörder zu sein. Oder ein kleiner, schmieriger Striplokalbesitzer entwickelt wahnsinnige Zivilcourage und stirbt dabei fast vor Angst, zieht aber dennoch sein Ding durch (großartig die Szene, in der er einem ekligen russischen Mafiaboss die Zähne zeigt) und alle Frauenfiguren bringen den Kerlen das Fürchten bei – sie hauen und stechen, sind cool und clever, alles andere als damsells in distress.
Genre!
Die Bibelfestigkeit der Figuren gehört zum kulturellen Grundbestand, christliche Handlungsweisen treffen wir nicht unbedingt immer an. Und so porträtiert Burke seine Figuren in schönster Demokratie – die Schurken sowie die Guten, die Minderen sowie die Wichtigen, die Vernünftigen und die Gestörten. Und über allem steht die Natur, deren Stimmungsbilder die Dominante des Romans liefern. Der religiöse und naturphilophische Subtext, den Burke schon immer in seinen Romane gepflegt hat, rückt neuere Autoren wie James Carlos Blake (Alf Mayer über Blake hier und hier) und Bruce Holbert (zur CM-Rezension) in seine Nähe; seine Rolle als Initiator eines neuen, kritischen Diskurses über alte Themen und alte Gewissheiten ist überdeutlich.
Dabei schreibt Burke reinstes Genre und gleichzeitig reinste Literatur, weil er die Konstellationen des Genres nicht zu Verflachung nutzt. Er inszeniert sie hochkomplex und macht „Genre“ als eine sehr probate Möglichkeit sichtbar, sich, auch im erkenntnistheoretischen Sinn, künstlerisch mit dieser Welt, wie sie nun einmal ist, auseinanderzusetzen. Und mit der menschlichen Seele.
Thomas Wörtche
Dieser Text ist die Extended Version der Fassung für Deutschlandradio Kultur.
James Lee Burke: Regengötter (Rain Gods, 2009) Roman. Deutsch von Daniel Müller. München: Heyne Hardcore 2014. 660 Seiten. 16,99 Euro. Verlagsinformationen zu Buch und Autor. Zum Interview mit James Lee Burke.











