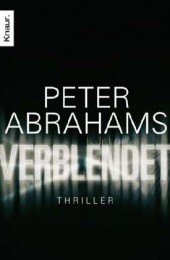 Konfektionsware
Konfektionsware
Programme großer Verlage müssen gefüllt werden. Neben den „Spitzentiteln“ muss eine gewisse Füllmenge her. Dafür könnte man gute Bücher nehmen – man kann aber auch viel bequemer und risikoärmer irgendwelche Titel nehmen, die nicht weiter stören. Wie so was tickt, beschreibt am Beispiel von Peter Abrahams´ „Verblendet“ Henrike Heiland.
Man weiß ja, dass es bei Verlagen Titelkonferenzen gibt, und man weiß ja auch, dass sich die Lektorinnen und Lektoren vorher große Mühe mit der Titelfindung geben. Sie haben ihre Vorgaben, was gerade geht und was nicht, sie schauen nach, welche Titel schon vergeben sind, sie testen ihre Ideen an Kollegen und Freundinnen, und dann kommt eben diese Titelkonferenz, in der abgenickt oder abgelehnt wird, da spricht noch das Marketing mit und der Vertrieb und so. Man weiß natürlich auch, dass seit fünf Jahren Einworttitel beliebt sind, und was muss es eine Freude für alle Beteiligten gewesen sein, dass „Verblendet“ noch frei war. Weil, nicht nur ein Einworttitel, sondern auch noch einer, der wahnsinnig gut passt vom inhaltlichen Standpunkt her. Der Protagonist ist nämlich ziemlich verblendet. Aber auch als Leser geht man ziemlich verblendet aus der Nummer heraus. Kurz: Perfekte Titelfindung. Auf allen Ebenen. Das ist mal selten, und da soll keiner sagen, es handle sich nur um eine sinnfreie Nachahmung der Stieg Larsson-Titelmode.
Roy muss sterben
„Verblendet“, um von der Verpackung zum Inhalt zu kommen, erzählt die Geschichte des Bildhauers Roy Valois, der sein Liebesleben nicht so richtig auf die Reihe bekommt, weil er noch seiner vor fünfzehn Jahren bei einem Unfall ums Leben gekommenen Frau nachtrauert. Aber sein eigentliches Problem ist, dass man bei ihm Lungenkrebs diagnostiziert und ihm nur noch wenige Monate gibt. Roy tut, was man eben so tut, wenn man weiß, dass man sterben muss: Er erzählt es keinem und verlässt seine Freundin (die erste, die er seit dem Tod seiner Frau vielleicht hätte lieben können). Heimlich begibt er sich in eine Testgruppe für eine Spezialtherapie. Aber vorher will er noch unbedingt rausfinden, was man in seinem Nachruf über ihn schreiben wird. Er bittet einen jungen Hacker, das mal eben für ihn nachzusehen, und als er dort liest, dass der Beruf seiner verstorbenen Frau falsch wiedergegeben wurde, ruft er schlecht gelaunt den zuständigen Journalisten an, sagt ihm, er soll seine Recherchearbeit gefälligst ordentlich machen, und schickt ihn dadurch in den Tod. Weil nämlich etwas nicht stimmt mit dem Tod seiner Frau. Mit dem Leben seiner Frau. Mit so einigem. Und keiner darf es wissen.
Roy, schwach und krank, macht sich nun nach dem gewaltsamen Tod des Journalisten selbst auf Recherchetour, um herauszufinden, was es mit der Tätigkeit seiner Frau für das Hobbes-Institut, einem Thinktank für humanitäre Projekte in Drittweltländern, auf sich hatte. Damit und mit ihrem angeblichen Tod bei einem Hubschrauberabsturz in Venezuela. Als Roy sich in Washington nach dem Hobbes-Institut umschaut, um zur Berichtigung seines Nachrufs Beweise beizubringen, existiert es dort nicht mehr. Das Gebäude, in dem es untergebracht war, birgt keinerlei Spuren mehr davon, niemand kann sich an die Existenz des Instituts erinnern, und die Suche nach ehemaligen Kollegen wird erst schwierig und dann lebensbedrohlich. Aber Roy bleibt dran, sucht die Wahrheit, kämpft verzweifelt gegen die Krankheit, die ihn auszehrt und auffrisst, will es einfach wissen.
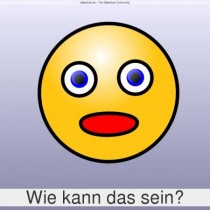 Neinwiekanndenndassein
Neinwiekanndenndassein
Das sind im Grunde schon ordentliche Zutaten, und Peter Abrahams rührt sie auch ordentlich zusammen, ist ja nicht sein erstes Buch. Verblendet ist, wie sich also schnell herausstellt, der gute Roy, weil er jahrelang Dinge nicht sehen wollte. Und verblendet soll man als Leser bitte auch sein, vor lauter Tempo und Überraschung und Neinwiekanndenndassein. Verblendet vom soliden Spannungsbogen und einer paranoiden Verschwörungstheorie, die über dem Plot schwebt und so amerikanisch ist, dass man ein Star-Spangled Banner vor sich sieht, sobald man die Augen schließt. Denn irgendwie muss über die gravierenden Schwächen des Texts hinweggemogelt werden. Zu viele Dinge, die hingebogen werden, damit der Plot funktionieren kann. Roys völlige Unkenntnis im Jahr 2007 von Internetsuchmaschinen, überhaupt seine Unfähigkeit, angemessen zu recherchieren, all das kommt der Geschichte sehr gelegen, lässt den Leser allerdings sich schmerzlich winden. Die Rückblenden in die Vergangenheit, die Schlüsselszenen aus dem Leben mit seiner Frau beschreiben sollen, stecken so voller holzhammerartiger Hinweise darauf, dass mit der Frau was nicht stimmte, dass man sich fragt, was Roy eigentlich so den ganzen Tag macht, wenn er mal nicht damit beschäftigt sein sollte, zu ignorieren, was um ihn herum geschieht.
 Pickel, böse
Pickel, böse
Die klischeefreudige Einführung von Charakteren, die einen sofort zweifelsfrei erkennen lässt, wer gut und wer böse ist – natürlich ist der junge Hacker pickelig und hat fettige Haare, nur so als Beispiel – irritiert auch und schürt vor allem falsche Hoffnungen, weil man denkt, es müsse noch etwas total Überraschendes auf der Figurenebene geschehen, was aber nicht der Fall ist.
Und dann die lahmen Griffe in die Thrillertrickkiste: Roy sieht etwas, ganz deutlich, ganz sicher, aber man zerrt ihn weg, und als er eine Weile später noch mal nachsieht, ist alles ganz anders, und er muss an seinem Verstand, an seinen kognitiven Fähigkeiten zweifeln. Der Leser soll das auch, weil durch die experimentelle Therapie, die er bekommt, möglicherweise wirklich seine Wahrnehmung getrübt ist.
Schließlich kommt noch, wie gesagt, eine Verschwörung auf nationaler Ebene mit dazu. Roy hat es ja mit ganz, ganz schlimmen Gegnern zu tun, geheimer als jeder Geheimdienst, und letztlich rettet er, kurz vor seinem Ableben, das Land, erfährt die Wahrheit über seine Frau, und sein Nachruf wird bestimmt auch noch korrigiert.
Ein Wellness-Produkt
Ein weiteres „Allein gegen den Rest der Welt“-Buch, das sich, wenn man nicht allzu aufmerksam ist, gut weglesen lässt und über das man nicht viel nachdenken sollte, weil sonst die Probleme anfangen. Eine Geschichte, die sich wohlbekannter Versatzstücke des Subgenres bedient und nur wenig Originäres bringt, nicht einmal stilistisch. Möglicherweise aber ist auch das alles gewollt und geplant, wie ein Titel sorgfältig geplant wird: nicht zu viel Ungewohntes, unbedingt Erwartungen erfüllen, bloß keine Experimente und – immer davon ausgehen, dass man die Leser nicht zu sehr fordern darf.
So gesehen: Mission erfüllt. Zielvorgaben Belanglosigkeit und Beliebigkeit vollständig erreicht. Und dazu noch so ein schöner Titel, wenn das mal kein Glücksfall war.
Henrike Heiland
Peter Abrahams: Verblendet (Nerve Damage, 2007). Roman. Deutsch von Frauke Czwikla. 416 Seiten. München: Knaur 2012. 9,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch. Zur Homepage von Henrike Heiland.











