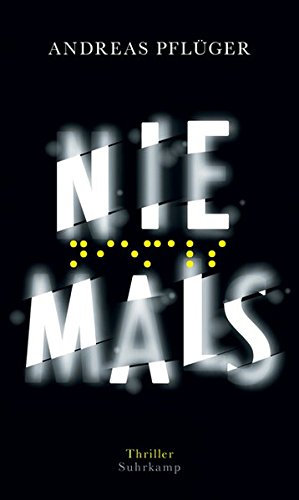 Wie man Thriller in große Literatur verwandelt
Wie man Thriller in große Literatur verwandelt
Von Werner Fuld
Beim Schreiben hat Gottfried Benn gewußt, wenn ihm drei besonders gute Strophen gelungen waren und hat dann noch zwei weitere dazu gedichtet, die das Ganze ruinierten. Solch letale Redundanz wird Andreas Pflüger nicht passieren: Er hat das Ende von Aarons Geschichte mit dem dritten Band angekündigt. Dieses Ende wird furchbar sein, denn – auch wenn er das jetzt noch nicht weiß – Pflüger kann Aaron nicht überleben lassen. Weil dem höchsten Glück die Tragik der Unwiederholbarkeit eingeschrieben ist, wird er Jenny Aaron in dem Moment sterben lassen, in dem sie ihr Augenlicht wiederfindet – durch eine Kugel, die sie in diesem glückserfüllten Augenblick nicht spürt. So würde ich es machen, aber glücklicherweise bin ich nicht der Autor. Oder leider, denn im Lauf eines Lebens finden sich drei oder vier Bücher, um die man die Autoren beneidet, weil man sie gerne selbst geschrieben hätte. Als Jugendlicher „Stiller“, auf dem Höhepunkt „Titan“, bei dem man dann doch dankbar ist, daß Jean Paul ihn geschrieben hat, Raabes große Weltverlachung „Die Akten des Vogelsangs“ und neuerdings Jenny Aarons Geschichte wegen der Makellosigkeit des Scheiterns, die sie mit den Anderen teilt. „Es ist schön hier“, sagt die Blinde, und Pavlik antwortet: „Ja, wenn du dich umdrehst. Wo du hinguckst, ist eine Müllhalde.“ Pointierter geht’s nicht. Aber Lakonie schließt Empathie nicht aus.
Es gibt einen höchsten Grad der Materialbeherrschung, an dem der Inhalt nebensächlich wird, weil es nur noch auf den Stil ankommt: Der Stil erklärt die Handlung. Jede Szene braucht ein eigenes Erzähltempo, kurze oder lange Sätze, kleine Absätze ohne Erklärungen oder Erinnerungssätze, die in die Vergangenheit führen. Der gewöhnliche Leser weiß von solchen Anforderungen des Stoffs an die Sprache nichts. Daß ein Schriftsteller ein Mensch ist, dem das Schreiben schwerer fällt als Anderen, kümmert ihn nicht. Robert Musil ist daran verzweifelt. Arno Schmidt hat nach dem Krieg, nachdem er sämtliche Fehler in seinen Jugendwerken gemacht hatte, neu angesetzt und in den Kurzromanen der fünfziger und sechziger Jahre Poesie und Präzision miteinander verbunden.

Das ist lange her, aber an dessen Kompromißlosigkeit fühlte ich mich schon bei „Endgültig“ erinnert. Im täglichen Leben kommt man mit Lügen durch, das merke niemand, hat Raabe geschrieben, doch in der Kunst sei man zur Wahrheit verpflichtet. Man muß erstmal das Greisengeschwafel der Grass, Walser, Handke aus dem Kopf kriegen, das jahrzehntelang als hohe Literatur galt, um ermessen zu können, was Pflüger leistet: Er erzählt eine unwahrscheinliche Geschichte so realistisch, daß sie wahr wird. Die Fakten machen dabei den kleineren Teil aus, aber sie stimmen; selbst der Innenminister ist wie im wirklichen Leben des Jahres 2015, in dem „Niemals“ spielt, ein überforderter Trottel.
Erst in der Sprache verdichtet sich die Spannung. Die Actionszenen entwickeln ein irres Tempo, aber die Sätze knirschen nicht vor Überlastung in den Gelenken, sondern bewegen sich so elegant wie Aaron. Sie liegen an den Personen wie eine zweite, gestaltgebende Haut. Es wird gewalttätig, aber nie laut. Man ahnt, daß gerade die schnellsten Szenen mit flachem Atem geschrieben sind, wo andere Thriller-Autoren geblähte Backen kriegen. Pflügers Sprache hetzt nicht die Personen, sondern folgt ihrem Tempo und macht die Situation ebenso glaubhaft wie die Psycholgie seiner Figuren. „Ihr Herz steht still, und die Welt schlägt gegen ihre Brust“ – weniger als im ersten Band gibt es solche starken Bilder, für die man sich bis zu Döblin in die zwanziger Jahre zurückerinnern muß, um Vergleichbares zu finden. In diesem zweiten Band wird Aaron seltener von der Verzweiflung über ihre Blindheit überrollt, seltener von der Erinnerung an ihre verlorene Liebe heimgesucht. Jetzt gibt es eine begründete Hoffnung auf eine Therapie und auf Rache für den Mord an ihrem Vater. Der Cliffhanger ist gut gewählt: zwei Milliarden Dollar warten auf einen Besitzer und ein kleiner Junge auf ein neues Zuhause. Es wird also spannend und hoch emotional weitergehen. Pflüger hat damit schon jetzt gezeigt, wie man Thriller in große Literatur verwandelt. Er setzt einen neuen Maßstab nicht nur für deutsche Autoren.
Andreas Pflüger: Niemals. Suhrkamp Verlag, Berlin 2017. 475 Seiten, 20 Euro.
Werner Fuld hat viele Jahre als Literaturkritiker unter anderem für die FAZ und Die Zeit gearbeitet und ist Autor zahlreicher Bücher. Zuletzt von ihm erschienen: „Das Buch der verbotenen Bücher. Universalgeschichte des Verfolgten und Verfemten von der Antike bis heute“ (Galiani, Berlin 2012) und „Eine Geschichte des sinnlichen Schreibens“ (Galiani, Berlin 2014).
Siehe auch: „Ich bin ja nur das Gefäß meiner Figuren“ – Alf Mayer im Gespräch mit Andreas Pflüger (CrimeMag Oktober 2017)
Peter Münder über „Operation Rubikon“: Wenn die Mafia mitregieren will (CM April 2017)
Sonja Hartl über „Endgültig“: Die Professionalität von Ermittlerinnen (CM Mai 2016)
Sowie: Wer Andreas Pflüger zu seiner blinden Heldin inspirierte – in dieser Ausgabe, nebenan.
Über „Endgültig“ schrieb Werner Fuld:
Man kann dreißig Jahre Literaturkritiker sein, tausende Romane gelesen und hunderte Rezensionen geschrieben haben und dann erscheint ein Buch, von dem man sagen muss: Etwas Vergleichbares habe ich noch nicht gelesen. Ein Buch wie ein Feuerball, der alle unsere Thriller-Erfahrungen überrollt, sie auslöscht und nach einem brutalen Ende den Leser immerhin damit tröstet, dass zwei Hauptpersonen überlebt haben, während zwei große Liebesdramen im Kugelhagel endeten.
Als Leser ist man auf ein solch intensives Buch nicht vorbereitet, weil Thriller normalerweise Verbrauchsliteratur sind: Gelesen und vergessen. Keine Nebenwirkungen (…)
 Wer ist Jenny Aaron? Sie hört gerne Janis Joplin, mag keine Filme von Almodovar, ihr Lieblingsbuch ist Max Frischs Roman „Gantenbein“ und sie besitzt einen schwarzen Kater, für den sie schon mal ihre Karriere riskiert hatte. Mit ihr könnte man also gut befreundet sein. Leider hatte sie diesen lebengefährlichen Beruf mit hochriskanten Einsätzen, der sie nun wieder einholt. Zunächst begreift sie nicht, warum sie von Holm gejagt wird und warum er sie umbringen will. Die Zusammehänge und persönlichen Verflechtungen erkennt sie erst, als es fast zu spät ist.
Wer ist Jenny Aaron? Sie hört gerne Janis Joplin, mag keine Filme von Almodovar, ihr Lieblingsbuch ist Max Frischs Roman „Gantenbein“ und sie besitzt einen schwarzen Kater, für den sie schon mal ihre Karriere riskiert hatte. Mit ihr könnte man also gut befreundet sein. Leider hatte sie diesen lebengefährlichen Beruf mit hochriskanten Einsätzen, der sie nun wieder einholt. Zunächst begreift sie nicht, warum sie von Holm gejagt wird und warum er sie umbringen will. Die Zusammehänge und persönlichen Verflechtungen erkennt sie erst, als es fast zu spät ist.
Was diesen Thriller einzigartig macht, ist der Stil. Der Text suggeriert ein irrwitziges Tempo, dennoch wirkt die Sprache nie aufgeregt oder exaltiert. Wie bei einem Scharfschützen, der seinen Herzschlag unter Kontrolle halten muss, bleibt Pflügers Stil auch in den spannendsten Szenen von kaltblütiger Präzision. Diesem Autor gelingen Szenen von äußerster Dynamik auf knappstem Raum, die plötzlich vom dunklen Blitz einer poetischen Metapher ausgeleuchtet werden. In solchen Passagen sind Action und Melancholie untrennbar, und die Handlung läuft sekundenlang in slow motion. (…)
Es gibt in diesem Buch keinen überflüssigen Satz. Jede kleinste Bemerkung ist wichtig und dient dem Verständnis der Personen und der Handlung. In Leserkommentaren liest man häufig: „Ich hab das Buch in einem Zug ausgelesen.“ Dann war es kein gutes Buch. Es war vielleicht spannend, aber nicht wirklich vielschichtig. Diesen Roman von Andreas Pflüger liest man nicht einfach so aus. Wenn man die letzte Seite gelesen hat, möchte man von vorne beginnen.











