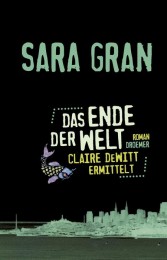 Sara! Gran!
Sara! Gran!
Kriminalliteratur ist ein sich stets neu erfindendes System. Selbst Schrott-Lawinen, Dumpf-Tsunamis, middle-of-the-road-Langweiler, lächerliche Pseudoavantgarde, Wannabe-Murks und Verblödelung kriegen es nicht tot.
Innovationen kommen aus unerwarteten Ecken und sorgen für Verwirrung. Dafür sind Sara Grans Romane um die Privatdetektivin Claire DeWitt ein schönes Beispiel. Der neue Roman heißt „Das Ende der Welt“ – Thomas Wörtche hat ihn gelesen.
„Das Ende der Welt“ ist der zweite Roman um die sich selbst megaloman-ironisch die „beste Detektivin der Welt“ nennende Claire DeWitt. Der Vorgänger, „Die Stadt der Toten“, wurde entweder (zu Recht) mit Lob und Preis überhäuft oder mit Unverständnis und tugendpolizeilich-keifender Engstirnigkeit abgelehnt – ein Schicksal, das anscheinend vor allem Autorinnen trifft, die sowohl formal als auch in Sachen „values“ eigene Wege gehen wie zum Beispiel auch Helen Zahavi oder Christa Faust. Ein merkwürdiges Rezeptionsverhalten, das sich durch das stockdumme Geplapper der „lesenden Jungfrauen beiderlei Geschlechts“ (according to Raymond Chandler) durch allerlei Foren, Communities und Amazon-Besprechungen zieht.
Im Grunde ist ein solch deutliches Schisma aber nur gut, denn die Polarisierung um Sara Gran steht – neben vielen anderen Aspekten – auch für die zunehmend größere Schere zwischen „Krimi als Produkt“ und „Kriminalliteratur als Idee“, die wiederum für eine zunehmende Verschärfung der Kluft zwischen einer sich lese-affin gebenden, offenen Intellektuellen-Feindlichkeit im Zeichen störungsfreien Konsums und dem Insistieren auf Substanz und Qualität typisch ist.
Tradition revisited
Die amerikanische Autorin Sara Gran bleibt in ihrem aktuellen Buch „Das Ende der Welt“ ihrer Methode treu, traditionelle Elemente der Kriminalliteratur neu zu sortieren und neu zu akzentuieren. Dabei bleibt die Tradition aus guten Gründen gewahrt und es entsteht gleichzeitig auf diesem Unterboden etwas Neues, Originelles und Riskantes.
Deswegen ist es nur logisch, dass ein Handlungsstrang in dem mythischen Ort San Francisco spielt, der per se (pop-)kulturell und gesellschaftspolitisch eminent aufgeladen ist. Dieser San-Francisco-Strang ist mit dem O-Original-Titel: „Claire DeWitt and the Bohemian Highway“ gemeint. Ein Ex-Lover von DeWitt ist getötet worden, die Detektivin wird, klassisch, von der Schwester des Toten engagiert, um dessen Ehefrau des Mordes zu überführen. In der Stadt Dashiell Hammetts, in der Stadt der beat poets, repräsentiert durch den immer noch existierenden Buchladen „City Lights“ des ebenfalls noch lebenden Lawrence Ferlinghetti, und in der Stadt von Hippie-Kultur und New Age-Experimenten, die inzwischen zum lifestyle der Reichen und Gelangweilten verkommen sind, lässt Gran ihre gewaltbereite, dauerkoksende, sexuell autonome und enigmatische Claire DeWitt all die guten Traditionen der Detektiv-Literatur wiederbeleben, die das Genre einst groß gemacht hatten: den Hang zum Exzess, die Rigorosität der Wahrheitssuche, die Rolle des Außenseiters, aus dessen Perspektive die Dinge immer anders aussehen als von der „Mitte der Gesellschaft“ aus. Die Geschichte der Detektivliteratur ist, von Sherlock Holmes bis James Crumley, auch immer eine drug story, sagt Sara Gran im Gespräch – klar, Drogen haben erkenntnisförderndes Potential und detective fiction nun wiederum dreht sich um Erkenntnisinteresse.
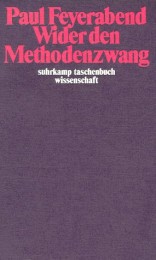 Anarchie!
Anarchie!
An dem Punkt, und das ist in der Tat sehr originell, ist DeWitt erkenntnistheoretische Basis-Demokratin. Sie arbeitet mit klassischer Deduktion, mit der mühseligen Lauf- und Recherchearbeit der professionellen Detektivin, gum-shoe-style, und sie nutzt als ebenbürtige Werkzeuge der Wahrheitssuche das I Ging, den Tarot, Visionen, Träume, Intuitionen, die paradis artificiels und was es sonst noch so gibt, „wider den Methodenzwang“ – das ist schon eine für die Kriminalliteratur (fast) einzigartige Annäherung an Paul Feyerabend und überschreitet den gerne an dieser Stelle zitierten Diskurszusammenhang von Carlo Ginzburgs „Spurensicherung“ (Morelli, Holmes, Freud) weit ins Anarchische.
Wahrheit und Hingabe
Als Romantikerin, wie Raymond Chandlers Philip Marlowe, restituiert Claire DeWitt das Ethos der grundsätzlich auffindbaren Wahrheit gegen den Zeitgeist-Relativismus des profitablen Pragmatismus. Und ironisiert und fraktalisiert gleichzeitig den Weg dorthin.
Dass man den Kampf um die Wahrheit nicht notwendigerweise gewinnen muss, belegt der zweite Handlungsstrang („Das Ende der Welt“ bezieht sich auf diesen Teil des Buchs), der 1986 im von Post-Punk und Grunge geprägten Brooklyn spielt. Musik ist auch hier zentral, wie New Orleans im ersten Buch und wie die Rock-Stadt San Francisco im anderen Handlungsstrang des aktuellen Romans.
Claire DeWitt und ihre beiden besten Freundinnen verfallen als Teens dem Detektivspielen und merken, dass Wahrheitssuche schnell schmerzhaft und lebensgefährlich werden kann, wenn man sie seriös betreibt. So ernst und hingebungsvoll, wie sich der Professor aus einem anderen, neben Silettes „Détection“ (s. u.) sehr wichtigen fiktiven Werk – den nur in winzigster Auflage im Privatdruck erschienen „Cynthia Silverton Mysteries“, die Claire und ihre Freudinnen zu verschlingen pflegten –, das Herz aus dem Leib schneidet und es an Cynthia im Namen der Wahrheitssuche übergibt.
Eine Seriosität, die die Lebenswelt mit guter Kriminalliteratur eher verbindet, als dass sie Fiktion und Realität kategorial trennt.
Silette
Weil Sara Gran ein feines Gespür für die Fallen von Pathos und Kitsch an solchen Punkten hat, baut sie zum einen den (fiktiven) französischen Vordenker Jacques Silette (ein genial-eingänglicher Name irgendwo zwischen Manchette und Gillette razor blades) ein, dessen Werk „Détection“, eine Art Roland Barthes’sches „S/Z“ für Detektive, das passende Zitat für jede Lage liefert und dessen „Nachfolger“ und Alumni wie ein unsichtbares Netzwerk grundsätzlich überall auftauchen können. Jacques Silette ist die Fiktion eines ubiquitären Masterminds, eines kryptischen Welterklärers, der allerdings selbst gescheitert und verbittert gestorben war – polyvalent, rätselhaft, nicht in eine andere Semantik übersetzbar.
Spott & Hommage & Melancholie
Zum anderen färbt Gran den Erzählduktus durch verschiedene Abstufungen des Ironischen, Satirischen, Spöttischen, Sarkastischen und Gebrochenen, was somit auch Momente der Poesie, der Trauer, der Melancholie und der liebevoll-spöttischen Hommage an große Traditionen der Populären Kultur erlaubt: In einer großartigen Szene deduziert die weltweit einzige Kapazität für Poker-Chips aus einem solchen zufällig gefunden Plastikteilchen, bei welchem Spiel „downtown Oakland, 5. März 2010, Blackjack“ damit verloren wurde („Setze nie auf die Siebzehn“). Sherlock Holmes wäre vor Neid erblasst, hätte aber auch nicht die Sahnetorte, die der Spielmarken-Experte mit einem Happs auffrisst, als Honorar akzeptiert.
Trotz dieser gar nicht erschöpfend auszulotenden Vielschichtigkeit gelingt es Gran, den Roman nicht zum Meta-Krimi erstarren zu lassen. Die Figuren sind durch die Bank schräg und abgedreht, aber plausibel, nicht primär Funktion oder Statthalter von Positionen, Ideologien oder sonstigen Abstrakta. Die Handlung folgt dem Prinzip der Kontingenz, die Aufklärbarkeit des Falles erscheint als sinnvoller Gedanke, dessen Realisierung immer als prekär und als Hauch von Utopie.
„Das Ende der Welt“ ist ein großartiger Kriminalroman sui generis, der dem Genre Perspektiven weg von Formel und Klischee aufzeigt.
Thomas Wörtche
Sara Gran: Das Ende der Welt (Claire DeWitt and the Bohemian Highway, 2013). Roman. Deutsch von Eva Bonné. München: Droemer 2013. 367 Seiten, 14,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch. Homepage der Autorin. TW über „Die Stadt der Toten“ bei crimemag.












