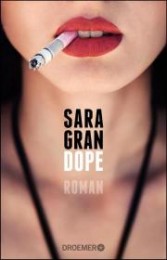 Mean Streets à la Gran
Mean Streets à la Gran
– Eine ganz wichtige Stimme des Genres ist Sara Gran, was man spätestens seit ihren beiden Romanen um die geniale Privatdetektivin Claire DeWitt („Die Stadt der Toten“ und „Das Ende der Welt“ (dazu hier und hier bei CM) weiß. Jetzt legt ihr deutscher Verlag endlich „Dope“ nach. Eine Rezension von Thomas Wörtche.
„Dope“ stammt schon aus dem Jahr 2006, wurde sträflicherweise bis jetzt nie übersetzt und ist alles andere als ein Frühwerklein oder eine Fingerübung für größere Aufgaben. Sara Gran tut zunächst ganz unschuldig so, als ob das Buch ein nettes, harmloses Pastiche von Chandlers oder Spillanes hard-boiled novels wäre. Die taffe Ich-Erzählerin ist Ex-Hure, Ex-Junkie und hauptberufliche Diebin und Betrügerin, die von einer gleissnerischen Klientel beauftragt wird, eine verschwundene junge Frau aus besseren Kreisen im Drogen- und Prostitutionsmilieu des New York Citys der 1950er Jahre zu suchen. Dabei trifft sie immer wieder auf ihre Schwester, mit der sie seltsam ungut verbunden ist. Klassischer kann man Standardthemen des klassischen Privatdetektivromans von Raymond Chandler bis Ross Macdonald nicht zitieren. Und sie gleichzeitig entromantisieren, mit den Füßen in den größten Dreck stellen. Das New York City, durch das Sara Gran die Hauptfigur Josephine Flannigan schickt, ist genau das Szenario, das bei Autoren wie Mickey Spillane zwar behauptet, aber nie wirklich erzählt wird.
Und so streift „Joe“ durch die Absteigen und heruntergekommen Puffs für hoffnungslose Fälle, treibt sich mit Junkies, Hehlern, Betrügern herum und zeichnet ein Bild, das dem 1950er-Jahre-Feeling der weißen moral majority diametral gegenübersteht. Ein Bild, das aber auch nicht dazu angetan ist, deren American Values wie bei Spillane als Ein-Mann-Lynch-Mob durchzusetzen. Sara Grans Zeitkommentare zu prägenden Jahren der westlichen Zivilisation und Kultur durchziehen den ganzen Roman, explizit oder implizit, auf jeden Fall originell und scharf beobachtet.

Sara Gran, (Photo by D. Lopez, zur Quelle)
Gegen-Stimmen
Das Counter-Casting der Ich-Erzählstimme – aus dem Kerl wird eine Frau, die die Zentralperspektive behauptet – attackiert die Vorlagen, zeigt eine andere Wahrheit hinter den klassischen Konstellationen des Private Eye Romans à la Spillane dieser Zeit und vor allem damit dessen einvernehmliche Bindung an die Wertewelt jener Jahre. Den anscheinend naiven Plot der Spillane und Co. persifliert Gran sarkastisch, in dem sie ihn viel radikaler als die meisten pi-novels ins Bitterböse dreht. Die einschlägigen Machodetektive, ob melancholisch-zweifelnd, ob testosteronbratzend heroisch, prügelten sich mit den Bösen in der Gewissheit herum, dass am Ende das Gute siegt, wenigstens ein bisschen. Bei Sara Gran siegen, wenn überhaupt, les paradis artificiels. Darin kann man eine Art Verbindung zu den Claire-DeWitt-Romanen und deren verwirrend-geniale Vermischung von Drogenästhetik à la Baudelaire und dem foucaultesken Philosophen des Verbrechens, Jacques Silette, sehen.
Die Aufklärbarkeit der Welt
Aber Sara Gran bezieht sich unterschwellig noch auf eine andere Dimension: In den 1980er Jahren besetzten Autorinnen wie Marcia Muller, Sue Grafton und Sara Paretsky die Figuren des damals in einer Art Retro-Blüte stehenden Privatdetektivromans. (Es ist alles viel komplizierter und ich verkürze hier sehr.) Aus hartgesottenen Kerlen machten diese Autorinnen hartgesottene Frauen, verbal und physisch notfalls genauso brachial wie die Jungs. Im Grunde fand eine Geschlechtsumwandlung statt, allerdings ohne große ästhetische Folgen. Die Kultur des wisecracks blieb bestehen, nur gendermäßig angepasst.
 Auch die weiblichen PIs erzählten meisten aus der Zentralperspektive eines durchaus stabilen und selbstbewussten Ichs, sie wurden – wenn auch oft verbeult, zerdellt und vermackelt wie ihre Kollegen – dem Bösen schon irgendwo Herr. Sie glaubten zumindest an die partielle Aufklärbarkeit der Welt. Diesen Werteoptimismus teilten sie durchaus mit den männlichen Kollegen ihrer Zeit, Robert B. Parker, Arthur Lyons und wie sie alle hießen. Diese Tradition scheint bei Sara Gran sardonisch gewendet auf: Ihre Heldin Josephine will überleben – was als Aufklärungsaufgabe für sie begonnen hat, erweist sich als böser Mordanschlag, als gezielter Versuch sie auszurotten (so viel Spoiler kann ich riskieren). Und Claire DeWitt wird ein paar Jahre später sowieso alle klassischen Parameter der Privatdetektivliteratur der subversiven Anarchie anheimgeben.
Auch die weiblichen PIs erzählten meisten aus der Zentralperspektive eines durchaus stabilen und selbstbewussten Ichs, sie wurden – wenn auch oft verbeult, zerdellt und vermackelt wie ihre Kollegen – dem Bösen schon irgendwo Herr. Sie glaubten zumindest an die partielle Aufklärbarkeit der Welt. Diesen Werteoptimismus teilten sie durchaus mit den männlichen Kollegen ihrer Zeit, Robert B. Parker, Arthur Lyons und wie sie alle hießen. Diese Tradition scheint bei Sara Gran sardonisch gewendet auf: Ihre Heldin Josephine will überleben – was als Aufklärungsaufgabe für sie begonnen hat, erweist sich als böser Mordanschlag, als gezielter Versuch sie auszurotten (so viel Spoiler kann ich riskieren). Und Claire DeWitt wird ein paar Jahre später sowieso alle klassischen Parameter der Privatdetektivliteratur der subversiven Anarchie anheimgeben.
Aber es gilt auch: „Dope“ ist kein Metaroman. Alles ist clever, sehr bösartig, witzig und gleichzeitig sehr tragisch-gut gemacht, aber der Roman erzählt vor allem eine überzeugende menschliche Tragödie und legt dabei die Methode des Erzählens bloß. Virtuos und mit einer salzsäureklaren Haltung zur Welt und zu der Literatur, mit der eine solche Welt (auch) konstituiert wird. Groß!
Thomas Wörtche
Sara Gran: Dope (Dope, 2006). Deutsch von Eva Bonné. München: Droemer 2015. 251 Seiten. 12,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch. Homepage der Autorin, Blog und Facebook-Seite.











