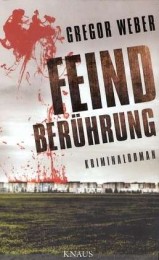 Politik, Kriminalliteratur & Grimmi
Politik, Kriminalliteratur & Grimmi
– Glanz und Elend des deutschen Kriminalromans lagen selten so nahe beisammen wie in zwei aktuellen bemerkenswerten Debüt-Romanen, die sich mit aktuellen politischen Ereignissen befassen. Thomas Wörtche über zwei Bücher und ein grundsätzliches Problem …
Gregor Webers „Feindberührung“ thematisiert den Krieg der Bundeswehr in Afghanistan und dass Krieg etwas mit Menschen macht, was man nicht unbedingt öffentlich thematisiert sehen möchte.
„Der Spitzenkandidat“ von Bettina Raddatz dekliniert am Fall eines ermordeten Politikers in Niedersachsen die Porosität und den allmählichen Kollaps der „demokratischen“ Verfasstheit unserer Gesellschaft und ihrer staatstragenden Organe durch.
Beide Romane sind meilenweit vom üblichen Grimmigedödel der witzischen und belanglosen Sorte entfernt, sie sind Kriminalromane im besten Sinne. Beide Romane sind konzeptionell bestens erdacht – der von Bettina Raddatz biestiger und radikaler als der von Gregor Weber, der seinerseits sehr sorgfältig mit der ernstnehmenden Beschreibung von Milieu und Personen umgeht. Beide sind dennoch keine wirklich brillanten Kriminalromane, obwohl sie es beide sein könnten, wenn nicht, ja …

Bettina Raddatz
Der Markt, mal wieder …
Das Elend beider Romane ist, um es vornehm zu sagen, das des „Referenzrahmens“ Krimi-Markt in unseren Tagen. Weil sich „Krimi“ in erklecklichen Mengen verkauft, bemühen sich nicht nur Verlage, die traditionellerweise nichts mit Kriminalliteratur am Hut haben, ihren Anteil am Kuchen zu sichern. Das ist völlig legitim, allerdings fehlt eine Art genuines Know-how im Umgang mit dem Genre. Ersichtlich daran, dass man vermeintliche Erfolgsrezepte, die einmal funktioniert haben, einfach repetiert: Zum Beispiel die elende Kombination aus Kommissar und Assistent, die aus dem schlechten Fernsehkrimi entkommen ist und jetzt in den Köpfen der Buchproduzenten herumgeistert. Tausende von belanglosen Regio- und anderen Grimmis ticken nach diesem Muster. Kurzfristiger Verkaufserfolg hat Priorität vor Qualität.
Und auch noch unnützerweise: Schaut man sich die wirklich wichtigen Werke der neueren deutschsprachigen Kriminalliteratur an – Ani, Steinfest, Blaudez, Paprotta, Heim, Beck, Lehmann, Biermann, Horst, Göhre, Blettenberg etc. – sieht man, dass genau diese keinen Standardformeln folgen resp. damit sehr gebrochen und ironisch umgehen. All den genannten Autoren und ihren Romanen ist auch gemeinsam, dass sie – wenn auch manchmal sehr vermittelt – in ihrem Verhältnis zur Welt komisch sind. Was man aber auf gar keinen Fall mit dem schenkelklopfenden Silbereisen-Gewieher der Dampfknödel, Allgäu-, Grappa- und Schießmichtot-Grimmis verwechseln darf.
Ebenfalls gemeinsam ist all den genannten Büchern auch, dass sie sich der Didaxe enthalten, dass sie nicht erklären, erläutern, Volkshochschule spielen, Standpunkte artikulieren und vor allem nicht damit pausenlos beschäftigt sind, „den Leser irgendwo abzuholen“, wie die glücklicherweise etwas in Vergessenheit geratene Formulierung lautet. Und dass sie nicht vor Redundanzen strotzen, das heißt also, dass sie ihr Publikum einigermaßen ernst nehmen.
Geht – geht nicht …
Und genau diese Tugenden, so habe ich den Eindruck, gehen sowohl Bettina Raddatz als auch Gregor Weber ab. Obwohl ich nicht so sicher bin, ob sie wirklich den beiden Autoren abgehen, sondern ob die nur in die Fallen des „Geht“-und-„Geht-nicht“-in-einem-Krimi gelaufen sind, die in den auf Nummer sichergehenden Lektorats- resp. Programmstuben der Verlage aufgebaut sind.
„Der Spitzenkandidat“ von Bettina Raddatz ist oberflächlich ein klassischer Whodunit. Der titelgebende Politiko ist mit einem Golfschläger totgeprügelt worden. Er war ein Charismatiker, ein Hoffnungsträger seiner Partei und natürlich, ein ganz fieser, eiskalter Charakter. Hat seine Frau geschlagen, mit dem Organisierten Verbrechen gedealt, war roh zu seinen Geliebten und böse zu Mami und so weiter und so fort. Die Polizei ermittelt, und wenn die Ermittlungen anfangen, unbequem zu werden, werden sie auf der politischen und wirtschaftlichen Ebene – pfeif auf Verfassung, Legalitätsprinzip und Demokratie! – behindert, sabotiert und manipuliert. Alle hängen mit drin, weil Korruption, Patronage, Geld und Einfluss die demokratisch garantierten, rechtsstaatlichen Procedere, Verfahren, Abläufe und Wege nur noch scheinhaft und formal zulassen. Dass man mithilfe des OK seinen Weg in der Politik, sei´s in der Bildungspolitik, machen kann, das erzählt Bettina Raddatz aufs Plausibelste. Dass sie selbst in Niedersachsens Ministerien gearbeitet hat, tut eigentlich nichts zur Sache, weil evidente gesellschaftliche Entwicklungen nicht die Zertifizierung durch „authentische“ Biografien der Autoren brauchen. Denn was sie über morsche Verhältnisse erzählt, ist ja nichts Sensationelles, nichts Nie-gehörtes, Nie-Dagewesenes, sondern etwas, was man als aufmerksamer Beobachter des Zeitgeschehens mit ein wenig Lebenserfahrung im öffentlichen Raum einfach weiß. Immerhin, dass auch die Autorin weiß, wovon sie spricht, ist angesichts der durchschnittlichen grimmi-sudelnden, unbedarften Hausfrau beiderlei Geschlechts eher begrüßenswert.
Freut man sich also bis hierher an dem maliziösen Plot des Romans, so möchte man oft an der Redundanz und der sprachlichen Steifheit verzweifeln. Ich habe nach dem 20. Mal aufgehört zu zählen, wir oft wir um die Ohren geschlagen bekommen, dass der abgelebte Politiker als solcher ganz toll, aber als Mensch ein Schwein war. Oder dass die Gattin des Pressesprechers ihr Gespons zu fett findet. Oder dass der parteiinterne Konkurrent bieder, aber beliebt ist, und so weiter und so fort. Man fühlt sich durch dieses Dauerfeuer der Wiederholung so entmündigt wie durch die pausenlosen Erläuterungen, die auch schriftstellerisch desaströs sind. So heuert etwa eine ehrgeizige junge Dame einen Totschläger bei la mafia an und erläutert im konspirativen Gespräch mit einem Mittelsmann die Lage des Nation: „Verkauf mich nicht für blöd. Ich gebe dir Recht, dass die Cosa Nostra Ende der Neunziger Jahre am Ende war, aber das ist lange her. Die Terrorbekämpfung seit 2001 hat sich als Vitaminspritze für die italienische Mafia erwiesen. Im Windschatten der islamistischen Terroristen ….“ usw. usw. usw. – vergleiche BKA Aktenzeichen 2/3 und usw. usw. im korrekten Duden-Deutsch, das man in den letzten Jahren vermutlich für einen Ausweis von kulturellem Niveau hält, aber besonders die Dialoge zu steifen Aufsagetexten macht.
Abholen …
Die zitierte Stelle ist natürlich kein irgendwie plausibler Dialog zwischen einer ausgekochten Schlange und einem Untergangster, sondern dieVorlesung spricht einzig zu uns, den Lesern. Und damit werden wir, die Leser, für blöd verkauft, weil wir „abgeholt“ werden, weil man uns irgendetwas jetzt mal im Vertrauen und ganz langsam zum Mitschreiben erklärt, was die beiden Dialogpartner natürlich längst wissen, weil sie ansonsten diesen Dialog nicht führen würden.
Genauso steht es mit dem braven Abarbeiten der vermeintlich nötigen Korrektheiten. Warum nur ist der geschlachtete Politiker so ganz, ganz böse geworden? Na, weil man zu ihm, dem ungeliebten und geschlagenen Kind auch böse war – und deswegen kommt dann eine zähe Motivations-Mär auf, die das Opfer auch als Täter, aber auch als Opfer zeigt, ganz so, wie es die Parameter des Evangelischen Kirchentages verlangen. Dass der Mann ein systemisch bedingtes Arschloch ist, soll nicht gesagt werden, weil das ja sicher irgendwo zutiefst ungerecht und falsch (einer fiktiven Figur gegenüber!) wäre, und auch der Führer war schließlich ein Mensch. Ja! Aber wir reden von Romanen, nicht von realen psychiatrischen Gutachten. Und auch die Aufklärung, die wir natürlich nicht verraten, favorisiert die sozusagen kleinteilige Lösung.
Aber das ist der Grundton, der basso continuo des wohltemperierten Verkäuflichkeitskalküls: Nie ungerecht, nie bösartig, nie sarkastisch auf der „literarischen“ Ebene, auf der es keinen Exzess gibt, kein die-Sau-rauslassen, kein Wahnsinn, kein Stil, keine sprachliche Bearbeitung, keine Brechungen, keine Polyvalenzen, keine V-Effekte. Mit anderen Worten: Keine Kunst, keine Literatur, sondern nur abgesunkener „psychologischer Realismus“ (als ob der literaturhistorisch voraussetzungslos wäre) als relativ glatte, süffige Verkaufsware. Das taugt für Nele Neuhaus & Co., ist aber schade, weil das Konzept von Bettina Raddatz viel radikaler, viel vielversprechender, viel realitätshaltiger ist, als das Buch als Text zu sein sich traut. „Der Spitzenkandidat“ soll Teil einer Trilogie sein, vielleicht kann aus dem ganzen Projekt ja noch was richtig Großes werden.

Gregor Weber
Soldaten wohnen …
Bei Gregor Weber liegt der Fall ähnlich und doch spezifisch anders. Der als Schauspieler bekannt gewordene Weber (als erster „Stephan“ in der grandiosen „Familie Heinz Becker, dann als TATORT-Kommissar beim SR) hatte vor einiger Zeit nicht nur mich in seinem vehementen Buch übers Kochen, („Kochen ist Krieg“) mit Sachkompetenz und Intelligenz überzeugt. Jetzt also ein Kriminalroman. Kochen war damals Top-Thema, heute sind es Krimis, also ist man zunächst einmal vorsichtig und wittert Konjunkturrittertum, zumindest tendenziell. Aber immerhin hat die – unkonjunkturell a-regional in einer fiktiven südwestdeutschen Mittelstadt angesiedelte Geschichte – ein paar sehr handfeste politische Züge. Ein zum Krüppel gewordener, drogensüchtiger Afghanistanveteran, der heruntergekommen in einer Assi-Platte haust, dealt und best friends mit der örtlichen hochkriminellen Rockergang ist, wird ermordet. Die Polizei muss u.a. in Bundeswehrkreisen ermitteln, und die machen erst einmal dicht. D.h. nicht „die Bundeswehr“, so einfältig zieht Weber seinen Stoff nicht auf, sondern eine Fraktion innerhalb der Truppe. Schlussendlich verknoten sich auch bei Weber eine Menge unschönen Aspekte des heutigen Lebens, inklusive ein paar dito unschöner Bilder aus Afghanistan, die vermutlich nur deswegen schocken können, weil sich die deutsche Öffentlichkeit demonstrativ nicht dafür interessiert, was Krieg ist und was Krieg macht – selbst wenn er ein „guter Krieg“ wäre, was Weber erfreulicherweise nicht zum Thema seines Buches erhebt.
Die großen Vorzüge des Romans liegen darin, dass Weber seinen Gegenstand – den Kriminalroman – ernst nimmt. Er macht sich die Mühe, Polizeiarbeit, deren Verzahnung mit der Staatsanwaltschaft und die verschiedenen Kompetenzen verschiedener Polizeien ernst zu nehmen, und aus diesen realen Verhältnissen erzählerische Funken zu schlagen. Ein Prinzip, was ja im Deutschgrimmi angeblich nicht geht, wenn man der üblichen Parolen schlechter Autoren („Realistische Polizeiarbeit zu schildern, wäre langweilig“) folgen möchte. Natürlich geht es nur dann nicht, wenn man es nicht kann; Weber kann es und schreibt damit die Pieke-Biermann-Norbert-Horst-Linie der deutschen Kriminalliteratur erfolgreich weiter. Das ist der eine Aspekt.
http://www.youtube.com/watch?v=1v-ydlqlgBo
Kein Schock nirgends …
Andererseits haben der soap-effect (soap bedeutet nicht automatisch Romane mit derselben Hauptfigur, cf. Maigret) und die Privatleben-Stränge der Kommissare vieler TATORTE auch bei Weber ungute Konsequenzen. Allzu gemütlich ausufernd die detailfreudige Beschreibung des Familien- und Innenlebens seiner Polizisten. Daran kann der an sich lobenswerte Kniff, dass Webers Hauptfigur Grewe ein extrem glückliches und zufriedenes Familienleben hat, nichts ändern. Zu bräsig, zu behaglich das Schwelgen in den mittelständischen, beamtenbesoldungsgesicherten Werten und Lebenswelten, zu unfunktional und langatmig die Schilderungen von Schulgebäuden der Kids und vor allem: Die ewigen Wiederholungen. Wir hören gebetsmühlenhaft, wie zufrieden Grewe mit der Gattin ist, wie toll er mit seiner Mitarbeiterin Therese klar kommt, wie prächtig die Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft ist. So behaglich, schmusig und knuddelnett war Krimi an solchen Stellen selten, obwohl doch das Buch über unbehagliche Realitäten erzählen will. Das in dieser Konstellation erwartbare Kontrasterlebnis (hie Realität – hie Gegenbildlichkeit), der produktive Choque (im Benjamin´schen Sinn), findet nicht statt – alles ist auf Fortsetzung, auf Serie, auf Wiederholung, auf Schlotzigkeit gestrickt. Weber riskiert nichts (oder man lässt ihn nichts riskieren), weil Risiko einer vermuteten Verkäuflichkeitserwägung im Weg stehen würde. Wie bei Bettina Raddatz ist das schade, denn Weber ist – wie es so schön heißt – vielversprechend.
Tappen im Nebel …
Beide im Grunde sehr sympathische Romane leiden unter deutlich literarturfernen Problemen. Beide sollen Krimis sein, solcherart wie man zurzeit meint, dass Krimis sein müssten. Abverkäuflich und möglichst ohne Barrieren für das schlichteste Lesegemüt. Meiner Erfahrung nach passiert die Nivellierung und Standardisierung, das Zurichten für einen vermuteten Massengeschmack nicht unbedingt bewusst, sondern einfach durch Reflexionslosigkeit, Unkenntnis der ästhetischen Möglichkeiten des Genres und der Literatur en general und wegen pawlowschem Reagierens auf den schlichtesten Reiz: Was einmal gut gegangen ist, wird immer wieder repetiert.
Die Verlagskalküle positionieren den „Krimi“ da, wo er schon lange nicht mehr ist. Grimmi soll unbedeutend, sprachlich unbedarft, intellektuell schlicht und für jedes Leserherzchen zum Liebhaben und Kaufen sein. Dass er damit sowohl als „Literatur“ erledigt ist und gleichzeitig als „Gegen-Literatur“ nicht ernst genommen werden muss und als Grimmi/Mimmi-Geblödel oder als ambitionierter Unfug mit Literaturverdachtsfaktor (Zoran Dvrenkar, Stefen Kiesebye) als drittem Weg in die Belanglosigkeit entsorgt werden kann, stört niemanden. Und freut die Sachwalter des immer noch Guten, Schönen & Wahren, der Hochliteratur. Kriminalromane saublöd zu finden, ist die einfachste Übung der Welt, weil die Durchschnittsproduktion saublöd ist und die meisten publizistischen und marketingmäßigen Kontexte und Flankierungen von Kriminalliteratur es dito sind. Daraus entsteht besonders für die deutsche Produktion ein eher ungünstiges Milieu und Klima. Die ausländische Produktion ist ja durch die jeweiligen nationalen Rezeptionen vermeintlich abgesichert und verlangt nach keinem eigenen Urteil der deutschen Programmmacher. Wenn die New York Times genickt oder applaudiert hat, dann entfällt, anders als beim deutschen O-Manuskript, die eigene Urteilsbildung. Da kann dann nichts schiefgehen, meint man; während der deutsche Text erst einmal auf die meistens nicht sehr sinnvollen Parameter der deutschen Verlagsbürokratien zurechtgeschnitzt werden. Der vorauseilende Gehorsam vieler Autoren tut ein Übriges. Wobei es letztendlich nicht darum geht, wie die Anteile an der Misere nun genau verteilt sind.
… und dennoch!
Gregor Weber und Bettina Raddatz und eine Reihe anderer könnten also vermutlich beruhigt gute und wichtige Kriminalromane vorlegen, wenn die Verlage kapieren würden, dass man auch mit guter Literatur richtig Geld verdienen kann. Denn möglicherweise kaufen viele, viele Leute auch exzellente Bücher und lassen sich von Qualität gar nicht stören. Damit wäre allen geholfen.
Thomas Wörtche
Bettina Raddatz: Der Spitzenkandidat. Roman. Wien: Braumüller 2011. 428 Seiten. 19,95 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.
Gregor Weber: Feindberührung. Roman. München: Knaus 2011. 384 Seiten. 17,99 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.












