67 statt 68
 67 statt 68: für einen erweiterten Begriff der Politik.
67 statt 68: für einen erweiterten Begriff der Politik.
Zu 68 gibt es nichts mehr zu sagen. Aus dem „Ereignis“ ist wahlweise ein „Gegenstand der Geschichtswissenschaft“ oder ein „Mythos“ geworden; die Übertreibungen sind zurückgenommen, die Irrtümer korrigiert. Vielleicht aber hat schon 68 selbst, nicht erst seine Nachgeschichte, einen seinerzeit entwickelten Begriff der Politik wieder verkürzt, indem es die radikalen Experimente in Kunst, Alltag und Theorie aus dem Feld des Politischen ausgrenzte, zu dem sie 1967 noch gehörten. Dieses Buch (re)konstruiert daher einen Zusammenhang von literarischen und theoretischen Texten, von Popmusik, Filmen, Aktionen und Grammatologie aus dem Jahr 1967 und schlägt vor, daraus eine alternative Chiffre abzuleiten: 67 als „Sondierung der Basisstruktur der Sprache“ – und damit als Arbeit an den Grundlagen des Politischen überhaupt.
„Der pedantische Chronist kann sich darauf berufen, dass viele Geschehnisse, die zu 68 gerechnet werden, bereits 1967 stattfanden: etwa die Gründung der Kommune I oder die Erschießung Benno Ohnesorgs (um hier bloß zwei Charlottenburger Ereignisse zu nennen). Es war das Jahr „1967, das wir heute ‚1968‘ nennen“. Vieles hatte sich freilich schon in der ersten Hälfte der 60er-Jahre angebahnt: der Minirock und das Happening, der Vietnamkrieg und die Beatles, nicht zuletzt auch Proteste aus Anlass von Besuchen ausländischer Staatsoberhäupter. „Keiner von denen, die 1968 dabei waren, hat dieses Jahr als Einschnitt begriffen.“
Aus pop- und theoriegeschichtlicher Sicht bietet sich das Jahr 1966 als Scheidemarke an, mit den ersten Songs, welche konzentriertes Zuhören verlangen, und Grundlagentexten des ‚Strukturalismus‘ im damaligen weiteren Sinne, Michel Foucaults Les mots et les choses inbegriffen. Verdichtet aber haben sich diese Impulse 1967.“
Robert Stockhammer: 1967. Pop, Grammatologie und Politik. Wilhelm Fink Verlag
Autor Robert Stockhammer liest im Bonner Buchladen 46 und hier.

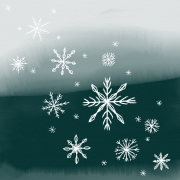


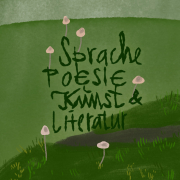
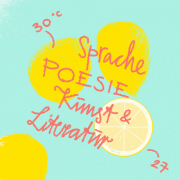
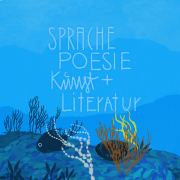
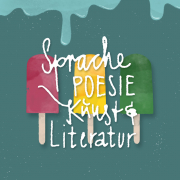
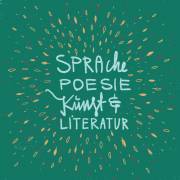
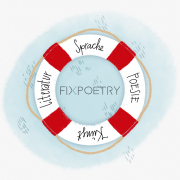
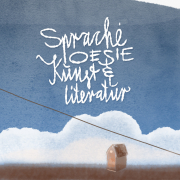
Neuen Kommentar schreiben