Merkur März 2019

Der Newsletter des Merkur (erscheint bei Klett-Cotta) verkündet:
„recht einhellig positiv schienen die ersten Reaktionen auf den von Emmanuel Macron in Auftrag gegebenen Restitutionsbericht von Bénédicte Savoy und Felwine Sarr. Patrick Bahners allerdings macht in seinem Essay über "die Macron-Zentrifuge" auf ein paar Punkte aufmerksam, die daran eher ungereimt sind. Der Ethnologe Werner Krauß begibt sich im EU-Auftrag an die Nordseeküste, zur teilnehmenden Beobachtung des Umgangs der Leute vor Ort mit Klimawandelproblemen. Neue Bücher verkomplizieren alte Geschichten über die Entstehung von Ackerbau und Sesshaftigkeit: Emily Kern erklärt, worum es dabei geht.
In ihrer - frei lesbaren - Soziologiekolumne macht Cornelia Koppetsch auf den blinden Fleck des vermeintlich so aufgeklärten und universalistischen Weltbürgertums aufmerksam: seine eigenen Grenzen und Bedingtheiten nämlich. Friedrich Balke liest die teils unter Pseudonym veröffentlichten Feuilletons des jungen Hans Blumenberg - mit gemischten Gedanken und Gefühlen. Recht hart geht - im zweiten freigeschalteten Text - der Historiker Friedrich Lenger mit der Geschichte des Kapitalismus ins Gericht, die sein Kollege Werner Plumpe verfasst hat: Eurozentrismus und übereifrige Kritik der Kapitalismuskritik lauten die Vorwürfe.
Günter Hack ist EU-Bürger, muss aber feststellen, dass damit weniger Rechte verbunden sind, als wünschenswärt wäre. Alles bestens, alle gleichberechtigt in der Wissenschaft? Von wegen: Hendrikje Schauer über eine Situation, in der Benachteiligungen fortbestehen. Auch alles andere als erfreulich fällt Valentin Groebners Bestandsaufnahme zu den "akademischen Größenverhältnissen" aus. Claudia Basrawi bewegt sich durch Beirut und beobachtet sehr genau die großen und kleinen Unterschiede zwischen den Vierteln. In Robin Detjes Schlusskolumne geht es (unter anderem) ums ubiquitäre Fotografieren.“

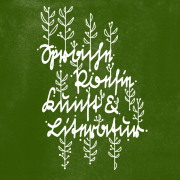


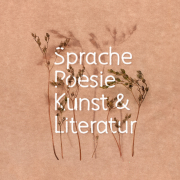

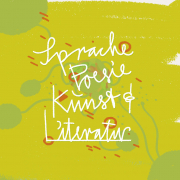
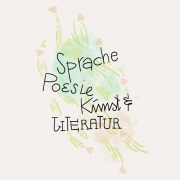
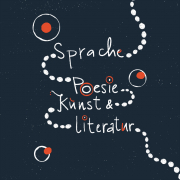

Neuen Kommentar schreiben