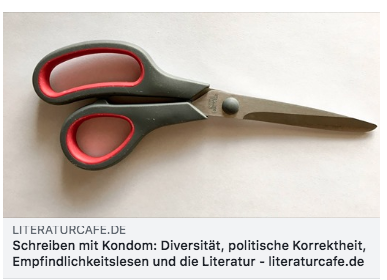 |
| http://bit.ly/Tom-Liehr |
1. Was mit dem Thema "Comedy" und "StandUp" startet, kann der Literatur naturgemäß nicht gerecht werden. Zumal sich ja auch - durchaus gerade von "minoritärer" Seite - Schreib- und Argumentationsweisen eingebürgert haben, die im zielgerichteten Fettnapf-Hopping ganz bewusst "Sensitivity-Crashs" betreiben (re-appropriation / Trotz- und Geusenwort-Strategie).
Da "Literatur" nun mal ein immenser Begriff ist, der in der Perspektive einer flachinformierten Öffentlichkeit (zu denen durchaus auch Bücher-Blogger und Hobby-Rezensenten zählen) alle möglichen Druckwaren inkludiert sind, werden unter diesem Sammelbegriff oftmals auch jenen kleinen Zeitgeist-Romänchen subsumiert, deren Autoren oft Journalisten sind und die in Verlagen wie A…., D…., H…. etc. erscheinen. -
Da "Literatur" nun mal ein immenser Begriff ist, der in der Perspektive einer flachinformierten Öffentlichkeit (zu denen durchaus auch Bücher-Blogger und Hobby-Rezensenten zählen) alle möglichen Druckwaren inkludiert sind, werden unter diesem Sammelbegriff oftmals auch jenen kleinen Zeitgeist-Romänchen subsumiert, deren Autoren oft Journalisten sind und die in Verlagen wie A…., D…., H…. etc. erscheinen. -
Literatur dahingegen, die einer großen Tradition sich verpflichtet fühlt - nämlich jener der poetischen Wahrheit - vermag sich mittels der Kraft ihrer Sprache auch jenseits der "sensitiven Begriffe" auszudrücken.
2. Da es derzeit etliche Intellektuelle und sogar Literaturwissenschafter gibt, die lieber mit krassen Sagen provozieren als mit differenzierter Sprache komplexe Sachverhalte zu kommunizieren, gerät der Wert von "Komplexität" und damit auch jener von "Diversität" ins Hintertreffen. Wir haben es - wie ja auch der Artikel zeigt - mit einem #Backlash in Literatur und Literaturwissenschaft zu tun.
Ungewollt witzig schlägt allerdings in Liehrs Artikel zu Buche, in welchem Ausmaß diejenigen, die verletzende Begriffe benutzen, sich selbst verletzt zeigen, wenn es Einspruch seitens der Betroffenen gibt. Strukturell also eine Täter-Opfer-Umkehr, wie sie derzeit gerade auf Seiten diverser Illiberalismen strategisch und rhetorisch äußerst "angesagt" ist.
3. Was mich interessiert, ist Folgendes: Ist die political correctly angeblich erzwungene Rücksichtnahme auf "Randgruppen" (wie Frauen, *grins*) nicht das eigentliche und aktuelle "èpater le bourgeois", nämlich der Stachel im Fleisch des weißen, heteronormen, christlichen und mittelständischen Cis-Mannes?!
4. Illiberalismus allerdings ist kein Privileg des straight white old man, sondern wird von jenen Subkulturen, die lautstark ihre gesellschaftliche Akzeptanz einfordern, in oft hohem Maße selbst betrieben. Dies gilt für religiöse, ideelle, ethnische, nationale, usw. Minderheiten, für Frauen, FeministInnen, Kunstschaffende, Menschen mit Behinderung, SeniorInnen, Steuerzahler, AllergikerInnen, LinkshänderInnen, Adipöse, ... kurz: Für jede/n einzelne/n von uns.
Nur hier können wir ansetzen - bei uns selbst -, indem wir mit der in der Titel-Illustration polemisch abgebildeten Schere an uns selbst arbeiten: Und zwar weniger im Sinne der von dem Bild implizierten "Zensur", sondern, indem wir Gärtner unserer selbst werden und die unproduktiven Affekte wie Ressentiment, Abwehr, Neid und Hass "ausgeizen".
Wer diesen Selbst-Imperativ im Sinne von Pico della Mirandolas "Würde des Menschen" versteht statt in der Manier der "Consumers for Christ" (Terry Gilliam), kann erkennen, wie viel zu tun ist und arbeitet, statt zu schreien.
5. Der Blick auf den Pöbeldiskurs in den (A)Sozielen Medien erweist, dass die, die sich dort glauben beweisen zu müssen, im realen Leben und in ihrem Werk diskursiv oft wenig voranbringen.
2. Da es derzeit etliche Intellektuelle und sogar Literaturwissenschafter gibt, die lieber mit krassen Sagen provozieren als mit differenzierter Sprache komplexe Sachverhalte zu kommunizieren, gerät der Wert von "Komplexität" und damit auch jener von "Diversität" ins Hintertreffen. Wir haben es - wie ja auch der Artikel zeigt - mit einem #Backlash in Literatur und Literaturwissenschaft zu tun.
Ungewollt witzig schlägt allerdings in Liehrs Artikel zu Buche, in welchem Ausmaß diejenigen, die verletzende Begriffe benutzen, sich selbst verletzt zeigen, wenn es Einspruch seitens der Betroffenen gibt. Strukturell also eine Täter-Opfer-Umkehr, wie sie derzeit gerade auf Seiten diverser Illiberalismen strategisch und rhetorisch äußerst "angesagt" ist.
3. Was mich interessiert, ist Folgendes: Ist die political correctly angeblich erzwungene Rücksichtnahme auf "Randgruppen" (wie Frauen, *grins*) nicht das eigentliche und aktuelle "èpater le bourgeois", nämlich der Stachel im Fleisch des weißen, heteronormen, christlichen und mittelständischen Cis-Mannes?!
4. Illiberalismus allerdings ist kein Privileg des straight white old man, sondern wird von jenen Subkulturen, die lautstark ihre gesellschaftliche Akzeptanz einfordern, in oft hohem Maße selbst betrieben. Dies gilt für religiöse, ideelle, ethnische, nationale, usw. Minderheiten, für Frauen, FeministInnen, Kunstschaffende, Menschen mit Behinderung, SeniorInnen, Steuerzahler, AllergikerInnen, LinkshänderInnen, Adipöse, ... kurz: Für jede/n einzelne/n von uns.
Nur hier können wir ansetzen - bei uns selbst -, indem wir mit der in der Titel-Illustration polemisch abgebildeten Schere an uns selbst arbeiten: Und zwar weniger im Sinne der von dem Bild implizierten "Zensur", sondern, indem wir Gärtner unserer selbst werden und die unproduktiven Affekte wie Ressentiment, Abwehr, Neid und Hass "ausgeizen".
Wer diesen Selbst-Imperativ im Sinne von Pico della Mirandolas "Würde des Menschen" versteht statt in der Manier der "Consumers for Christ" (Terry Gilliam), kann erkennen, wie viel zu tun ist und arbeitet, statt zu schreien.
5. Der Blick auf den Pöbeldiskurs in den (A)Sozielen Medien erweist, dass die, die sich dort glauben beweisen zu müssen, im realen Leben und in ihrem Werk diskursiv oft wenig voranbringen.