Musikmaschinen
 Interessantes aus dem Vergangenheitsverlag: Peter Donhauser - Musikmaschinen. Die Geschichte der Elektromusik.
Interessantes aus dem Vergangenheitsverlag: Peter Donhauser - Musikmaschinen. Die Geschichte der Elektromusik.
„Elektrische Instrumente sind die Verabschiedung von der Tradition des 19. Jahrhunderts“, so 1940 Curt Sachs, der Begründer der wissenschaftlichen Musikinstrumentenkunde. Tatsächlich konnte Sachs nicht ahnen, wie weitgehend sich die Musikwelt nach Ende des Zweiten Weltkriegs verändern würde. „Musique concrète“, elektronische Studios und die Nutzung elektronischer Instrumente in der Popularmusik eröffneten nicht nur unerwartete Möglichkeiten für Komponisten und neue Zuhörerschichten, sondern auch ungeahnte kommerzielle Perspektiven. Heute spannt sich das Feld elektronischer Musik zwischen experimentellen Produktionen über Elektropop und Techno bis hin zu massenproduzierter Kommerzmusik mit elektronischen Instrumenten.
Wer E-Musik verstehen will, muss ihre Entwicklungsgeschichte kennen. Das Buch gibt einen Überblick über 120 Jahre Elektromusik im Kontext von Technik, Kultur, Gesellschaft. Und wird fürderhin so etwas wie das Standardwerk zur E-Musik mit zahlreichen Abbildungen, mit Verweisen auf weiterführende Forschung und einem Überblick zur Sekundärliteratur.
Ein Blick auf das Inhaltsverzeichnis:
Wie alles begann: Die Pionierzeit bis 1930
1.1 Einführung
1.2 Die ersten Versuche
1.3 Neue Ideen für neue Klänge
1.3.1 Die ersten elektrooptischen Instrumente
1.3.2 Die ersten rein elektronischen Instrumente
1.3.3 Sinustöne und Sägezahnschwingungen
Neue Institute, neue Ideen: 1930 bis 1945
2.1 Einführung
2.2 Zwei Institutsgründungen in Berlin
2.2.1 Das Heinrich-Hertz-Institut
2.2.2 Die Rundfunkversuchsstelle
2.2.3 Die Arbeit an „Elektrischen Instrumenten“
am Heinrich-Hertz-Institut
2.2.4 Vierlings Elektrochord
2.2.5 Der Neo-Bechstein Flügel
2.2.6 Die Entwicklung des Trautoniums
2.3 Elektrische Instrumente auf den Berliner Funkausstellungen
2.3.1 Die Funkausstellung 1931
2.3.2 Die Funkausstellung 1932
2.3.3 Die Funkausstellung 1933
2.4 Elektrische Instrumente und der Nationalsozialismus
2.4.1 Das Trautonium wird etabliert
2.4.2 Massenveranstaltungen und die „Elektrische Musik“
2.4.3 Das Phänomen „Orgel im Nationalsozialismus“
2.4.3.1 Die „KdF Großtonorgel“
2.3.4.2 Die Welte Lichttonorgel
Die „Elektronische Musik“ entsteht neu: 1945 bis heute
3.1 Innovation und Widerstand - Patente zu „Flying spot scannern“
3.2 Neue musikalische Ausdrucksformen - Beispiele früher Kompositionen für elektronische Instrumente 3.2.1 Pierre Schaeffer und die „Musique concrète“
3.2.2 Meyer-Eppler und die „elektronische Musik“
Interviews mit Harald Genzmer
3.2.3 Gravesano
3.2.4 Elektronische Studios
3.2.4.1 Das Studio für elektronische Musik des WDR
3.2.4.2 Das Siemens-Studio für elektronische Musik in München
3.2.4.3 Das Studio für experimentelle Klangerzeugung des RFZ Berlin
3.2.5 Beispiele aus den USA
3.2.5.1 Das Manhattan Research Project
3.2.5.2 Das San Francisco Tape Music Center
3.2.5.3 Das New York Columbia-Priceton-Electronic-Music-Center (CPEMC)
3.3 Neue elektronische Instrumente
3.3.1 Alte Ideen im neuen Gewand
3.3.1.1 Wurlitzer und Fender-Rhodes Pianos
3.3.1.2 „Geborgte“ Klänge
3.3.1.3 Beispiele weiterer elektronischer Spielinstrumente
3.3.1.4 Freie Konstruktion von Schwingungsformen
3.3.2 Der Synthesizer und seine zahllosen Varianten
3.3.3 Klangkunst
3.4 Oskar Sala – ein Berliner Urgestein
3.4.1 Salas Instrumente
3.4.2 Sala als Interpret, Komponist und Prominenter
3.4.3 Sala als Musiker
3.4.4 Instrumente mit subharmonischen Mixturen nach dem Vorbild Salas
3.5 Der Weg zur elektronischen Popmusik
3.5.1 Tangerine Dream
3.5.2 Kraftwerk
3.6 Elektronische Musik und Gesellschaft
3.6.1 Rezeption vor 1950
3.6.2 Populare versus akademische Kultur nach 1950

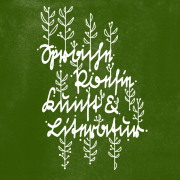


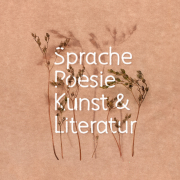

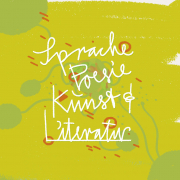
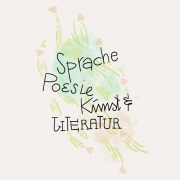
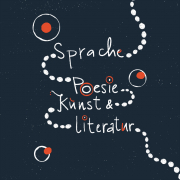

Neuen Kommentar schreiben