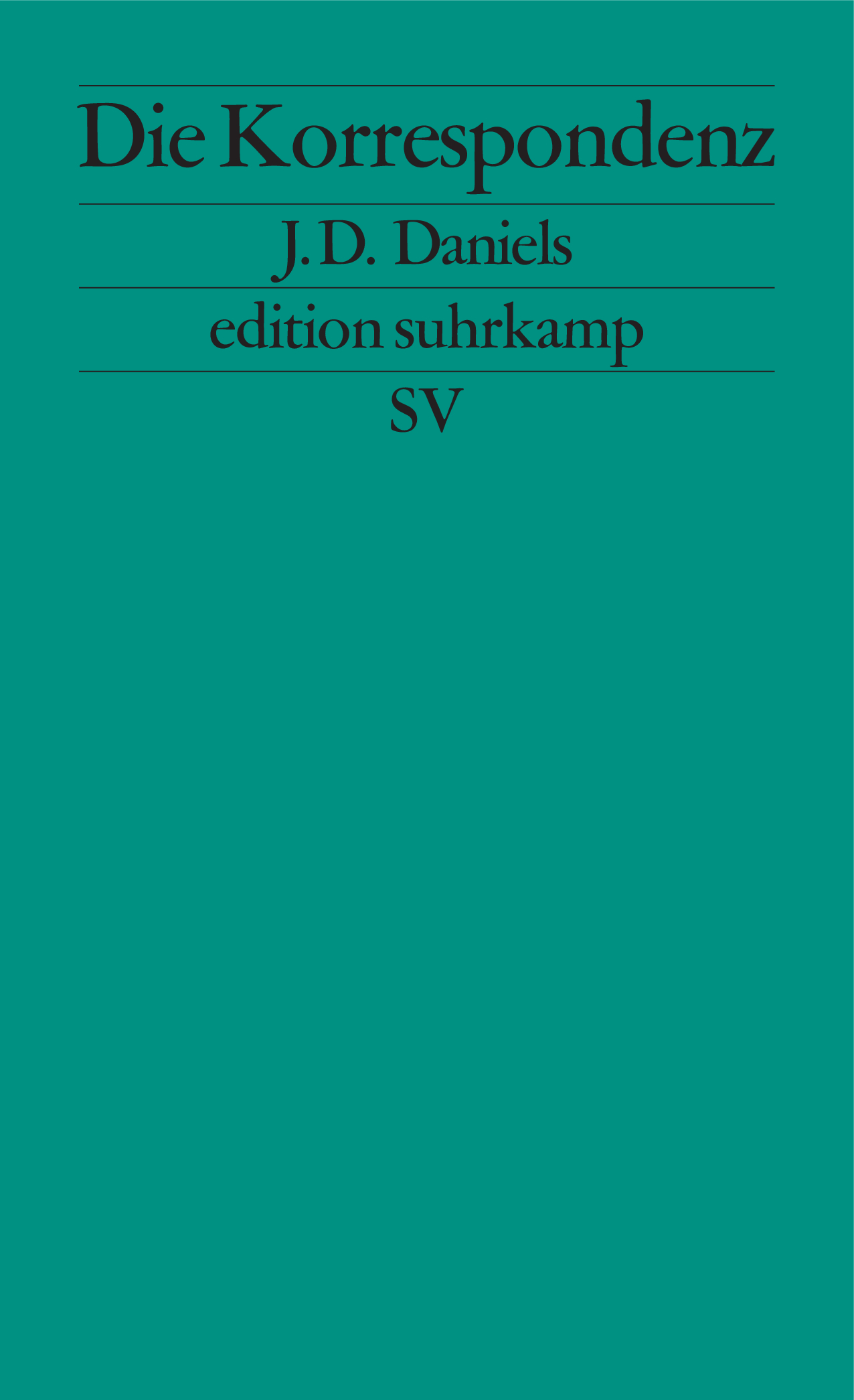 J.D. Daniels: Die Korrespondenz, übersetzt.
J.D. Daniels: Die Korrespondenz, übersetzt.
Blind John, still dripping rain from his trip to the ATM, offered me a hundred dollars to let him go down on me. “I think you’re in the wrong bar,” I said. “Maybe you are,” he said.
Hier das Beispiel einer diskreten Übersetzung. Die deutsche Ausgabe von J.D. Daniels Essay-Band „Die Korrespondenz“ überträgt den Austausch in einer Bar wie folgt:
In dieser Bar bot mir Blind John, noch regennaß vom Gang zum Geldautomaten, hundert Dollar an, wenn ich mit ihm ins Bett ginge.
„Du bist wohl in der falschen Bar gelandet“, sagte ich.
„Oder du“, sagte er.
(Die Gediegenheit mancher Übersetzer kennt keine Grenzen.)
Ihr könnt nicht immer „Sex haben“ schreiben“, mahnte unser Lektor, als mein Kollege und ich mit ihm das Manuskript einer Romanübersetzung durchgingen, in dem die (amerikanischen) Figuren allerdings sehr viel Sex hatten. – „’Sex haben’ ist ein Amerikanismus. Es gibt im Deutschen genügend andere Begriffe, „vögeln“ oder „ficken“ oder „miteinander ins Bett gehen“, zum Beispiel…“
Das alles ist 20 Jahre her. Ob man in kultivierten deutschen Übersetzungen heute noch immer keinen „Sex hat“? Anderseits brauchte man noch nie ein Bett, um einem Mann hinter einer Kneipe einen zu blasen, und zu nicht mehr und nicht weniger möchte Blind John den Ich-Erzähler ja überreden. 100 Dollar fand ich übrigens einen steilen Preis. Aber was weiß ich schon. Und dass in J.D. Daniels Essay-Kunst maximale Vielfältigkeit herrscht, und dass in jeder Übersetzung notwendig der eine oder andere Aspekt dieses Originals untern Tisch fallen wird, darauf sollte man sich einstellen (darauf hatte ich mich auch schon eingestellt).
J.D. Daniels, geboren 1974, erhielt 2016 mit dem Whiting Award einen hoch dotierten Preis für Nachwuchsautoren, eine Art Adelsschlag der Szene. Ein Buch musste her, nicht ganz einfach, wenn einer sich vor allem mit Essays in Literaturzeitschriften einen Namen gemacht hat. Essays waren zwar nicht das, womit J.D. Daniels eigentlich groß rauskommen wollte, das Genre scheint ihm nach langem Streben und Scheitern versehentlich, glücksvoll zugefallen zu sein. (Wo ist das Interview, in dem Daniels das alles erzählt? Es war im Netz, jetzt ist es weg.) Unter dem Titel „The Correspondence“ sind 2017 beim US-Verlag Farrar Straus & Giroux sechs Texte von Daniels erschienen, allesamt ursprünglich in The Paris Review herausgekommen, vier davon in der „Letters“-Rubrik der Zeitschrift, in der auch weitere hervorragende Essayisten veröffentlichen. Das Cover-Design ist Retro, angelehnt an stumpf-pappige Kontor-Bücher; die deutsche Übersetzung, ein schlichteres grünes Taschenbuch der Edition Suhrkamp, erschien fast zeitgleich mit dem Original.
 Und ich hatte mich so gefreut! J.D. Daniels ist brillant, ich hatte schon Gelegenheit, darauf hinzuweisen. Aber zwischen seinen hübschen Buchdeckeln ist „The Correspondence“ ein wenig enttäuschend. Von den vier Essays ist einer – „Letter from Kentucky“ („Brief aus Kentucky“) – sensationell, einer – „Letter from Majorca“ („Brief aus Mallorca“) semi-sensationell, und die beiden andern wirken (vielleicht zwangsläufig) wie Aufwärmübungen zur Meisterschaft. Zwei weitere Texte sind gar keine Essays, sondern Kurzgeschichten, was im Buch vorne ausdrücklich vermerkt wird. Auch diese Texte erschienen zuerst in The Paris Review, allerdings unter ganz normalen Kurzgeschichten-Titeln, erst im neuen Kontext definieren sie sich als Brief. („Empathy“ heißt jetzt „Brief aus Ebene Vier“.) Schwammig wird damit zuallererst die Frage der Ansprache. Denn Essays können durchaus Briefcharakter haben, ihre Ansprache ist immer direkt, in your face, doch wen adressiert die Kurzgeschichte? Abgesehen vom universalen Leser, den wir alle, immer, für uns gewinnen wollen?
Und ich hatte mich so gefreut! J.D. Daniels ist brillant, ich hatte schon Gelegenheit, darauf hinzuweisen. Aber zwischen seinen hübschen Buchdeckeln ist „The Correspondence“ ein wenig enttäuschend. Von den vier Essays ist einer – „Letter from Kentucky“ („Brief aus Kentucky“) – sensationell, einer – „Letter from Majorca“ („Brief aus Mallorca“) semi-sensationell, und die beiden andern wirken (vielleicht zwangsläufig) wie Aufwärmübungen zur Meisterschaft. Zwei weitere Texte sind gar keine Essays, sondern Kurzgeschichten, was im Buch vorne ausdrücklich vermerkt wird. Auch diese Texte erschienen zuerst in The Paris Review, allerdings unter ganz normalen Kurzgeschichten-Titeln, erst im neuen Kontext definieren sie sich als Brief. („Empathy“ heißt jetzt „Brief aus Ebene Vier“.) Schwammig wird damit zuallererst die Frage der Ansprache. Denn Essays können durchaus Briefcharakter haben, ihre Ansprache ist immer direkt, in your face, doch wen adressiert die Kurzgeschichte? Abgesehen vom universalen Leser, den wir alle, immer, für uns gewinnen wollen?
Für die Meisterschaft (Daniels’, nämlich) lohnt es sich dennoch, die Korrespondenz zu kaufen, „The Correspondence“ zu lesen. Vor allem „Brief aus Kentucky“ (aus dem auch das Eingangszitat stammt) ist ein essayistischer Geniestreich – ein Drahtseilakt, der den Autor hoch über uns auf dem Einrad zeigt, mit bunten Glitzerbällen jonglierend. Welches Gleichgewicht, welche Balance! Und dann die Bälle selbst: Bibelsprache und Kindheitserinnerungen, Ladenschilder und Bar-Talk, der überlebensgroße Vater, die Slacker-Freunde und dazwischen immer wieder ein Prediger im Autoradio. Selbstverständlich trägt der Artist auf dem Hochseil auch eine Clowns-Nase. Denn Daniels erzählt zwar von der Art, wie eine Rückkehr in die Heimat einen gleichermaßen mit Sehnsucht und Wut und Trauer erfüllen kann – doch hat er keinesfalls vor, über diesem Befund unnötig rührselig zu werden. Im Gegenteil.
I flew back to Kentucky on a cold spring day aboard a paper airplane that every sneeze of wind knocked sideways. Next time I’ll swim. Everyone hates flying. Even birds hate flying.
Und auch das fällt in der Übersetzung unterm Tisch: Mit Stand-Up hat es die deutsche Version nicht so. Die Wortwiederholung im Englischen mag zwar ein billiger Effekt sein, aber die Passage würde an jedem Comedy Club-Mikrophon funktionieren. Nicht so im Deutschen:
Ich kehrte an einem kalten Frühlingstag nach Kentucky zurück, an Bord eines Papierflugzeugs, das bei jedem Windstoß seitwärts hüpfte. Beim nächsten Mal werde ich schwimmen. Fliegen ist unnatürlich. Selbst die Vögel mögen es nicht.
Der Zufall will es nun, dass Daniels, wenn er seinen Wurzeln in Kentucky nachgeht, auch auf eine Welt blickt, deren bis vor kurzem wenig beachteter Niedergang (Thoreaus „quiet desperation“) den Aufstieg eines President Trump begünstigt hat. Klassenfragen, Klassengeschichten spielen in seinen essayistischen Darlegungen eine zentrale Rolle. Teils liegt das am Zufall von Daniels’ Geburt, teils am Genre seines literarischen Unterfangens. Beispiel: Es gibt nicht allzu viele angesagte US-Jungautoren, deren halbe männliche Verwandtschaft zur Armee ging, weil ihnen nichts Besseres einfiel (und die Hälfte flog dann dort wieder raus). Es gibt noch weniger, die mit essayistisch-masochistischer Lust nach solchem Katzengold Ausschau halten. Und ja, Daniels nutzt die Comedy-Momente, die er in seinem Herkunfts-(und Aufbruchs-)Biotop findet, aber eine abschließende Wertung trifft er nie, und auch das macht seinen Blick wertvoll. Natürlich ist dieser Blick inszeniert. (Essays sind immer Inszenierungen.) Billige Witze gehören dazu, Derbheiten auch, im Deutschen weiterhin gerne geglättet, wie der Dödel des Vaters, der hier zum Popo wird:
“It’s my own dick I’m talking about, and I can jump up and down on it like a pogo stick if I want to.”
„Mein Hintern gehört mir, und um den geht’s ja, und auf dem kann ich rumhüpfen wie auf einem Pogo Stick, wenn’s mir passt.“
(Macht das überhaupt Sinn, dieses Hüpfen auf dem Hintern wie auf einem Sprungstab? Mehr Sinn, meine ich, als der Spruch des Vaters im Original?)
Was die Figur des Vaters angeht, wiederkehrend in vielen Daniels-Essays, so wirkt der cholerische Vietnam-Veteran, „der Menschenfresser meiner Kindertage“, in seiner Rolle als Familienoberhaupt kaum besser aufgehoben als der Sohn ein halbes Jahrhundert später inmitten ehrgeiziger Schreibtalente in Boston. Der Vater ist es aber auch, der den Sprössling ständig anhält, mehr aus sich zu machen. „Werde bloß nicht wie ich“, sagt er in „Technical Difficulty“, einem weiteren perfekten Essay, der bereits 2004 erschien. Und Daniels dazu: „Natürlich wollte ich werden wie er. Das will doch jeder Junge. Aber ich gab diesen Wunsch für ihn auf, ich gewann ein Stipendium und besuchte das State College…“
 In „Brief aus Kentucky“ stehen dann die posttraumatischen Seiten des Erzeugers im Vordergrund:
In „Brief aus Kentucky“ stehen dann die posttraumatischen Seiten des Erzeugers im Vordergrund:
Er wollte mich vor der Dunkelheit bewahren, das uns alle umgibt, und bediente sich dafür der Dunkelheit in seinem Inneren. All diese Dunkelheiten mussten doch schließlich zu irgendetwas gut sein, oder nicht? Das ist doch der Sinn der Finsternisse, nicht wahr? – und nicht etwa nur, ihn selbst zu peinigen, und mit ihm als ihrem Werkzeug, jeden, den er liebte?
Im Original folgt nun einer jener sprunghaften Ebenenwechsel, die Daniels’ Essayistik so aufregend machen. „Technical Difficulty“ etwa changiert unablässig zwischen Anekdoten aus Thomas Manns Welt, dem eigenen Elternhaus, und der literarischen Szene in Boston, „Brief aus Mallorca“ denkt quasi parallel über Männer, Goyas Saturn und das Leben auf Schiffen nach, und „Brief aus Kentucky“ wechselt (an der zitierten Stelle) von der Frage der „Finsternisse“ direkt auf eine imaginäre Bühne. Dort begegnen wir dem Ich als Schauspieler, der schon viel zu lange wehklagend im Sterben liegt.
It’s nothing to get upset about, it isn’t even me it happened to, that person died in 1995, he died again in 2003 and again at the beginning of this sentence. He’s been dying for most of act 5, scene 2. Maybe someone ought to stab him again.
Gleichzeitig effektivsicher, metareflexiv und schamlos überkandidelt, wem könnte das nicht gefallen? Die Passage kommt noch besser, wenn man den Text laut vorliest. Nur in der deutschen Übersetzung nicht – denn die Suhrkamp-Version (und mir will dafür partout kein Grund einfallen) streicht den Absatz ganz.
Brigitte Helbling
J.D. Daniels. Die Korrespondenz (The Correspondence, 2017). Aus dem Englischen von Frank Jakubzik. Suhrkamp Verlag. Berlin 2017. 121 Seiten. 14,40 Euro











