
Bücher kurz serviert
Kurzbesprechungen von fiction und non fiction. Joachim Feldmann (JF), Bodo V. Hechelhammer (BoH), Alf Mayer (AM), Frank Rumpel (rum), Iris Tscharf (IT) und Thomas Wörtche (TW) zu:
Vincent Almendros: Ins Schwarze
Sharon Bolton: Der Schatten des Bösen
Markus Bundi: Alte Bande
Alan Carter: Marlborough Man
Lee Child: Keine Kompromisse
Andreas Eikenroth: Woyzeck
Thomas Harris: Cari Mora
Philipp Leinemann: Das Ende der Wahrheit (Film)
Andy Martin: Reacher Said Nothing
Adrian McKinty: Cold Water
Hollie Overton: The Wife
Benjamin Percy: Green Arrow & Nightwing
Frank Schmolke: Nachts im Paradies
Estelle Surbranche: Nimm mich mit ins Paradies
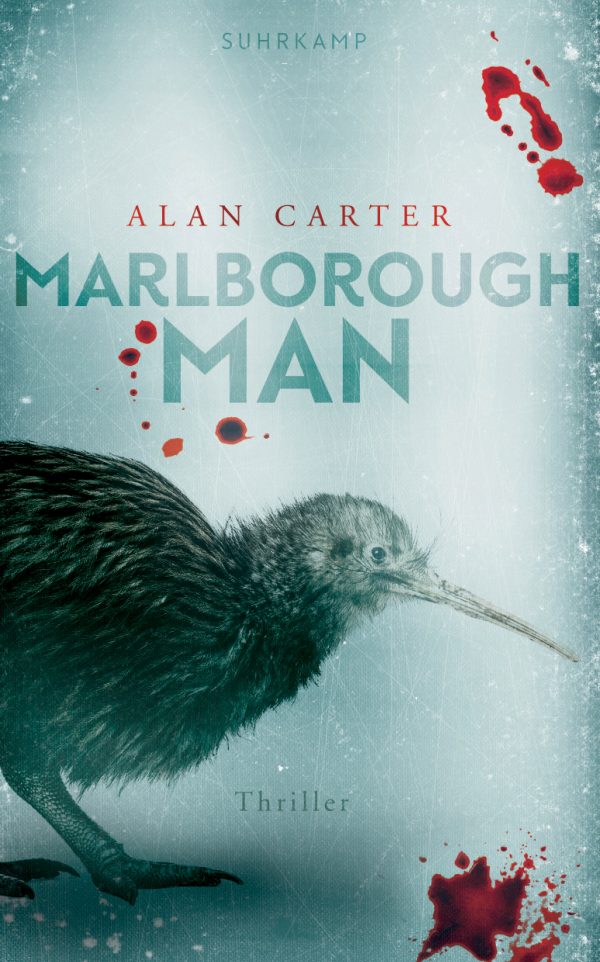
Großes Vergnügen
(JF) Nur ein kurzer Auftritt ist den Brüdern Joachim und Tobias Otto aus Aachen, wenn das denn ihre richtigen Namen sind, vergönnt. Kaum sind sie, stilecht als Outdoor-Touristen samt Wohnmobil ausstaffiert, aufgetaucht, da finden sich die beiden auch schon „zusammengeschnürt wie Truthähne“ dem Spott ihres Gegners ausgeliefert. Denn um den „Marlborough Man“ Nick Chester, der eigentlich anders heißt, zu erledigen, muss man mehr Verstand mitbringen als die zwei Möchtegernkiller aus Deutschland. Chester, im Norden Englands geboren und aufgewachsen, hat es nach Neuseeland verschlagen und das nicht ganz freiwillig. In einem früheren Leben war er als verdeckter Ermittler in seiner Heimat tätig und hat dafür gesorgt, dass ein übler Gangsterboss für ein paar Jahre hinter Gittern verschwinden durfte. Tätigkeiten dieser Art haben Konsequenzen, also musste Chester mit Frau und Kind ans andere Ende der Welt umsiedeln. Nun ist er Polizist in den Marlborough Sounds, einer landschaftlich spektakulären Fjordlandschaft auf der Südinsel Neuseelands. Ruhe allerdings findet er nicht.
Ein sadistischer Serienmörder, der es auf kleine Jungen abgesehen hat, treibt sein Unwesen in der Gegend. Der mächtigste Arbeitgeber der Region, ein Holzunternehmer, setzt alles daran, das ökologische Gleichgewicht aus Profitgründen zu ruinieren. Und Chesters Feinde aus der Heimat wissen, wo er steckt, und lassen nichts unversucht, den Verräter vom Leben zum Tode zu befördern. Zum Glück kann er sich auf seine Partnerin, die Maori Latifa Rapata, verlassen.
Alan Carter, selbst im englischen Northumberland geboren und seit 1991 in Neuseeland und Australien ansässig, bedient in seinem Roman Marlborough Man gleich mehrere Genres, vom Cop-und-Gangster-Epos über den Ethno-Krimi bis zum Serienmörderthriller. Dass ihm dabei keiner der Plotfäden entgleitet, ist gekonntes Handwerk. Und wenn es zu kompliziert werden könnte, greift er, um im Bild zu bleiben, einfach zur Schere. So lässt er die im fernen Britannien geplanten Mordversuche bereits in der Mitte des Romans enden, um sich ganz der Jagd auf den Kindermörder zu widmen. Diese gestaltet sich realistisch zäh, um dann aber, wie es sich für das hier zitierte Genre gehört, in einen furiosen Showdown zu münden. Nicht umsonst hat Carter seinem Helden eine Kleinfamilie zur Seite gestellt.
„Marlborough Man“ dekonstruiert spannungsliterarische Handlungsmuster, ohne deren Unterhaltungswert zu mindern. Und sorgt auf diese Weise, nicht zuletzt aufgrund der gelungenen Übersetzung von Karen Witthuhn, für ein großes Lesevergnügen.
- Alan Carter: Marlborough Man (Marlborough Man, 2017). Thriller. Aus dem Englischen von Karen Witthuhn. Herausgegeben von Thomas Wörtche. Suhrkamp Verlag, Berlin 2019. 382 Seiten, 14,99 Euro.

Manipulation und Macht
(IT) In einem dreckigen Loch in der hinterletzten Ecke Rumäniens zwischen Müll und Alteisen, dürren Bäumen, Elend und Armut fängt der zweite Kriminalroman von Estelle Surbranche an. Für den Leser gibt es ein Wiedersehen mit der serbischen Killerin Nathalie, die schon in „So kam die Nacht“ (Polar Verlag, 2017) skrupellos die Drecksarbeit für ihren serbischen Onkel und Mafioso Radzik erledigte. Dieses Mal geht es um kostbarere Ware als um Drogen, nämlich um menschliche, die möglichst frisch und schnell von Alba nach Schweden transportiert werden soll. Nathalie bekommt seit sechs Monaten solche trostlosen Aufträge an gottverlassenen Orten und muss sich damit abfinden. Noch.
Auch in Toulouse geht es um Menschenleben. Dort wird Capitaine Gabrielle Levasseur, aus Biarritz nach Toulouse versetzt, mit ominösen Selbstmordfällen konfrontiert. Seit sie einem Mörder den Schädel wegpustete, hat sie mit Schlaflosigkeit und depressiven Phasen zu kämpfen. Die Selbstmorde junger Frauen haben alle etwas gemeinsam: Kurz zuvor haben sie noch einen Mann kennengelernt, der ihnen den Märchenprinzen vorgaukelte, bis sie ihm hörig waren und er sie vollends beherrschte. Er manipuliert die Frauen bis in den Tod, und Levasseur weiß, sie muss ihn aufhalten, wenn diese Selbstmordserie ein Ende finden soll. Außerdem lässt ihr Kollege Bonanza ohnehin keine andere Wahl und bedrängt sie, diese Fälle aufzuklären. Denn er hat eine persönliche Rechnung mit dem Täter offen.
Estelle Surbranche zeigt in Nimm mich mit ins Paradies unterschiedliche Arten der Manipulation. Der Schönling, der als vermeintlicher Märchenprinz Frauen bezirzt und sie in den Selbstmord treibt, lebt diese Manipulation und liebt die Macht, die er damit über sie hat. Nathalie wird durch ihren Onkel manipuliert, als Killerin losgeschickt, um Drecksarbeit zu erledigen und um irgendwann seinen Traum – ebenfalls einer der Macht – zu übernehmen. Auch Levasseur ist sich nicht sicher, von ihrem Geliebten, einem baskischen Ex-Terroristen, manipuliert zu werden. Kollege Bonanza manipuliert, um endlich seine Rache zu bekommen. Auch die Nebenstränge triefen von Manipulationen und Machtgehabe. So wehrt sich Samira, Tochter einer tunesischen moslemischen Familie, gegen die Macht ihres Vaters und des strengen Glaubens, auch wenn dies heißt, mit ihrer Familie zu brechen. Im Roman heißt es: „Frauen sind willenlose Wesen. Ihr einziger Wunsch ist es, einen Mann zu finden und sich seinem Willen zu beugen.“
Doch nicht immer beugen sich die Frauen und nicht jede Manipulation ist erfolgreich. Manchmal entkommen sie der Leine, dann wird es auch für Männer eng. Ein Kampf, ein Krieg auf du oder ich. Und wie es in Kriegen so ist: Am Ende gibt es nicht immer Gewinner, sondern nur Verlierer, Verwüstungen und Tote und die Erkenntnis, einer Manipulation aufgesessen zu sein. Diese Botschaft ist gut verpackt in skrupellos unterhaltsame, aber düstere Literatur.
- Estelle Surbranche: Nimm mich mit ins Paradies (Emmène-moi au paradis, 2017). Aus dem Französischen von Cornelia Wend, herausgegeben von Wolfgang Franßen. Polar Verlag, Stuttgart 2019. 350 Seiten, 20 Euro.
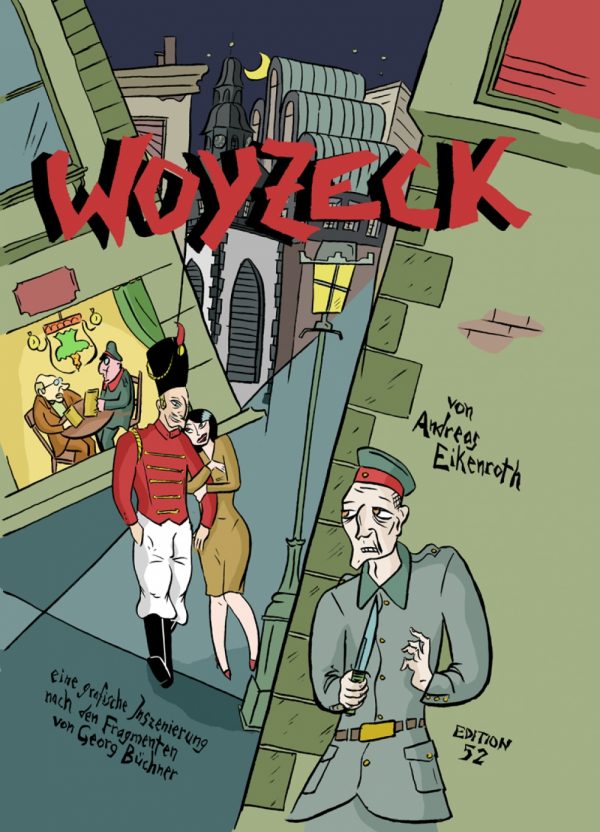
Immer mal wieder: Der Abgrund
(TW) Es wundert einen nicht sehr. „Weimar“ hängt mehr oder weniger in der Luft. Bauhaus, Berlin Babylon, Vicki Baum, Lili Grün und ungezählte andere Narrative, Renaissancen, wohin man blickt. Natürlich waren die 1920er und 1930er (plus/minus) Jahre eine Art Turbokraftwerk der Moderne, das man sich jederzeit noch einmal genauer anschauen sollte, aber genauso hat dieses Interesse, wie vermittelt auch immer, mit dem Aufstieg der Rechten und der Nationalismen zu tun, die einen Hauch von „Weimar“ spüren und fürchten lassen, und sei´s subkutan. Georg Büchners „Woyzeck“-Fragment von 1836 wiederum war eine Lieblingsparadigma jener Jahre, Alban Bergs „Wozzeck“ hatte daran einen gewaltigen Anteil und auf den Theatern gab es „Woyzeck“-Aufführungen in Hülle und Fülle. Der berühmte Abgrund („Jeder Mensch ist ein Abgrund, es schwindelt einem, wenn man hinabsieht“) passte perfekt zum Zeitgeist, ebenso wie die bei Büchner angerissenen Themenfelder: Mord, Wahnsinn, Depravation, Klassengegensätze.
Es ist also nur logisch, wenn der in Gießen („Woyzek“-Land) lebende Comic-Künstler Andreas Eikenroth (einer der eher stillen Großen) seine „Woyzeck“-Adaption bildästhetisch an die 1920er Jahre anlehnt, ganz offen und zitierend: Georg Grosz, Jeanne Mammen, Egon Schiele etc. Durch die knallbunte, sehr heutige Kolorierung entsteht nicht nur eine aufregende innere Spannung auf der Bildebene, sie dient auch als Vektor ins Aktuelle, sagen wir: in unsere eigenen Abgründe der Inhumanität und Skrupellosigkeit, heuchlerischer Moralvorstellungen, Verzweiflung und ökonomischer Verwerfungen. Und, nicht zu unterschätzen: Die fröhlich-giftigen Farben torpedieren eine bestimmte Lesart, eine bestimmte Interpretation der Vorlage.
Ebenfalls grandios und ästhetisch völlig überzeugend ist Eikenroths Idee, die nur schwach konsistente Fragment-Struktur von Büchners unvollendetem Text, nicht in nacherzählende Einzelpanel aufzulösen, sondern in ganzseitige Zeichnungen, mit ineinanderfließen Zeitebenen. So funktioniert jedes der großflächigen Bilder als narrativer Schritt der Handlung und gleichzeitig als autonomes Kunstwerk. Eigentlich bin ich kein großer Freund von „Retro“-Kunst, weil sie meist verzweifelt und erfolglos den Originalen hinterherhechelt. Aber so kreativ wie Eikenroth seine Adaption anlegt, so kann man das machen.
- Andreas Eikenroth: Woyzeck. Eine grafische Inszenierung nach den Fragmenten von Georg Büchner. Edition 52, Wuppertal 2019. 60 Seiten, 15 Euro, als Vorzugsausgabe 35 Euro.
Wildes Taxifahrer-Epos
(AM) Was für ein Ritt, was für ein Timing, was für eine Stimmung und welch erzählerische Lakonie. Als Taxifahrer in München muss man über 6 000 Straßen vor- und rückwärts kennen. Frank Schmolke (Jahrgang 1967, bereits 2013 mit „Trabanten“ aufgefallen) hat über 20 Jahre als „Taxler“ gearbeitet. In seiner Graphic Novel Nachts im Paradies verdichtet er das alles auf drei vogelwilde Nächte während des Oktoberfests.
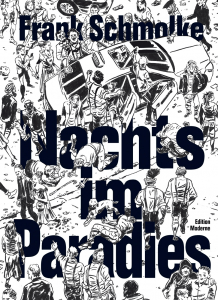
Protagonist ist der Taxifahrer Vincent – nicht sonderlich glücklich in seinem Beruf, auch sonst vom Leben gebeutelt, seine 16-jährige Tochter Anna der einzige Lichtblick. Wir erfahren von den Täxlertricks, wie man den Zombies und Typen in Saufuniform aus dem Weg gehen oder wo man die Wiesen anfahren muss, um keinen vollgekotzten Rücksitz zu bekommen. Und wir selbst kennen die rücksichtslose Eiligkeit gewisser Fahrgäste: „Schneller! Schneller! Mein Flieger geht!“, der Fahrer ist es dann, der mit dem Strafzettel dasteht.

Schmolke erzählt schwarzweiß. Expressiv und immer passgenau. In seinem Nachwort schreibt er: „Zeichnen und Taxifahren haben gewisse Parallelen. Das Suchen einer Fahrtroute ist ähnlich dem Ziehen einer Linie mit dem Stift. Manchmal perfekt und manchmal krakelig. Während der Fahrt füllt sich das Blatt mehr und mehr. Bis zum Ende der Fahrt entsteht so ein Bild des Fahrgastes.“ Nicht weil es dem nachgemacht wäre, sondern weil in der Erzählhaltung ebenso souverän, musste ich öfter an Scorseses Meisterwerk „Taxi Driver“ von 1976 denken: Szenen für die Ewigkeit und perfekt gesetzte Pointen, die Kamera ständig in Bewegung. Für einen bestimmten Moment lässt Schmolke sich Zeit bis Seite 344. In diesem 1132 Gramm schweren Buch ist kein Strich zu viel. Absolut ortskundig geht es durch viele Kurven. Diesem Fahrer würde man im echten Leben gerne ein dickes Trinkgeld geben.
- Frank Schmolke: Nachts im Paradies. Edition Moderne, Zürich 2019. Klappenbroschur, schwarzweiss, Format 19 x 26 cm. 352 Seiten, 29,80 Euro.

Das Grinsen des Horizonts
(AM) Ein Metaroman, der auch als Kriminalroman funktioniert. Oder umgekehrt. Eine zen-buddhistische Meditation, die zwischendurch sehr irdisch und kulinarisch wird. Falsche Schlüsse, die der Laie wegen unzähliger Fernsehkrimis zieht. Menschliche Handlungen, die nicht auf die 64 Felder eines Schachbretts passen. Schnell denken, wenn sich nichts tut. Langsam, sehr langsam, wenn sie die Dinge überschlagen. Des einen Mut ist des anderen Wahrscheinlichkeits-rechnung. Kommissar Walle Troller, Jahrgang 1967, ist wie Maigret oder Columbo ein Menschenkenner und -freund. Die Handlungen der Menschen, weiß er, spielen sich zwischen russischem Roulette und vorgezeichneten Zügen ab. Er schätzt das Denken, das sich im Verborgenen abspielt und unbeobachtet von ihm zu Ergebnissen kommt. Manchmal sieht er deshalb nur einem sich drehenden Teebeutel zu. „Vom Augenaufschlag des Geistes“ lautete der Titel eines Essays, den er zu Studienzeiten unbedingt hatte schreiben wollen, über dessen Titel aber nie hinausgekommen ist.
Wer kann wissen, wie er in einem Dilemma entscheidet? Was hätte man selbst in einem Fall wie der Kindesentführung in Frankfurt und der Androhung von Folter als scheinbar letztem Mittel gemacht? Wie ist es, sich im Graustufenbereich zu bewegen? Robert Musil meinte einst, wenn es einen Realitätssinn gäbe, müsse es ja doch auch einen Möglichkeitssinn geben. Der Schweizer Markus Bundi legt mit Alte Bande im feinen Wiener Septime Verlag seinen ersten umfangreichen – und gleich schon prallvollen – Kriminalroman vor. Eher kennt man ihn als Novellisten und Lyriker. „Ankunft der Seifenblasen“ hieß sein letzter Gedichtband, „Wirklichkeit im Nachsitzen“ oder „Des Möglichen gewärtig“ zwei Essaybände, „Gehen am Ort“ und „Das Grinsen des Horizonts“ „Mann ohne Pflichten“ einer seiner letzten Romane. An Wallers Fall im fiktiven süddeutschen Jedastedt hängt weit mehr als eine Wasserleiche. Mancher Spiegel muss zerbrochen werden, nicht umsonst hat Waller einen Zwillingsbruder. Als wäre es ein Koan, heißt es einmal: „Im Beobachtetwerden die Beobachter beobachten.“ Dann kommen auch noch Raubkunst, die „Paradise Papers“ als Schatzkarten des Staates und staatliche Geldbeschaffung als der Terrorbekämpfung ebenbürtige Aufgabe hinzu. Am Ende aber, um es mit einem Bundi-Titel zu sagen, ist die Schwerkraft wieder im Gleichgewicht.
- Markus Bundi: Alte Bande. Kriminalroman, Septime, Wien 2019. 478 Seiten, 25 Euro.
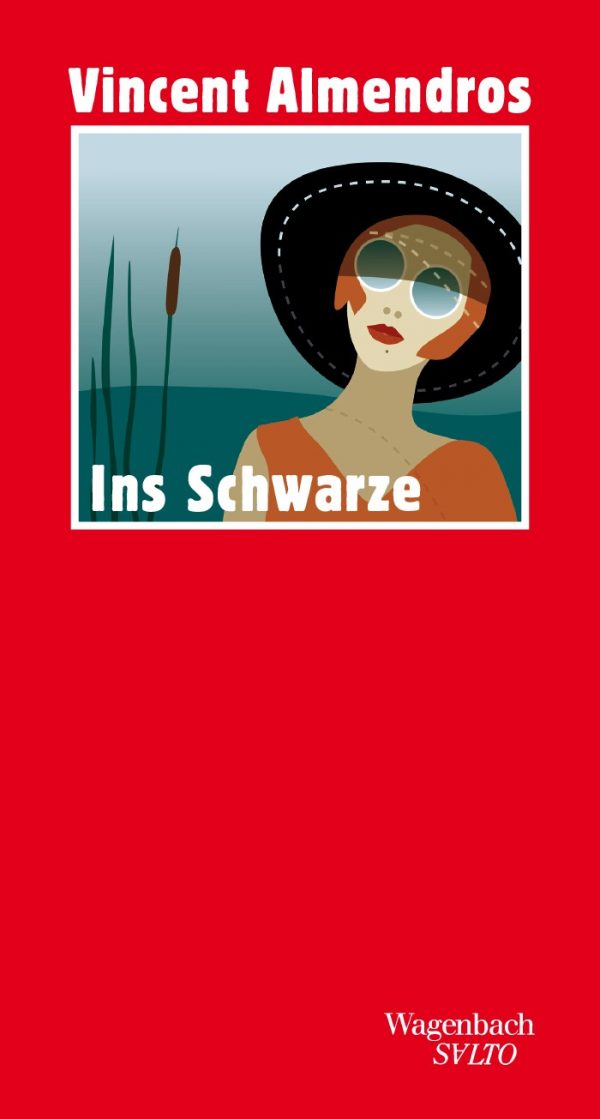
Familiäres Misstrauen
(rum) Abgründe allerorten lauern in Vincent Almendros‘ Erzählung Ins Schwarze. Laurent Malèvre kommt mit seiner Freundin für ein Wochenende in sein Heimatdorf zurück, weil seine Cousine heiratet. Das Dorf ist „ein elendes Kaff“, das der Ich-Erzähler lange Jahre zu vergessen versuchte. „Bisher war ich ein Mann ohne Geschichte gewesen“, sagt er. Doch Erinnerung lassen sich nunmal nicht abschütteln.
Laurent und seine Freundin übernachten im ehemaligen Elternhaus. Sein Vater ist tot, seine Mutter lebt mit seinem Onkel zusammen. Dessen Frau kam bei einem Unfall ums Leben. Laurent begegnet seiner Mutter distanziert, schließlich hat sie ihn mit Chlorreiniger vergiftet, als er 8 Jahre alt war. Ein Versehen behauptete sie. Er wuchs bei den Großeltern auf. Seine Cousine hingegen, die nicht wegkam, ist auch nach Jahren fest überzeugt, dass seine Mutter die ihre ermordet hat.
Es liegt eine Spannung auf allen Beziehungen, kein Wunder, wenn die eigene Mutter einen um die Ecke zu bringen versucht. Überall lauert Unausgesprochenes, Vermutetes, angereichert mit Gerüchten. Und der Erzähler ist auch nicht die Zuverlässigkeit in Person. Angereist ist er mit einer Frau namens Claire, die er als seine schwangere Freundin Constance ausgibt. Claire hat eingewilligt, die Rolle zu spielen, doch nach und nach kommt ihr das alles seltsam vor.
Gerade mal schlanke 116 Seiten braucht der 1978 geborene Almendros für dieses intelligent und leicht erzählte Konzentrat. Eine rabenschwarze Familiengeschichte, die von Andeutungen und Uneindeutigkeiten lebt. Und die wiederum versehen die heißen Sommertage in der Provinz mit einer trägen, klebrigen, unterschwellig gewalttätigen Atmosphäre, in der Almendros Protagonist permanent der eigenen Vergangenheit begegnet, alten, mit Misstrauen gesättigten Geschichten. Und er zweifelt zunehmend auch an sich selbst, begreift, dass das unberechenbare Wesen seiner Mutter wohl auch in ihm haust.
- Vincent Almendros: Ins Schwarze (Faire mouche, 2018). Aus dem Französischen von Till Bardoux. Wagenbach-Verlag, Berlin 2019. 118 Seiten, 16 Euro.
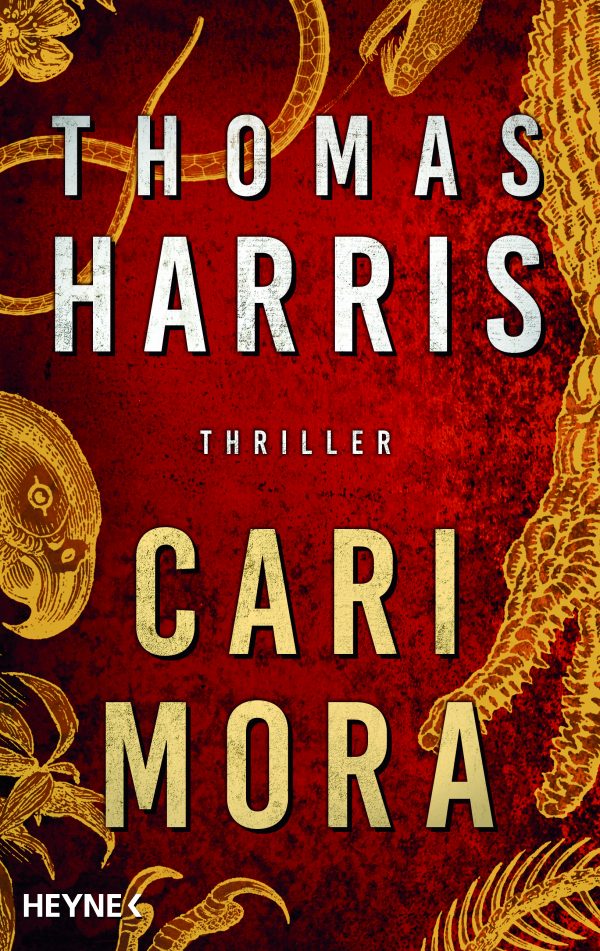
Verblassend
(TW) Empörung und Enttäuschung allenthalben über den „neuen Harris“. Das funktioniert aber nur, wenn man Thomas Harris für einen überragenden Schriftsteller gehalten hat. Kann schon mal passieren, wenn der Erfolg eines Filmes, also „Das Schweigen der Lämmer“, den Eindruck entstehen lässt, die Vorlage sei mindestens genau so toll. Das ist ein bisschen so ähnlich wie bei Volker Kutscher, den ohne die Serie „Babylon Berlin“ niemand für einen bedeutenden Autor halten würde, au contraire. Harris war schon immer ein eher mittelmäßiger Autor, der eine einzige geschäftsträchtige Idee hatte, aber schriftstellerisch und intellektuell tief im 18./19. Jahrhundert steckt, Stichworte „Genieästhetik“, „Entgrenzung“ etc.
Und jetzt also Cari Mora, mit einem ziemlich unappetitlichen Unhold namens Hans-Peter Schneider, haarlos, der es liebt, Leute in einer an sich vorbildlichen Bioentsorgungsanlage aufzulösen und ansonsten ein eher unfreiwillig komisches Kerlchen ist. Geisterbahn pur. Hauptberuflich ist der schlimme Finger aber gerade hinter ein paar Millionen her, die der verblichene Pablo Escobar in einer Villa in Florida gebunkert hat, dort, wo auch eine Menge Krokodile herumlungern, und deren Essgewohnheiten herzig geschildert werden. Schneiders Gegenspielerin ist Caridad Mora, eine Ex-FNARC-Kindersoldatin, die fortan nur Gutes tut und somit Schneider und Konsorten im Weg ist. Auf dass das gute, alte Gut/Böse-Spiel nicht noch schlichter werde als es eh schon ist, tummeln sich natürlich noch ein paar andere Interessenten an Escobars sprengstoffgesichertem Safe. Aber, natürlich, alles wird gut. Irgendwie liest sich das Buch wie einer der üblichen Florida-Romane à la Carl Hiaasen, James W. Hall, Elmore Leonard etc., aber nur viel zahnloser, lascher. Sozusagen mildes Abendlicht, pastellfarben, verblassend. Und nicht weiter erwähnenswert.
PS: Angehängt sind noch 50 Seiten „Leseprobe“ aus „Das Schweigen der Lämmer“. So werden dann aus 276 Seiten offiziell 335, jo ….
- Thomas Harris: Cari Mora (Cari Mora, 2019) Deutsch von Imke Walsh-Araya. Heyne Verlag, München 2019. 276 Seiten, 22 Euro.
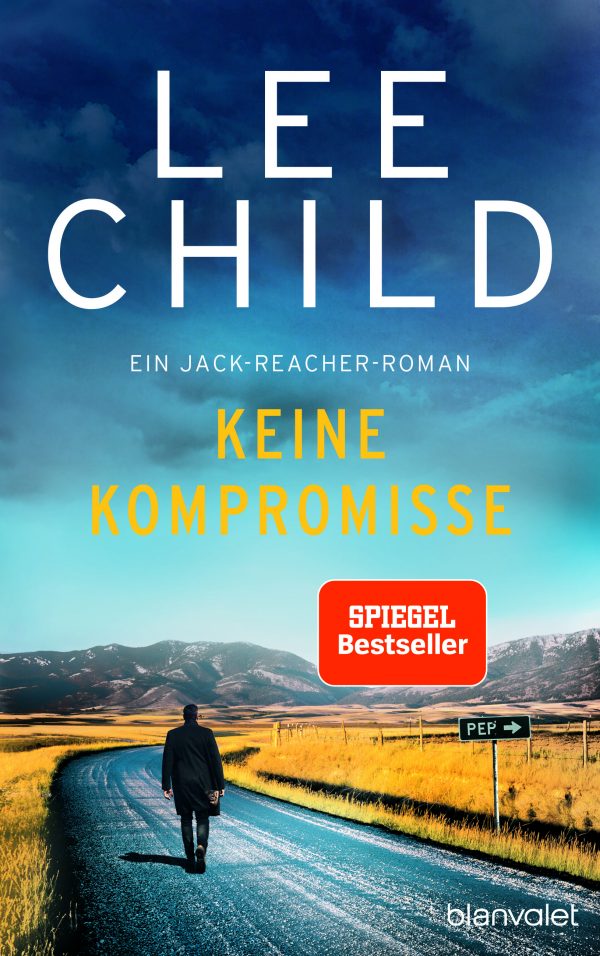
Immer am 1. September
(AM) Am 1. September 1994 ging Lee Child einen Schreibblock kaufen, um seinen ersten Roman zu beginnen. Mit Bleistift. Das Resultat war „Killing Floor“ (1997, deutsch 1998 als „Größenwahn“). Es war der erste Auftritt von Jack Reacher. 20 Jahre später, am 1. September 2014, schrieb er die ersten Sätze von „Make Me“ – dieses Buch ist gerade jetzt erst, mit der schon lange eingerissenen Verspätung bei den deutschen Ausgaben endlich als Keine Kompromisse auf Deutsch erschienen. Katja Bohnet hat diesen Thriller bei uns auf CrimeMag bereits im Februar 2016 besprochen: „Über die Ästhetik des Augenblicks.“
20 Jahre. 20 Mal der 1. September. 20 Mal das Ritual eines frisch angefangenen Romans. 20 Mal ein Bestseller. „Keine Kompromisse“ ist Jack Reacher Nr. 20. Jetzt Ende Oktober kommt im englischsprachigen Raum bereits Reacher Nr. 24 heraus: „Blue Moon“. So sehr hinken wir hier hinterher, was natürlich auch jeden aktuellen Bezug killt – wie etwa die wirklich scharfe Kritik an der Opioid-Krise in 2017, „The Midnight Line“.
Aus Katja Bohnets Kritik: „Ruhig ist es in „Mothers Rest“. Gefährlich ruhig. Jack Reacher, Drifter und Ex-Militärpolizist, steigt eigentlich nur aus, um zu ergründen, warum der Ort genau diesen Namen trägt, was bis kurz vor Schluss des Romans ein Mysterium bleiben wird. Aber am Bahnsteig trifft er Michelle Chang, Ex-FBI Agentin, jetzt Privatermittlerin, die ihren Kollegen vermisst. (Der Leser weiß mehr als die Helden des Romans, weil er es schon auf der ersten Seite erfahren hat: Der Mann ist tot.) Doch Reacher hilft den Frauen — so ist er nun einmal —, weshalb es ungemütlich für diejenigen wird, die Dreck am Stecken haben. „We can’t fight thirty people. To which Reachers natural response was: Why the hell not?“ … Nach gefühlten fünfundzwanzig Reacher-Abenteuern sitzt jede Wendungen genau. Kein Ende bleibt offen; jeder Ball wird bis zum Schluss in der Luft gehalten, bis er elegant wieder aufgefangen wird. Große Geräte kommen zum Einsatz. Keine Panzer, diesmal, sorry, leider nicht. Aber immerhin ein New Holland Bagger. Gigantisch, drunter macht Lee Child es einfach nicht.“
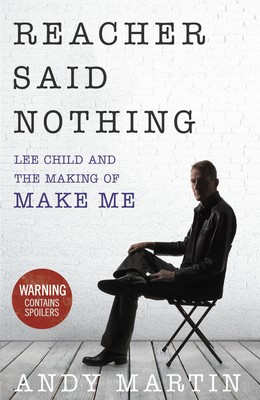
Es gibt zu „Make Me“ (die wörtliche Übersetzung wäre: Zwing mich doch!) ein Begleitbuch. Eine Meta-Studie. Lee Child erlaubte es dem britischen Hochschullehrer Andy Martin, ihm beim Schreibprozess über die Schulter zu sehen. Das Ergebnis war Reacher Said Nothing: Lee Child and the Making of Make Me (New York/ London 2015). Selbst hartgesottenste Jack-Reacher-Fans werden hier leiden, das Experiment ging ziemlich daneben. Zum einen kann der Akademiker Martin – der als Existentialismus-Experte gilt (The Boxer and the Goalkeeper: Sarte vs. Camus) – vor lauter Begeisterung sein Wasser kaum halten: „…not exactly Boswell to your Johnson but close“ oder „…like some pirate’s parrot on the shoulder„. Zum anderen schwurbelt er die in seinem Hinterkopf letztlich dann doch minderwertige Thrillerliteratur in Pseudohöhen: „… a form of pre-Socratic flux, equipped with endless cups of coffee.“ Typischerweise fehlt genau dieses Buch dann in seiner Akademix-Vita. Und wir lernen Trivialitäten, etwa dass Lee Child während der Buchproduktion 20 bis 30 Tassen Kaffee am Tag einfährt. Wie er aber Action-Szenen schreibt oder seine Kämpfe choreografiert erfahren wir jedoch nicht. Der Lobhudler war dann mit dem Erfolgsautor noch auf Buchtour, das Ergebnis gibt es am 28.10.: „With Child. Lee Child and the Readers of Jack Reacher.“
- Lee Child: Keine Kompromisse (Make Me, 2015). Deutsch von Wulf Bergner. Blanvalet, 445 Seiten, 22 Euro.
- Andy Martin: Reacher Said Nothing: Lee Child and the Making of Make Me. Bantam Dell, New York 2015. 368 Seiten.
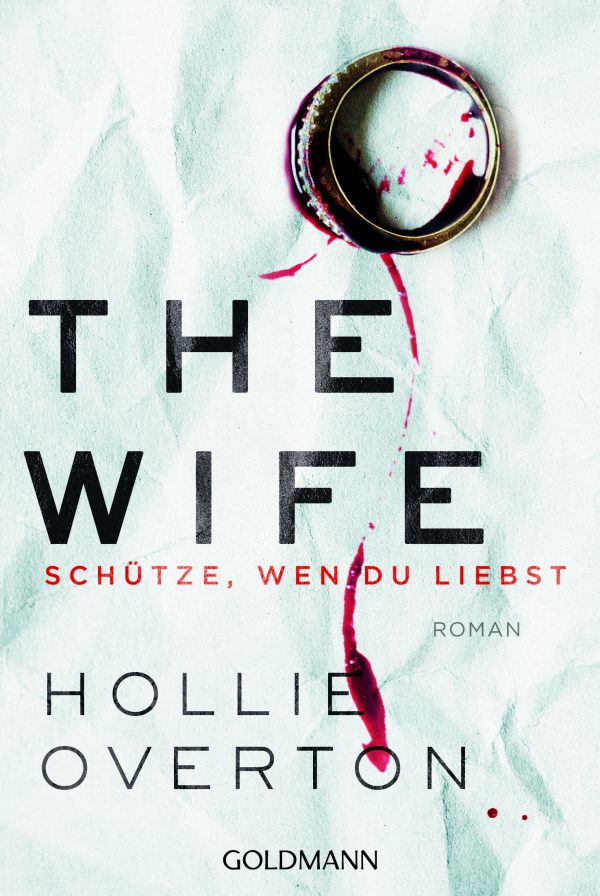
Das Gefängnis sind die andern
(AM) Gefängnisromane sind ein interessantes Subgenre. Hollie Overton gewinnt ihm neue Seiten ab, stellt es aber mit The Wife nicht auf den Kopf. Ihre Protagonistin ist die alleinerziehende Kristy Tucker, die für die Justizbehörde Texas im Polunsky-Staatsgefängnis Presse- und Öffentlichkeitsarbeit macht: 2936 Gefangene, 279 davon im Todestrakt. Bei 37 Hinrichtungen war sie schon Zeugin, zwischen den Gefangenen, den Medien und der Gefängnisverwaltung zu vermitteln, ist ihr tägliches Brot. Eine Figur also wie vom Filmregisseur Ken Loach, der uns gern in die Köpfe und die Welt nicht nur der nettesten Menschen entführt, um so die Dialektik unserer widersprüchlichen Welt anschaulich durch zu deklinieren.
Die Allan B. Polunsky Unit im Polk County, Texas, gibt es tatsächlich. Robert Perkinson, hat die Strafanstalt in seinem Buch „Texas Tough: The Rise of America’s Prison Empire“ als „the hardest place to do time in Texas“ klassifiziert. Die Gefängnis- und Todesindustrie ist Thema in Overtons Roman, aber es geht auch noch um andere Gewaltverhältnisse. Er beginnt mit dem Brief eines zum Tode verurteilten angeblichen Kindesmörders, Schicksal und Haltung dieses Häftlings verschränken sich dramaturgisch geschickt mit dem Hauptstrang der Erzählung. Die ist eine „private“. Eine Beziehungsgeschichte. Der blutige Ehering auf dem Cover hat seine Berechtigung. Es ist die Geschichte einer Überlebenden häuslicher Gewalt.
Wie Kristy Tucker das schafft, ist Stoff dieses ziemlich packenden Romans. Wozu schließlich kennt sie Hunderte von Mordfällen, wozu hat sie es mit einer Versammlung gerissener und abgebrühter Verbrecher zu tun? „Wenn Sie wirklich keinen Ausweg mehr sehen, gibt es Leute hier drin, die einen wüssten“, schreibt ihr der Kindesmörder, dem sie sich anvertraut hat …
1947, eine ewige Zeit her, ist heute Natalia Ginzburgs Romananfang: „Ich habe ihm in die Augen geschossen.“ Der Roman „È stato così“ (erst 1992 deutsch als „So ist es gewesen“) mit dem kühlen Geständnis einer Mörderin machte die italienische Autorin (1916 – 1991) berühmt, in den USA wird diese Ikone des feministischen Thrillers gerade wieder unter dem Titel „The Dry Heart“ neu aufgelegt.
- Hollie Overton: The Wife. Schütze, wen du liebst (The Walls, 2017). Deutsch von Karin Diemerling . Goldmann Verlag, München 2019. 476 Seiten, 10 Euro.
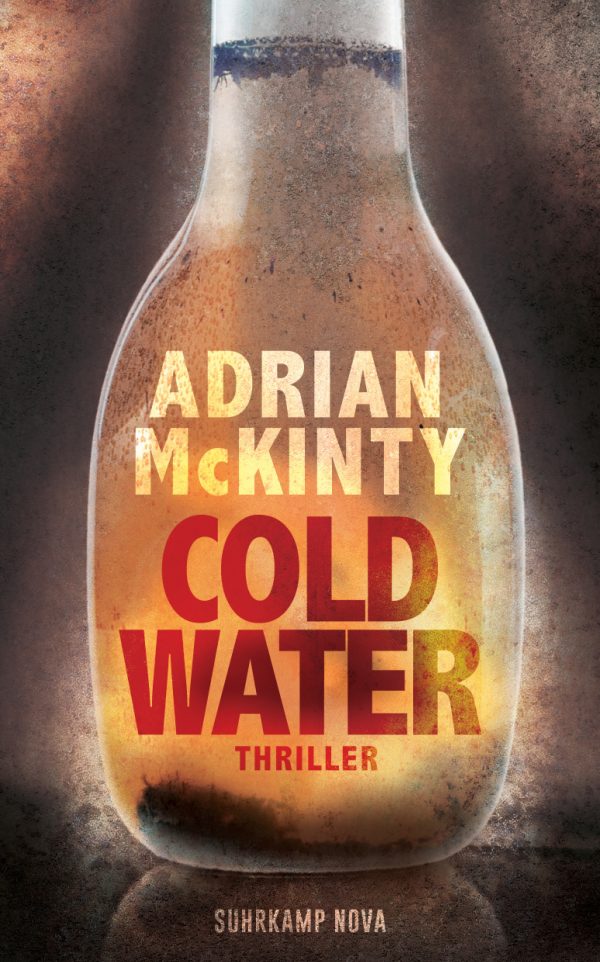
Unterhaltsam
(JF) Das Ende der achtziger Jahre erlebt Detective Sergeant Sean Duffy von der Royal Ulster Constabulary in Jerusalem. Er ist mit einer Reisegruppe fundamentalistischer Protestanten da, die um Punkt Mitternacht das Ende der Welt und die Rückkehr des Erlösers erwarten. Organisiert hat die Pilgerfahrt Duffys Schwiegervater Hector, also darf der katholische Bulle samt Ehefrau kostenlos dabei sein. Groß ist natürlich die Enttäuschung, als sich herausstellt, dass in den komplexen Berechnungen des Weltuntergangs irgendein Fehler stecken muss. Das irdische Jammertal besteht weiter, und auch in der nordirischen Heimat ist, wie Duffy nach seiner Rückkehr feststellt, alles beim schlechten Alten geblieben. Aber er hat sowieso vor, den aktiven Dienst zu quittieren und mit Frau und Kind ein ruhigeres Leben auf der anderen Seite der irischen See zu beginnen.
Sieben Romane hat der Adrian McKinty seinem Helden gewidmet, jeder trägt ein schönes Tom-Waits-Zitat als Titel. „The Detective Up Late“ heißt der letzte im Original noch nicht erschienene Abschluss der Serie, der deutsche Verlag hat ihn, warum auch immer, in Cold Water umgetauft und aus Duffys Frau Beth eine Realschullehrerin gemacht. Unterhaltsam ist der letzte Fall des nordirischen Supercops, der das Times-Kreuzworträtsel schneller löst als der selige Inspektor Morse, aber allemal. Ein 15-jähriges Mädchen aus einer Landfahrerfamilie ist verschwunden, Duffy vermutet, dass ein Gewaltverbrechen dahinter steckt. Der Verdacht erhärtet sich, als offenbar wird, wie sich der Teenager sein Taschengeld aufgebessert hat. Als aus einer geplanten Modelkarriere nichts wurde, ließ sie sich als Begleitung an einsame Herren mittleren Alters vermitteln. Und schon hat Duffy ein paar Schwerverdächtige an der Hand. Die Ermittlungen allerdings gestalten sich aufgrund der spezifischen Gemengelage in der damals gern so genannten „Unruheprovinz“ zäh und schwierig, bis im letzten Drittel ein Mordanschlag auf Duffy und seine Kollegen die Sache beschleunigt. Zumindest scheint es so, später ist dann doch alles anders als gedacht.
Wie in den Vorgängerromanen ist auch in „Cold Water“ Duffy selbst der Erzähler, und als solcher ebenso zynisch und sentimental wie seine großen Vorbilder aus der hartgesottenen Detektivliteratur, auch wenn er gelegentlich eher wie Hercule Poirot ermittelt. Diese Erzählhaltung erlaubt es Adrian McKinty, wie nebenbei das menschliche Elend des Nordirlandkonflikts in die Handlung einfließen zu lassen. Das zeugt von Können, macht den Abschied von Duffy allerdings nicht leichter.
- Adrian McKinty: Cold Water (The Detective Up Late, 2019). Aus dem Englischen von Peter Torberg. Suhrkamp Verlag, Berlin 2019. 380 Seiten, 15,99 Euro.
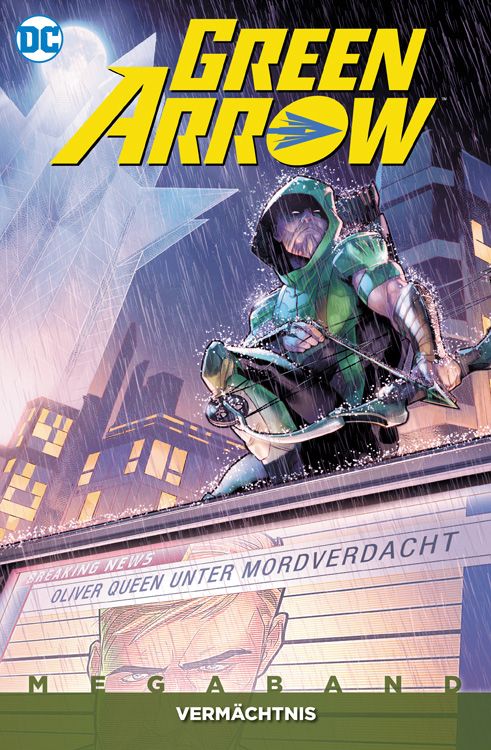
Der Grenzgänger
(AM) Ausflüge ins Comic-Universum machen manche der jüngeren amerikanischen Autoren gern, Ta-Nehisi Coates etwa hat sich dem „Black Panther“ angenähert (CrimeMag dazu: Wer hat Angst vorm Schwarzen Mann?). Kaum einer aber hat seine Erzählkunst immer wieder so in den Dienst der Comis gestellt wie Benjamin Percy, über den James Lee Burke die höchsten Lieder als Romanautor singt. Siehe auch die CrimeMag-Besprechungen von „Roter Mond“ oder „Wölfe der Nacht“ hier. Über Genre und Erzählen reflektierte er 2016 in dem Essayband „Thrill Me“ (CM-Kritik hier).
Seine erste Arbeit für DC Comis waren 2014 die Detective Comics #35 – 36, denen er mit zum Neustart verhalf. Beginnend mit Ausgabe 41 wurde er der Autor der Green Arrow Serie – es war eine Realitätsertüchtigung, als ob Daniel Craig bei James Bond übernehmen würde -, führte sie bis Heft 52 und der Umstrukturierung bei DC. Als die Serie 2016 weiterging, nicht zuletzt auf sein Betreiben hin und mit seiner Autorenschaft, wurde die Neustart-Nummer Green Arrow: Rebirth mit über 90.000 verkauften Heften zum erfolgreichsten Titel der jüngeren US-Comic-Geschichte. 20.000 Exemplare waren zuvor Normalpegel..

Nach insgesamt 52 Ausgaben hat er nun „Green Arrow“ verlassen. Via Twitter bedankte er sich bei den Zeichnern Juan Ferreyra and Otto Schmidt „who are brilliant and great dudes. They are a killer team.“ Er wolle sich künftig, so verkündete er, einer dunkleren Comicfigur zuwenden. Green Arrow Megaband 3: Vermächtnis ist also tatsächlich ein Abschied, in dem der grüne Bogenschütze auf Batman, Wonder Woman, Superman, Flash und Green Lantern trifft und seine Gegner Unterstützung von Olivers tot geglaubter Mutter Moira Queen erhalten. Nightwing 7: Gefangen im Darkweb ist ein Neuanfang. Die Figur mit Vigilante-Hintergrund stammt aus den klassischen Superman-Stories und ist mit Dick Grayson gekoppelt. Jetzt verwandelt sich seine Heimat in einen virtuellen Cyber-Albtraum, Nightwing erhält Unterstützung von seiner Ex, der Hackerin und Heldin Batgirl. Außerdem nimmt er am gefährlichsten Motorradrennen der Welt teil. Die fürs Feuilleton geeignete Version davon ist Percys Roman „The Dark Net“ von 2017. Mittlerweile hat er auch für „James Bond“ und „Wolverine“ geschrieben, am 15. Oktober erscheinen wieder Kurzgeschichten: „Suicide Woods“.
- Benjamin Percy: Green Arrow Megaband 3: Vermächtnis. Zeichner: Juan Ferreyra, Stephen Byrne, Otto Schmidt. Storys Green Arrow 26-38. Panini comics, Stuttgart 2019. Softcover, 276 Seiten, 28 Euro.
- Benjamin Percy: Nightwing 7: Gefangen im Darkweb. Zeichner: Chris Mooneyham, Klaus Janson. Storys Nightwing 44-49. Panini comics, Stuttgart 2019. Softcover, 172 Seiten, 17,99 Euro.
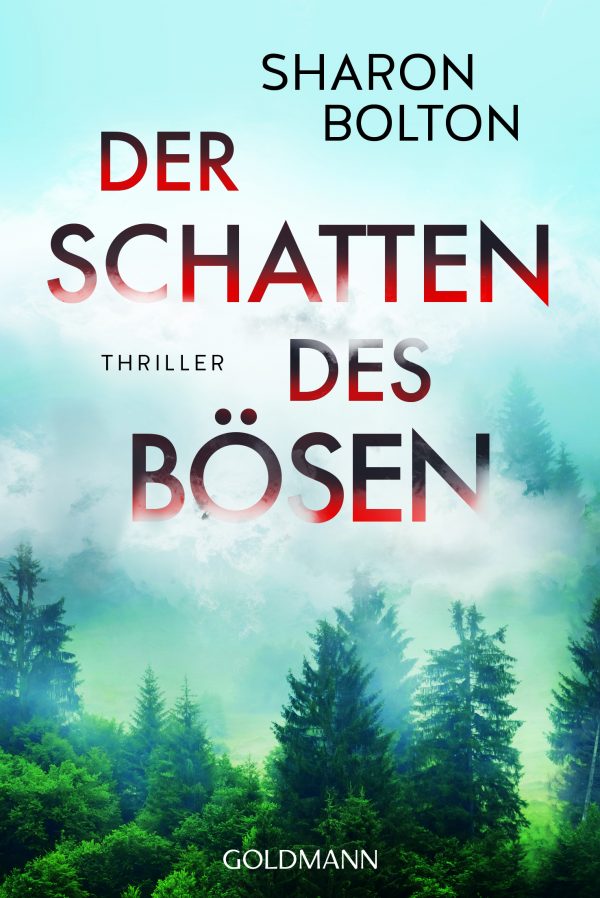
Lebendig begraben
(AM) Das macht sie jetzt schon eine ganze Zeitlang wirklich verlässlich, genauer seit 2008 und „Todesopfer“. Sharon Bolton, Jahrgang 1960 und aus Lancashire stammend, dreht auch mit Der Schatten des Bösen die gute alte Tradition des englischen Landkrimis einen Zacken schärfer fort. Charakter kann sie und Landschaft, Atmosphäre und Setting, das steht außer Frage, womit sie immer wieder aufs Neue spielt, das ist die Grenzlinie zum Übersinnlichen. Seit William Wilkie Collins (1824-1889) und seinem „Monddiamant“ von 1868 ist das gute, wenn auch etwas aus der Mode gekommene britische Übung.
Florence Lovelady nennt Bolton ihre Polizistin, die anlässlich der Beerdigung eines ehemaligen Sargtischlers und Mörders in die Stadt ihres spektakulärsten Falls zurückkehrt. Dort in Lancashire wurden 1969 mehrere Jugendliche vermisst. Wie sich herausstellte, waren sie entführt und in Särgen lebendig begraben worden – auch so ein Topos: „Buried alive!“ Florence gelang es damals, den Sargmacher der grausamen Taten zu überführen und ihn lebenslang hinter Gitter zu bringen. Doch kaum ist der vermeintliche Mörder von damals selbst unter der Erde, mehren sich die Zwischenfälle, die auf etwas immer noch Lebendiges deuten. Bald muss die Polizistin um ihren eigenen Sohn Ben fürchten. Sie wendet sich an Daphne und Avril, zwei alte Jugendfreundinnen, Mitglieder des hiesigen Hexenzirkels …
Klingt gewagt? Ist es. Bolton aber gelingt die Balance, nebenher gibt es klaustrophobische Momente, Anschauliches zum Sexismus in der Polizei und eine große, elegant gesetzte Rückblende.
- Sharon Bolton: Der Schatten des Bösen (The Craftsman, 2018). Aus dem Englischen von Marie-Luise Bezzenberger. Goldmann Verlag, München 2019. 560 Seiten, 10 Euro.

Letztlich provinziell
(BoH) Die Informationen eines Geheimdienstexperten führen in einem zentralasiatischen Staat zu einem Drohnenangriff auf Terroristen. Zudem unterhält der Experte verbotenerweise eine heimliche Beziehung zu einer investigativen Journalistin, die einem politischen Skandal auf der Spur ist. Als sie bei einem Terroranschlag stirbt, der mutmaßlichen Antwort auf die Drohnenaktion, kommen dem Geheimdienstmitarbeiter Zweifel an den Hintergründen der Tat, in Folge zunehmend an seinem Arbeitgeber und Auftrag. Er entdeckt dubiose Machenschaften, Verstrickungen von Politik und Waffenlobby. Es geht um das Streben nach Karriere, Macht und Geld, um nichts weniger als um das politische, juristische und moralische Austarieren vor dem Hintergrund des internationalen Terrorkampfs bis an die Schmerzgrenze und darüber hinaus. Es geht letztendlich um »die« Wahrheit in einer politisch komplexen Welt, die es am Ende nicht gibt, vielleicht sogar nie geben kann.
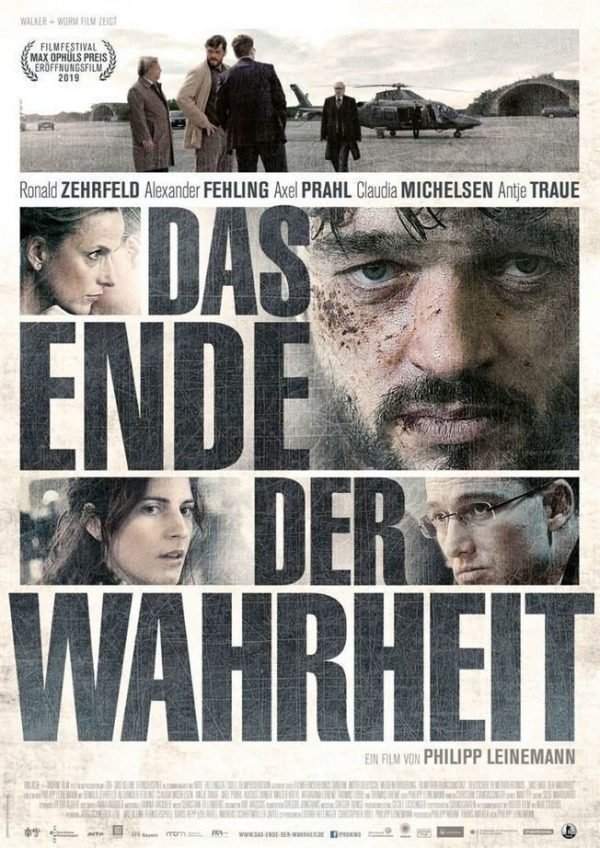
Die abstrakte Beschreibung des Filmplots weckt Spannung, weil ausreichend notwendige Inhaltsstoffe für die Dramaturgie eines explosiven Politthrillers vorhanden sind. Der Film weiß sie auch durchaus zu nutzen. Die Action wird überzeugend inszeniert und auch die schauspielerischen Leistungen stimmen. Dennoch überzeugt der Film nicht richtig. Nicht etwa, weil gewisse geheimdienstliche Spezifika und Handlungen am Ende doch eher einer fiktionalen Vorstellungswelt entspringen bzw. aus dramaturgischen und finanziellen Gründen vereinfacht dargestellt werden, obgleich der Film – geradezu typisch deutsch – unterschwellig den Recherchegrad einer Dokumentation suggeriert. Nicht etwa, weil der Plot am Ende irgendwie undurchschaubar bleibt, fast schon kleinkariert wirkt und sich eine Art von Belanglosigkeit durchsetzt, eine Art gefühlter Unentschlossenheit in welche Richtung der Film eigentlich gehen soll. Er überzeugt vor allem nicht, weil es sich bei dem Geheimdienst um den Bundesnachrichtendienst (BND) handelt und die Vektoren der eigentlich intendierten geostrategischen Intrigen am Ende mehr provinziell auf Deutschland zielen. Der Film spielt im Grunde vor allem mit dem bekannten Motiv des latent vorhandenen Misstrauens gegenüber staatlichen Strukturen und eröffnet dadurch die Tendenz zum Trivialen. Die Narration des Agententhrillers erscheint am Ende unscharf.
- Das Ende der Wahrheit. Deutschland 2019. Regie: Philipp Leinemann; Darsteller: Ronald Zehrfeld, Alexander Fehling, Claudia Michelsen, Antje Traue. Länge: 105 Minuten. Offizielle Seite zum Film.












