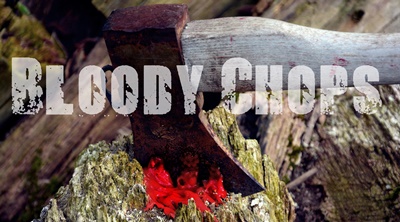Bloody Chops im Februar 2017
Kurzbesprechungen von fiction und non fiction. Zerteilt und serviert von: Joachim Feldmann (JF), Tobias Gohlis (TG), Alf Mayer (AM), Frank Rumpel (rum), Thomas Wörtche (TW).
Über: Dan Barry, Tom Burgis, James Lee Burke, Jerome Charyn, Denis Johnson, Philip Kerr, Rosamund Lupton, Mittelweg 36, Ottessa Moshfegh, Dieter Thomä, Ulf Torreck, Julius Wiedemann, Daniel Zahno.
 Der finstre Kern
Der finstre Kern
(TW) Die lachenden Ungeheuer, die dem neuen Roman von Denis Johnson den Titel geben, liegen irgendwo in der Region zwischen Uganda und der DR Kongo. Sie sind, könnte man meinen, einer klassischen Reise ins Herz der Finsternis entsprungen. Kaptajn Roland Nair vom Jydske Dragonregiment, HRN und der US-Special-Forces Deserteur Michael Adriko sind von Freetown, Sierra Leone aus auf dem Weg nach Ostafrika, weil Adriko dort, im Kreise seiner ursprünglichen Sippe heiraten will: Ausgerechnet die Tochter seines ehemaligen Vorgesetzen. Aber so einfach ist das nicht: Denn der Däne Nair, der für den Geheimdienst der NATO arbeitet, ist auf eigene Faust unterwegs. Er möchte Dokumente über die Informationslogistik der US Army in Afrika verticken, an den Höchstbietenden natürlich, und mit Adriko auch noch gefaketes spaltbares Material an den Mann bringen. Interpol, der Mossad und die CIA mögen das gar nicht. Und dann sind da auch noch die diversen Warlords, die allesamt nach Profit gieren.
Nair ist ein bösartiger, entfernter Verwandter von Eric Amblers Arthur Abdel Simpson, der die Fronten und Seiten flugs wechselt und dem Verrat eine Art Charaktereigenschaft ist. Nur für Adriko empfindet er sowas wie Loyalität. Aber die Reise zu den Lachenden Ungeheuern ist nur ein Teil eines Zickzacks quer über den Kontinent und wieder zurück nach Freetown, von wo es vielleicht nach Kamerun oder in die Emirate geht – dort ist nämlich noch mehr Geld zu holen, als die hunderttausend Dollar, die Nair letztendlich zusammengerafft hat, kein allzu hoher Gewinn für so viel Verrat.
Johnsons Roman ist die fiese Mutation eines Polit-Thrillers, der sich – getarnt durch Zynismen, gefiltert durch eine manchmal halluzinogene Sprache und einen zutiefst erratischen Erzähler – ohne rhetorisch-ideologische Beschwichtigungen zu den Kernen unseres Verständnisses von „Afrika“ durchbohrt: Ein Kontinent, den niemand wirklich interessiert, und den man deshalb ohne Bedenken ausplündern kann. Das beschreibt den Status Quo, über die Konsequenzen oder die Zukunft spricht der Roman mal lieber nicht.
Denis Johnson. Die lachenden Ungeheuer (The Laughing Monsters, 2014). Übersetzung: Rowohlt Verlag, Reinbek 2017.
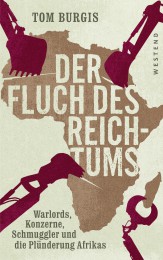 Die Plünderungsmaschine
Die Plünderungsmaschine
(AM) Das Sachbuch zu Denis Johnson Die lachenden Ungeheuer und dem demnächst bei Polar erscheinenden Libreville von Janis Otsiemi. „Don’t think you’re not involved”, glaubt nicht, dass ihr nichts damit zu tun habt, rief die nigerianische Sängerin Nneka vor ein paar Jahren bei einem Konzert in London ins Publikum. Es ist die Schlussszene der großen Reportage von Tom Burgis, in der er die Plünderung Afrikas durch Konzerne und Rohstoffhändler anschaulich und eindringlich beschreibt. Burgis ist Auslandsreporter der Financial Times, das Buch half ihm nach neun Jahren Afrikaberichterstattung, seine heftigen posttraumatischen Symptome zu bewältigen.
Coltan aus dem Kongo, Öl aus Angola, Eisenerz aus Guinea, Uranium aus dem Niger, Diamanten aus Zimbabe, all die „seltenen Erden“ und „Konfliktmaterialien“, die zum Beispiel in unseren Handys stecken, natürlich haben wir damit zu tun. Burgis deckt Strukturen auf, „follows the money“, führt uns aus den Slums Luandas an die Wallstreet, an die Londoner Börse und nach Hongkong zu einem Festland-Chinesen, der als „Baron des afrikanischen Rohstoffhandels“ gilt. Multinationale Unternehmen agieren als die Zwischenhändler afrikanischer Potentaten, staatliche und unternehmerische Macht bündelt sich, die transnationalen Eliten fühlen sich bestenfalls ihren Bankkonten verpflichtet. „The Looting Machine“, die Plünderungsmaschine hieß das Buch im Original.
Vorgetragen wird das alles relativ kühl, britisch eben. Investigativer Journalismus vom Feinsten. Ein wichtiges Buch.
Tom Burgis: Der Fluch des Reichtums. Warlords, Konzerne, Schmuggler und die Plünderung Afrikas (The Looting Machine, 2015). Aus dem Englischen von Michael Schiffmann. Westend Verlag, Frankfurt 2016. 351 Seiten, 24 Euro.
 Milchgeld und andere Fälle von Kasinokapitalismus
Milchgeld und andere Fälle von Kasinokapitalismus
(AM) Ok, der eine Beitrag, den ich so herausragend finde, der hat mit meiner eigenen Sozialisation als Bauernbub im Allgäu zu tun. „Mensch, Kuh, Maschine. Kapitalismus im westdeutschen Kuhstall, 1950-1980“ von Veronika Settele ist das Klügste und Informativste, was ich je zur Entwicklung der milchorientieren Landwirtschaft in Westdeutschland gelesen habe – und die Autorin macht darin auch klar, wie viel die Fortschrittswehen der Agrarindustrie in den Kuhställen mit Planwirtschaft zu tun und damit eine gesamtdeutsche Perspektive haben. „Milchgeld“, das nebenbei, war 2009 der zweite Fall für Kommissar Kluftinger, den Volker Klüpfel und Michael Kobr längst an eine Pseudofolklore verraten haben.
Neben dem Forscherblick in Kuhställe bietet das erste Doppelheft des neuen Jahrgangs von Mittelweg 36 (auch schon der 26.) eine erhellende Exkursion in das Monte Carlo des 19. und 20. Jahrhunderts. Kasinokapitalismus, das zeigt Paul Franke auf, war rational. Es waren europäisch ausgerichtete, durchrationalisierte Unternehmensstrategin, die Kasinos erfolgreich und „zum Schauplatz einer eigentümlichen Verbindung von Spiel und Spektakel machten, dessen Bühne eine ebenso hochgradig durchorganisierte wie artifizielle Konsumwelt war“. Der Text ist eine spannende Spuren- und Bedeutungssuche an einem Ort, der bis heute die diskursiven Auseinandersetzungen über „richtiges“ ökonomisches Verhalten bestimmt. „Praktiken des Kapitalismus“ lautet dieses Mal das Heftthema der bei CrimeMag hochgeschätzten zweimonatlich erscheinenden Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung. (Bisherige CM-Besprechungen: „Wenn Achill nach Hause kommt“ hier, „Gewalt – Das Erleben von Grandiosität“ hier, „Krise? Welche Krise?“ hier, „Sozialforschung auf der Höhe der Zeit“ hier).
Stefan Laube war beobachtend und protokollierend in „trading rooms“ des virtuellen Finanzhandels dabei, zog sich Spott zu, weil er (zum Notizenmachen) oft auf die Toilette rannte. Sozialwissenschaft, wie sie uns im Mittelweg 36 vermittelt wird, hat Bodenhaftung. Wolfgang Kraushaar verbindet in seiner „Protest-Chronik“ den selbst-zensierten Auftritt von Boy Dylan am 12. Mai 1963 in der Ed Sullivan Show mit der Nobelpreis-Verleihung in Stockholm. Auch das muss man gelesen haben.
Mittelweg 36. Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Schwerpunkt: Praktiken des Kapitalismus. 26. Jahrgang, Heft 1, Februar/ März 2016. 106 Seiten, 9,50 Euro.
 Surrealer Hyperrealismus
Surrealer Hyperrealismus
(TW) Eine erratische Figur war schon immer Isaac Sidel, der Cop mit der Glock, der jetzt zum Präsidenten der USA aufgestiegen ist – im zwölften Roman der Sidel-Saga von Jerome Charyn: Winterwarnung. Seit 1973 mordet sich Sidel nach oben, ob er das will oder nicht, und als er jetzt, 1989, endlich im Weißen Haus angekommen ist, hat er kaum noch etwas zu tun, außer sich, von seinem Apparat, ins Dachgeschoss verbannt, mit dem Geist von Abraham Lincoln (über den Charyn eine brillante Biografie – oder einen biografischen Roman – geschrieben hat; I Am Abraham, 2014) zu befassen. Bis ihn eine „Winterwarnung“ aus den Tiefen der stalinistischen Gulags erreicht. Man hat eine Lotterie auf seinen Tod ins Leben gerufen, die derart wahnwitzige Geldmengen bewegt, dass das Währungssystem der ganzen Welt abzustürzen droht. Und so muss sich Sidel, umgeben von Feinden, Sykophanten und Figuren zweifelhaftester Loyalität, mit der Hilfe russischer, während Glasnost und Perestroika zu Regierungsehren gekommener Gangster und israelischen Ex-Politikern daran machen, die Welt zu retten. Oder wenigstens sich selbst.
Auch wenn Winterwarnung ein klein bisschen plot-orientierter ist als manche andere Sidel-Romane, bleibt Charyn dem Konzept treu, das die Saga zu einem Meilenstein der zeitgenössischen Literatur gemacht hat: Er zerschreddert, komisiert, fraktalisiert, halluziniert und demontiert Realitäten, bis eine Art surrealer Hyperrealismus entsteht. Damit entgrenzt er auch die Poetik des Kriminalromans, ohne auch nur einen Millimeter des Genres aufzugeben. Großartig. Und by the way: Das Sidel-Universum der letzten 44 Jahre teleologisch auf Trump zu beziehen, ist aktualistischer Unfug.
Jerome Charyn. Winterwarnung. Übers.: Sabine Schulz. Diaphanes Verlag, Zürich 2017. 328 Seiten, 24,00 Euro.
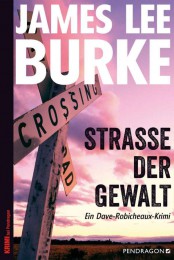 Den Faden wieder aufgenommen
Den Faden wieder aufgenommen
(AM) In der ersten Woche nach Labor Day, nach einem Sommer heißer Winde und Dürre, durch die die Zuckerrohrfelder staubtrocken und sinnwebartig mit Rissen überzogen waren, tanzten nun wieder Regenschauer über die Sumpfgebiete, die Temperatur fiel um zehn Grad, und der Himmel nahm das harte, makellose Blau einer umgedrehten Keramikschale an. – Wer wüsste bei solch einem Anfangssatz nicht, dass wir in einem Roman von James Lee Burke sind? Einem Dave-Robicheaux-Roman, genauer.
Für diesen hat es an die 14 Jahre gebraucht, ehe er den Weg zu uns gefunden hat. „Last Car to Elysian Fields“ (Straße der Gewalt in der Übersetzung von Jürgen Bürger) war 2003 jener Robicheaux-Roman, der keinen deutschen Verlag mehr fand. Es war das 13. Buch einer bis heute weltweit hochgerühmten Serie mit inzwischen 20 Bänden, aber in Deutschland war damals Schluss. Der Goldmann Verlag kündigte die Zusammenarbeit auf, kein anderer deutscher Verlag fasste den Autor die nächsten zwölf Jahre an. Mittlerweile gibt es eine Renaissance des im Dezember 80 Jahre gewordenen Autors, alleine im Jahr 2016 sind fünf seiner Romane bei uns erschienen. (CrimeMag hat berichtet und gewertet.) Bei Heyne Hardcore kommen die Hackberry-Holland-Romane heraus, im Bielefelder Pendragon Verlag hat man sich auf Dave Robicheaux verlegt. Straße der Gewalt ist dort der sechste Robicheaux in relativ kurzer Folge. Die Editionsgeschichte springt ein wenig hin und her, die Lücke der noch unübersetzten Robicheaux-Bücher aber schrumpft. Sechs Bücher fehlen nun noch. Es geht voran.
Straße der Gewalt ist ein klassischer Robicheaux. Das soll hier genügen. Wer Anschauung sucht für den Kriminalromanhelden als „puer robustus“ (siehe die Besprechung weiter unten), wird hier bei Dave und seinem Freund Clete Purcell fündig. Für sie beide gilt die Definition von Dieter Thomä zu hundert Prozent: „Er schlägt zu, eckt an, begehrt auf. Er spielt nicht mit, gibt nicht klein bei, handelt auf eigene Faust, verstößt gegen Regeln. Er ist unartig, unverschämt, unbequem, unbehaust…“
James Lee Burke: Straße der Gewalt (Last Car to Elysian Fields, 2003). Band 13 der Dave-Robicheaux-Reihe. Deutsche Erstausgabe. Übersetzung Jürgen Bürger. Pendragon Verlag, Bielefeld 2017. 520 Seiten , Klappenbroschur, 18,00 Euro. Verlagsinformationen.
 Nix für Frostbeulen
Nix für Frostbeulen
(rum.) Ziemlich schattig geht es in Rosamund Luptons Roman Lautlose Nacht zu, der im winterlichen Alaska nördlich des Polarkreises spielt. Kein Tageslicht und eisige minus 20 Grad gibt es da, doch fällt die Temperatur während eines Sturms gar auf 55 Grad unter Null. Das sind die garstigen Bedingungen, mit denen die Protagonistinnen Yasmin und ihre stumme, zehnjährige Tochter Ruby klarkommen müssen, während sie auf der Suche nach Yasmins Mann und Rubys Vater versuchen, von Fairbanks in eine abgelegene Siedlung im Norden zu gelangen.
Dieses Dorf wurde bei der Explosion mehrerer Gastanks zerstört. In den Trümmern fand die Polizei 24 Leichen, wobei der Ort nur 23 Bewohner hatte. Der überzählige Tote soll ein britischer Naturfilmer sein. Doch weil Yasmin dem Polizeibericht nicht so recht traut, macht sie sich mit Ruby auf den Weg, um selbst nachzusehen. Ein Lastwagenfahrer nimmt sie mit, doch muss Yasmin auf halber Strecke selbst das Steuer übernehmen und den mit einem Fertighaus beladenen Sattelzug auf einer vereisten Straße nach Norden lenken. Und einen Verfolger hat sie auch.
Die britische Autorin Rosamund Lupton erzählt ihre Geschichte aus zwei Perspektiven, von Yasmin in der dritten Person, Ruby lässt sie selbst zu Wort kommen. Zwei Gedankenwelten, in denen es viel um einen Abwesenden, aber auch um Rubys Blick auf die Welt, die Vielgestaltigkeit von Gebärden und immer wieder um die Lebensbedingungen im nördlichen Alaska geht. Endlose Nacht, einförmige Tundra, Kälte und Stille etwa hat die Autorin vielfältig eingefangen. Und es geht um ein aktuelles Thema: Denn unter dem Dorf, das da im ewigen Eis niedergebrannt ist, lagern riesige Schieferölvorkommen, auf die die vielerorts bereits aktiven Frackingunternehmen scharf sind. Das ist intelligent gemacht und spannend zu lesen. Manch dramaturgischer Kniff allerdings wirkt arg geschraubt und durch die überpräsente Beziehungsgeschichte ist das Ganze dann doch etwas zu nett, zu glatt, zu freundlich geraten.
Rosamund Lupton: Lautlose Nacht (The Quality of Silence, 2015). Roman. Aus dem Englischen von Christine Blum. dtv, München 2016. 379 Seiten, 14,90 Euro.
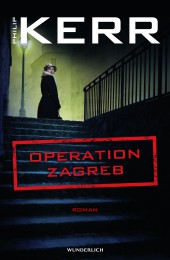 Die Dame im See
Die Dame im See
(AM) Man muss das mögen, aber wenn man es tut, gibt es Spaß zuhauf. Philip Kerr lässt sich nicht lumpen. Auch im nun zehnten Bernie Gunther-Roman ist er erzählerisch in Hochform, nimmt sich die Filmindustrie der Nazi-Zeit und den Reichspropaganda-Minister Goebbels, das Schlachthaus Balkan und die Verhinderungsstrategien der Schweiz, von Hitler okkupiert zu werden, als Plot-Bausteine. Bernies unerfüllte Liebe diesmal ist „The Lady from Zagreb“ (so der Originaltitel), der vom Balkan stammende UFA-Star Dalia Dressner, ein Amalgam aus Pola Negri und Hedi Lamarr. Bernie soll sie nach Deutschland zurückholen, weil Goebbels sie – hübscher Touch – für die Verfilmung von Jean Pauls „Siebenkäs“ haben will.
Kerr schreibt sozusagen zwischen den Zeilen der Geschichte. Er braucht reale Fakten, reale Personen und reale Historie, um daraus Fiktion zu machen. (Siehe dazu auch das CrimeMag-Interview mit ihm.) Mit seiner erstaunlich robusten Figur knüpft er direkt an die Traditionen der hard-boiled novel an, sein Bernie Gunther ist ein unmittelbarer Nachfahr Philip Marlowes (schade, dass in der deutschen Übersetzung die Referenz zu The Lady in the Lake verloren geht/ verloren gehen muss; Seite 395, deutsche Ausgabe: 479). Wie es sich für das Genre gehört, wimmelt das Buch von frechen Beschreibungen, fetzigen Dialogen und Onelinern („Es gibt kein Danach bei deutschen Opern. Nur ewige Gegenwart.„)
Den hartgesottenen, im Herzensgrunde einsamen Ermittler hat Kerr als „puer robustus“ (siehe das Buch von Dieter Thomä in diesen Chops) mitten ins Herz des Nazi-Staates transportiert und mit jeder Menge bösem britischem Witz ausgestattet. Als Überlebensmittel. Denn Bernie Gunther ist Polizist in schwieriger Zeit. Sein Autor macht ihn in seiner Serie zu einer Art Fliegenden Holländer, zu einem unerlösten und widerborstigen Untoten der jüngeren deutschen Geschichte, zu einer Figur, die er fast überall hin expedieren kann – von Kuba bis Argentinien, Dachau bis Zagreb, Prag oder Katyn. Was immer an Verbrechen vorkommt in den Gunther-Romanen, immer ist es der Staat, der die größten begeht. Kerr sieht sich dabei in der Tradition des europäischen politischen Romans, Politik und Moral sind seine Themen. Was Botschaften angeht, hält er es mit der Ambler-Schule, dass man so etwas einer Postkarte und keinem Roman anvertrauen solle. Was er liefert, ist solide, tiefgängige Unterhaltung. U & E in einem, wie es die Engländer eben so patent vermögen.
Philip Kerr: Operation Zagreb (The Lady from Zagreb, 2015). Aus dem Englischen von Axel Merz. Wunderlich, Hamburg 2017. 512 Seiten, 22,95 Euro.
 Heimwehkrank nach einer anderen Welt
Heimwehkrank nach einer anderen Welt
(AM) Ihre für ein Honorar von 2.000 Dollar geschriebene Novelle McGlue aus dem Kleinverlag Fence-Books aus Albany (NY) – die Mordbeichte eines delirierenden Seemanns anno 1851 (CrimeMag-Rezension hier) – gehörte für mich zu den erzählerisch radikalsten Neuerscheinungen des Jahres 2016, beim Verlag Liebeskind erstklassig übersetzerisch betreut und als wertiges Buch präsentiert. Die aus Boston mittlerweile teilweise nach East Hollywood umgezogene Autorin kroatisch-persischer Herkunft, mehrfach hochkarätig für ihre Kurzgeschichten ausgezeichnet, ist eine aufregend neue, kräftige und originelle literarische Stimme. Ihr erster „richtiger“ Roman, Eileen aus dem Jahr 2015, ein Noir-Thriller der Extra-Klasse, angesiedelt in den frühen Sechzigern, mit einer jungen Frau in einem Jugendgefängnis als Erzählerin, war für den Booker Prize nominiert. Und ist noch nicht übersetzt.
Nun erhöht sich Ottessa Moshfeghs Bugwelle Richtung deutscher Sprachraum, denn gerade sind in den USA (und GB) ihre gesammelten Erzählungen erschienen. Titel: Homesick For Another World. Vierzehn, zwischen 2012 und 2017 entstandene Kurzgeschichten. Eine von ihnen heißt „The Weirdos“, das könnte auch auf dem Buchcover stehen, wenn der gewählte Titel mit dem Heimweh nach einer anderen Welt nicht so schön wäre. Die blendend geschriebenen, oft ins Surreale mündenden Geschichten erzählen von narzistischen, eher unfreundlichen, unattraktiven Charakteren mit seltenen Vorlieben und Zwängen. Oft sind sie auf jemand anderen fixiert, sei es aus Hass oder Verlangen. Oft haben sie noch nicht das bekommen, was sie zu verdienen glauben. Das zehrt immer wieder an der Wahrnehmung, auch an der aus der Leserperspektive. Die Dramen sind groß, der Ton oft leise gestellt, auf Fernseh- oder Internetvolumen, wo man auch die wundersamsten Dinge erfahren kann, die Emotion aber meist gedämpft bleibt. Ein interessanter Effekt. Eine Kühle wie bei Camus, ein Fatalismus wie bei den Existentialisten. Aber das 2017, heimwehkrank nach einer anderen Welt. Minimalistisch. Surreal. Oft auch noir.
Ottessa Moshfegh: Homesick for Another World. Stories. Penguin Press, New York 2017. 294 Seiten, $26.00. Verlagsinformationen.
 Hätte, hätte, Fahrradkette …
Hätte, hätte, Fahrradkette …
(JF) Harvy ist ein Mann vieler Talente. Da er als Rockmusiker seinen Lebensunterhalt nicht bestreiten kann, verdingt er sich auch als Fahrradbote und Barmann. Und wenn ihm etwas gut gefällt, bedient er sich gerne. Ohne zu bezahlen, versteht sich. Das neue iPhone ist so ein reizvolles Ding. Doch sein Diebstahl im Apple-Laden bleibt nicht unbemerkt. Bevor Harvy sich an einem neuen Besitz erfreuen kann, kommt das Erpresserschreiben per Mail. Jemand will $ 10.000 von ihm. Die hat er selbstredend nicht, also muss er sich etwas einfallen lassen. Warum seine Bemühungen dazu führen, dass wenig später ein Toter in Harvys Appartment liegt, soll hier nicht erläutert werden.
Mama Mafia, eine Art Action-Burleske, mit der der Schweizer Autor Daniel Zahno sein Debüt im Spannungsgenre gibt, mutet ihrem Helden einen Plot zu, der es in sich hat. Denn kaum ist die Leiche entsorgt, tauchen die nächsten Probleme auf. Und eines davon ist eine junge Frau, die, bevor Harvy sie näher kennenlernen kann, verkündet, dass ihr Freund der „Boss der Hell’s Hand“ sei, die „Hell’s Kitchen und Teile von Manhattan“ kontrolliere. Kein Wunder, dass Harvy angesichts solcher Nachrichten „staunend die Augen“ aufreißt, denn von Tony Tangeroli, dem „Bandenboss mit der Pferderanch in Millbrook“, hat er schon so einiges gehört. Und das stimmt ihn nicht froh, denn mit „der Freundin eines Halbweltbosses anzubandeln“, könnte gefährlich werden. Dass Harvy trotz böser Vorahnung der Versuchung nicht widerstehen kann, dürfte klar sein. Schließlich befinden wir uns erst auf Seite 56 des Romans und der Plot muss bis zum aktionsreichen Ende noch so manche verwegene Wendung nehmen.
Ach ja, die ganze Geschichte spielt in New York, wo sonst. Und käme sie nicht als ausgesprochen behäbige Prosa daher, hätte sich Ihr Rezensent sogar recht gut amüsiert.
Daniel Zahno: Mama Mafia. Roman. Schöffling Verlag, Frankfurt 2017. 247 Seiten, 20,00 Euro.
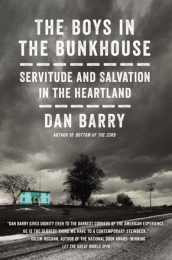 Eine Geschichte ungeheurer Wucht – und sie ist wahr
Eine Geschichte ungeheurer Wucht – und sie ist wahr
(AM) Diese Geschichte krallt einem ins Herz und geht lange nicht mehr aus dem Kopf. Was Dan Barry, ein Reporter und Kolumnist der New York Times, intensiv recherchiert und in Buchform gebracht hat – Teile der Reportage gibt es interaktiv online -, das ist ein Sozialdokument erster Güte, eine Erzählung von Dickens’scher Wucht. Jemanden wie Lennie Small, den Wanderarbeiter aus Steinbecks Von Mäusen und Menschen (1937), viele Lennie Smalls, hat es tatsächlich gegeben. The Boys in the Bunkhouse. Servitute and Salvation in the Heartland (Die Jungs in der Schlafbaracke. Knechtschaft und Erlösung im Herzen Amerikas) gibt ihnen Namen und Würde – endlich. Es ist ein erschütterndes Buch, das einen fassungslos lässt. Und mit geballten Fäusten. (Auch wenn man an die Deregulierungsabsichten der Trump-Regierung denkt.)
Mitten in Amerika, zwischen den späten Sechzigern und 2009, vegetierten Dutzende Männer in der Kleinstadt Atalissa in Iowa in einem aufgegebenen, nach Urin stinkenden und zerfallenden Schulhaus. Jeden Morgen wurden sie zu einem nahegelegen Verarbeitungsbetrieb gekarrt, wo sie Truthähne ausnahmen und zerlegten – gegen lausiges Essen, lausige Unterkunft und 65 Dollar im Monat. Ja, im Monat. Machte einer von ihnen etwas falsch, musste er stundenlang mit dem Gesicht gegen eine Wand stehen oder wurde geschlagen. Sie waren billigste, schutzlose, misshandelte und eingeschüchterte Arbeitskräfte, aus einem Heim in Texas in die Fremde verfrachtet, ohne Sozialkontakte oder Familienanbindung. Alle waren sie geistig behindert, genau das erlaubte – weithin legal – den ausbeuterischen, menschenunwürdigen Umgang mit ihnen.
Schon 1974 informierte ein junger Sozialarbeiter seine Vorgesetzten von dieser „modernen Form der Sklaverei“ bei „Henry’s Turkey Service“, wie die Firma hieß. Er wurde ignoriert. 1979 schrieben zwei Journalisten vom Des Moines Register über die Sache, auch das fand keine Beachtung. Im Gegenteil, wenn jemand von „Henry’s Boys“ mal ausbüxte, brachten ihn die Sheriffs wieder zurück. Erst 2009, rund 30 Leidensjahre später, hatte der Skandal ein Ende. Und auch da wollte der Sheriff immer noch nichts Anstößiges gesehen haben. Möglich wurde die Ausbeutung, weil die US-Bundesgesetze es Arbeitgebern erlauben, Beschäftigten mit Behinderung Löhne unterhalb des Mindestlohn zu zahlen – schließlich tun sie ja etwas „Soziales“.
Und wer nun sagt, USA, Provinz, 1980er, dem sage ich: Badbergen im Landkreis Cloppenburg, Alte Molkerei. Dort wohnten noch 2015 osteuropäische Fleischereiarbeiter zuhauf unter erbärmlichsten Bedingungen, und der Ort sah weg. Siehe die CulturMag-Reportage „Fleischmafia“. Eine Jury übrigens in Iowa sprach jedem von „Henry’s Boys“ eine Entschädigung von 7,5 Mio Dollar zu, insgesamt $ 240 Mio. Der Richter reduzierte das auf zusammen $1.6 Mio, denn das Gesetz erlaubt eine solche Deckelung bei Betrieben mit weniger als 101 Beschäftigten. Das war 2016, noch zu Obamas Zeiten. Jetzt ist Trump am Zug, mit „Business First“, und einer absehbaren Verschlechterung von Arbeitnehmerrechten.
Dan Barry: The Boys in the Bunkhouse. Servitude and Salvation in the Heartland. HarperCollins, New York 2017. 340 Seiten, $26.99. Verlagsinformationen.
 Skandale & Göttinnencrash
Skandale & Göttinnencrash
(TW) Der eher urban-intellektuelle, elitäre, dem Normalleser arrogant entrückte Theoriefreak darf sich ein warmes Herzensfeuerchen an Laurent Binets Die siebte Sprachfunktion entzünden. Den Umschlag ziert eine Déesse und wenn auch im Buch beklagens- und unverzeihlicherweise eine Déesse geschrötet wird, weiß der Alltagsmytholog schon, um was es geht. Natürlich ist Roland Barthes auf dem Rückweg vom Mittagessen mit François Mitterand am 25. Februar 1980 nicht einfach versehentlich überfahren worden. Nein, er wurde ermordet. Und das möchte der Gerade-noch-Präsident Giscard d´Estaing so nicht stehen lassen, zumal Barthes vermutlich die siebte Sprachfunktion (nach Roman Jacobson gibt es nur sechs, die aufzuzählen ich mir hier spare, weiß doch sowieso jeder) kennt, die politisch extrem brisant ist. Schließlich hat Mitterand dann die Wahl 1980 out of the blue gewonnen. Mit Hilfe jener ominösen Sprachfunktion? Deswegen muss sich Kommissart Bayard mit einem zugeteilten Kenner der zeitgenössischen französischen Denker-Szene auf die Suche nach den Hintergründen dieses skandalösen Mordes machen. Und so treten sie – in bester book-about-books-Manier mit viel Klatsch & Tratsch – alle auf: Michel Foucault, Jacques Lacan, Julia Kristeva, Tzvetan Todorov, Jean-Paul Sartre, Philippe Sollers, Bernard-Henry Lévy, Jack Lang, Paul de Man, Frau Ajani und und und …
Endlich wird auch enthüllt, warum Louis Althusser seine Ehefrau wirklich ermordet hat, was Foucault in der Schwulensauna treibt und warum Pierre Bourdieu das böse Prinzip ist. Bayard kann die ganze aufgeblasene Dummschwätzer-Bande nicht leiden, die frivolen Scherz und Frohsinn mit den Werten der anständigen Menschen treiben und damit auch noch mehr Geld verdienen als er. Ein fetter Identifikationsköder, den Binet da auswirft, wohl wissend, dass die Barthes-Foucault-Deleuze-Kenner – und für andere Leute ist die Lektüre wenig sinnvoll – den nur unter der Voraussetzung schlucken, dass dies dann schon wieder ein ironischer, dekonstruktiver Akt sei.
Ein sehr komisches und witziges Buch also, das zwischen jargoninduzierter Langeweile, hübschen Dialogen – über Tennis, Fußball, Essen und die anderen Dingen, die die feinen Unterschiede noch bis heute ausmachen –, jeder Menge schmutziger Intima und blanker Denunziation, sich zudem noch hemmungslos über Konspirationstheorien (bulgarische Regenschirmmörder, James Bond etc) lustig macht. Nachdenklich machen Details, wie wenn Binet schon 1980 Talibane agieren lässt. Aber historische Dekonstruktion ist halt auch mit im Paket.
Laurent Binet: Die siebte Sprachfunktion. Übers.: Kristian Wachinger. Rowohlt Verlag, Reinbek 2016. 528 Seiten, 22.95 Euro.
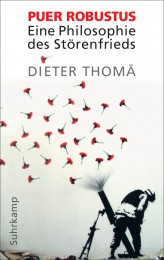 Diese Figur ist uns doch bestens bekannt
Diese Figur ist uns doch bestens bekannt
(AM) „Der Detektiv schlägt zu, eckt an, begehrt auf. Er spielt nicht mit, gibt nicht klein bei, handelt auf eigene Faust, verstößt gegen Regeln. Er ist unartig, unverschämt, unbequem, unbehaust, unbekümmert. Er wird gefürchtet, ausgegrenzt, abgestraft, aber auch bewundert und gefeiert. Der Detektiv ist ein Störenfried … Er ist unterwegs. Er weiß nicht, wo er morgen sein wird und wer er morgen sein wird. Statt seine Erfahrungen wie Perlen auf eine Schnur aufzufädeln, bis alles fest sitzt und passt, schlägt er sich durch und hofft, dass alles am Ende gut ausgeht … Der Detektivroman wird zu Unrecht als eine Gattung angesehen, die anachronistische Züge hat. Er ist die Gattung einer Welt – unserer Welt – in der man aufgerufen ist, ‚ins Chaos hinabzusteigen, und sich dort wohl zu fühlen‘ (Ludwig Wittgenstein).“
Mit diesen erstes Sätzen des hier vorgestellten Buches beginnt nicht eine neue Theorie des Kriminalromans. Könnte es aber. Ich war und bin elektrisiert von Dieter Thomäs Puer Robustus. Eine Philosophie des Störenfrieds. Die Begriffe Detektiv und Detektivroman kommen dort nicht vor, es heißt dort durchgängig „puer robustus“, und wo Dieter Thomä, Professor für Philosophie an der Universität St. Gallen, in die Niederungen der Literatur steigt, heißen die Autoren Shakespeare, Schiller oder Ibsen. Als Unhold oder Held, Schreck- oder Leitbild hat der „puer robustus“ über drei Jahrhunderte hinweg die Gemüter großer Denker erhitzt. Bei Hobbes und Rousseau, Schiller und Hugo, Diderot und Tocqueville, Marx, Freud, Carl Schmitt und vielen anderen tritt er als Schlüsselfigur auf, an der sich ein Zentralproblem der politischen Philosophie entscheidet: das Verhältnis von Ordnung und Störung.
Die Kriminalliteratur hat Dieter Thomä nicht auf dem Schirm – das ist kein Vorwurf. Muss ja nicht seine Sache sein. Aber diesen (staatsphilosophisch) von Thomas Hobbes Mitte des 17. Jahrhunderts in die Welt gesetzten „puer robustus“, den kennen wir bestens aus vielen, vielen Kriminalromanen: den Störenfried par excellence, den kräftigen Knaben, der auf eigene Faust handelt, der aneckt, aufbegehrt und auch mal zuschlägt. Er ist die Schlüsselfigur im Verhältnis von Ordnung und Störung, System und Selbstbehauptung. Er ist der heimliche Hauptdarsteller der Moderne. Er bleibt, so Dieter Thomä „so lange am Leben, wie Machtzentren den Ton angeben, die als Gegner nur den Außenseiter kennen“.
Der „puer robustus“, den uns Dieter Thomä aufblättert, ist eine – wie ich finde – enorm taugliche (und keineswegs nur männlich besetzte) ideengeschichtliche Figur, das Widerspenstigkeits- und Widerstandspotential des Kriminalromans kulturgeschichtlich auszudeuten. Mich hat das Buch zum Beispiel – auf philosophischem Niveau – augenblicklich getröstet, nachdem ich gerade wieder bei James Lee Burke eine Überdosis von Dave Robicheaux’ selbstzerstörerischem Benehmen zu verdauen hatte. Oder als ich mir Philip Marlowes Auftritte bei den Mächtigen in Erinnerung rief, die Exzesse bei James Crumley, die Chester-Himes-Detektive Grabschaufler und Sargfüller, die onliner des nie ganz hundertprozentig erwachsen werdenden Spenser bei Robert B. Parker. Der Detektiv als „puer robustus“ schlägt zu, eckt an, begehrt auf. Er spielt nicht mit, gibt nicht klein bei, handelt auf eigene Faust, verstößt gegen Regeln.
Dieter Thomä: Puer Robustus. Eine Philosophie des Störenfrieds. Suhrkamp Verlag, Berlin 2016. Hardcover. 715 Seiten, 35,00 Euro. Verlagsinformationen.
 Unglaubliche Vielfalt
Unglaubliche Vielfalt
(AM) Die Originalausgabe von Manga Design liegt nun mehr als zehn Jahre zurück, eine (überarbeitete) Neuausgabe ist nicht nur legitim, sondern notwendig. Sie kommt als Volksausgabe: 672 durchgängig illustriere Seiten, Hardcover, kommunistische 14,99 Euro. An die 100 ehemals teure(re) Taschen-Titel sind bisher in der Reihe „Bibliotheca Universalis“ auf diese Weise demokratisiert worden. Ein Beitrag zur Volksbildung, finde ich. Und zu einem Lesebändchen reicht es auch noch.
100 Manga Artists bringt das, was es sagt. Anders als in vielen dieser „100 Dinger“-Bücher (siehe etwa das CrimeMag–KickAss zu 111 Gründe, den Kriminalroman zu lieben) musste Herausgeber Julius Wiedemann freilich nicht in den Krümeln suchen. Das japanische Manga-Universum ist gewaltig, das Zeichner-Niveau in Japan unglaublich. Schätzungen zufolge gibt es dort etwa 2.500 Mangaka. Von ihrer professionellen Tätigkeit leben können von ihnen etwa 20 Prozent, macht immer noch 500.
Die 100 Einträge enthalten je biografische und bibliografische Informationen, Beschreibungen der Hauptfiguren und mehrere Seiten Bildbeispiele. Die Auswahl von 2004 wurde erweitert und verändert, das Buch versucht eine Balance zwischen Pionieren des Genres und neuen, aufstrebender Zeichnerinnen und Zeichnern. Ein Glossar, ein Künstlerverzeichnis und Credits für die Bildgeschichten tragen zum Nutzwert bei. Die verschiedenen Genres und Zielgruppen bilden sich ab, seien es die Shōnen-Mangas für männliche Jugendliche, die Seinen für junge Männer oder die Josei für junge Frauen – und viel Action, aber eben nicht nur. Es gibt da auch die Salaryman-Manga, die sich in Form von Komödien und Dramen mit dem Berufsalltag des Durchschnittsjapaners beschäftigen oder gar ein Gourmet-Genre um Essen und Kochen. Masayuki Kusumi zum Beispiel, bekannt durch sein Kodoku no gurume (Der Gourmet – Von der Kunst allein zu genießen; Carlsen 2014). hat ein schönes Porträt (Seite 298).
Julius Wiedemann (Hrsg.): 100 Manga Artists. Bibliotheca Universalis. Verlag Taschen, Köln 2017. Mehrsprachige Ausgabe: Deutsch, Englisch, Französisch. Hardcover, 14 x 19,5 cm. 672 Seiten, 14,99 Euro.
 Das ideale Buch für eine Grippe
Das ideale Buch für eine Grippe
(TG) Vier Tage Abtauchen in die Welt des Ersten Kaiserreichs. Mit leichtem Fieber. 1805 in Paris. Es stinkt bestialisch. In der Seine wird der Torso einer Sechzehnjährigen gefunden, in deren Vagina ein merkwürdiges Kreuz. Kurz vor ihrem Tod hat sie entbunden. Kommissar Marais (=“der Sumpf“) ist von Polizeiminister Fouché aus Brest zurückgeholt worden; er glaubt, Gott habe ihn beauftragt, Großes zu tun. Da Marais nicht weiterkommt, sucht er bei dem Mann Unterstützung, der sich mit außergewöhnlichem Sex, verborgenen Umtrieben und Blasphemie auskennt: Marquis de Sade.
Die beiden ungleichen und antagonistischen Detektive – Sade ist Atheist, bisexuell und hoch adlig, Marais ist gläubig, prüde und halber Gitan – stolpern recht schnell in die Untiefen einer Zeit, in der Wissenschaft und Aberglaube, Feudalismus und Gleichheitsutopien, alter und napoleonisch neuer Adel, förmliche Rechtsstaatlichkeit und Clan-Intrigen durcheinander schwirrten.
Ulf Torreck, den etliche tausend ebook-Leser als David Gray kennen, hat einen Sinn für starke Bilder: Den von lebenden Schmettterlingen, künstlichen Insekten und tropischen Pflanzen überwucherten Prachtsaal des 94jährigen Comte Solignac d’Orsay, der früher de Sade geliebt und später mit Hass verfolgt hat, wird man so wenig vergessen wie General Sternwoods überheiztes Glashaus in Chandlers Der große Schlaf. Tropische Schmetterlinge ( im Winter!) sind es auch, die die beiden Detektive zu der Kapelle führen, in der der gläubige Marais den Kultort eines satanistischen Ordens zu finden glaubt. De Sade ist da sehr viel skeptischer. Er fürchtet weder Teufel noch Gott, aber das Diabolische im Menschen.
Fest der Finsternis ist ein mit Lust ausgedachter, in Mythen und Maskierungen schwelgender, historischer Serienkiller-Roman und Politthriller, über weite Strecken fesselnd mit anschaulichen Szenen aus allen Gesellschaftsschichten. Zum Glück lässt sich Torreck von seiner Leidenschaft zum historischen Großgemälde nicht den Plot aus der Hand reißen, er ist verwirrend genug. Richtig Spaß macht es, den Roman als Gegenentwurf zu Dan Browns Sakrileg zu lesen. Denn Torreck folgt der Spur seines Satanisten-Ordens nur bis an die Grenze der Wahrscheinlichkeit, nicht wie Dan Brown mit seiner ähnlich angelegten Prieuré de Sion über jeden historischen Sinn hinaus. Kühl führt Torreck das wahnwitzige mörderische Geschehen zurück in den ungleich wahnwitzigeren Raum realer Geschichte, in dem sich Machtgier, enthemmte Naturwissenschaft und wüster Aberglaube treffen.
Besonderes Vergnügen bereitet Torrecks Darstellung des „alten Ungeheuers“ de Sade. Krank, fett, verfressen, eitel und arrogant, ein zerfallenes Prachtexemplar von Libertin und Verkörperung des Ancien Régime, zugleich aber stolz, mutig, generös und scharfzüngig, ein Menschenkenner von Gnaden und unerschütterlicher Kämpfer. Dieser Sade ist in seiner Hochfahrenheit liebenswert – und findet deshalb auch die Anerkennung seiner Mitstreiter, seien es Prostituierte, Zigeuner oder gläubige Polizisten wir Marais. Nur beide zusammen können sich in dem lebensgefährlichen Machtkampf zwischen Polizeiminister Fouché und Außeniminister Talleyrand behaupten, in dem sie die Katalysatoren, nützlichen Idioten und Marionetten spielen.
Kurz, auch wer nicht ins Bett muss, kann erheblichen Lesegenuss an Torrecks Fest der Finsternis haben, gerade weil er mit religiösem Verschwörungsschwachsinn nur spielt. Ein aufklärerisches Buch also, zumal es den Marquis in freundliches Licht rückt.
Ulf Torreck: Fest der Finsternis. Heyne Hardcore, München 2017. 670 Seiten, 14,99 Euro.
Die Vorgeschichte Vor der Finsternis gibt es als ebook (11,99 €).
Zum Blog von Tobias Gohlis hier.