
Vom Gewicht eines Sprengstoffgürtels
„Das Gummigeschoss, das Abir tötete, flog fünfzehn Meter durch die Luft, bevor es sie am Hinterkopf traf und ihre Schädelknochen zertrümmerter wie die eines winzigen Ortolans. Sie hatte sich gerade etwas Süßes gekauft.“ / „Die Wucht der Explosion in der Ben-Jehuda-Straße schleuderte Smadar hoch in die Luft.“ (Sie kam aus einer Buchhandlung, Sinead O’Connor in den Kopfhörern)
Zwei junge Mädchen verlieren auf den Straßen Jerusalems gewaltsam ihr Leben – 1997 die dreizehnjährige Israelin Smadar durch palästinensische Selbstmordbomber, 2007 die zehnjährige Palästinenserin Abir durch die Kugel eines israelischen Grenzpolizisten. Die Väter, Rami und Bassam durchleiden den Schmerz des Verlustes, den Wunsch nach Rache und Vergeltung und finden schließlich in dem Bestreben nach Versöhnung einen neuen Sinn im Leben.
Bassam Aramin und Rami Elhanan, die Hauptfiguren dieses verschachtelten Romans, sind keine fiktiven Charaktere. Bassam ist Mitbegründer der Organisation „Combatants for Peace“, in der sich ehemalige Soldaten der israelischen Armee und palästinensische Kämpfer zusammengeschlossen haben, um nach friedlichen Lösungen des Nahost-Konfliktes zu suchen. Rami wiederum gehört dem „Parents Circle“ an, einer für Juden, Muslimen und Christen gleichermaßen offenen Gruppe von Menschen, die ihre Kinder gewaltsam in besagtem Konflikt verloren haben. Die beiden Männer (Jahrgang 1949 und 1969) lernen sich in dem Krankenhaus kennen, in dem Abir um ihr Leben kämpft. Nach anfänglichen Vorbehalten hat sich heute zwischen den beiden eine Freundschaft entwickelt, gemeinsam erzählen Sie inzwischen auf Vorträgen und in Diskussionsrunden vom Verlust ihrer Töchter und davon, dass das sinnlose Morden ein Ende finden muss. Beide sehen sich damit in ihrer eigenen Community wiederum Anfeindungen als Nestbeschmutzer ausgesetzt.
Der Ire Colum McCann hätte es sich leicht machen können und diese Geschichte von tragischen Verlusten und Freundschaft unter denkbar schlechten Vorzeichen zu einem konventionellen, mehrere Jahrzehnte überspannenden politischen Familienroman zu verarbeiten. Ein Bestseller wäre nicht unwahrscheinlich gewesen, seinen erzählerischen Atem hat der preisgekrönte Autor bereits regelmäßig bewiesen. Er hat sich jedoch entschlossen, die Zerrissenheit des Nahen Ostens auch in der Form des Romans zu spiegeln. Er nimmt die Scherben, die Splitter auf und fügt sie nicht zu einem harmonischen Ganzen, sondern lässt zum Teil kürzeste Kapitel wie Schlaglichter aufeinander folgen, zwischen Orten und Zeitebenen springend, was den Lesefluss stetig unterbricht. Immer wieder schweift er scheinbar ab, um sich dann von einem neuen Winkel her wieder auf das Zentrum des Romans zuzubewegen. Zu den immer wiederkehrenden Motiven zählen Vögel – vom daumengroßen Singvogel Ortolan, der in Frankreich als Delikatesse gilt, über Zugvogelrouten, Mauersegler an der Klagemauer und Jagdfalken hin zur symbolträchtigen Taube. Motivisch wiederkehrend auch die wissenschaftlich-nüchternen Einschübe zu Entwicklung und Verwendung von Waffen („Die M16 stammte aus einer Waffenfabrik bei Samaria in North Carolina“, „Die Gummigeschosse wurden erstmals in Nordirland eingesetzt, wo die Briten sie Knieschläger nannten“, „Ein Vorläufer des Gummigeschosses wurde schon in den 1880ern in Singapur eingesetzt, als die Polizei mit Besenstielsplittern auf Aufständische schoss“) außerdem immer wiederkehrend das Überqueren von Checkpoints, Schikane durch Grenzposten, Graffiti und Mauern. Historisch führt McCann seine Leser zurück bis weit vor den Holocaust und die Errichtung des Staates Israel. In seine Erzählung bettet er auf den ersten Blick zusammenhanglos zahlreiche Abschweifungen ein, erzählt von einem irischen Priester, der im 19. Jahrhundert das Heilige Land erkundete, von dem Nukleartechniker, der das israelische Atomprogramm verriet oder von dem palästinensischen Dichter, der Tausendundeine Nacht vom Arabischen ins Italienische übertrug und vom Mossad getötet wurde. Geographisch spannt er den Bogen über verschiedene Krisengebiete zum Nordirlandkonflikt. Und mit Philippe Petits spektakulärem Drahtseilakt zwischen den arabischen und jüdischen Teilen Jerusalems greift der Autor gar auf den Protagonisten seines Romans „Die große Welt“ zurück.
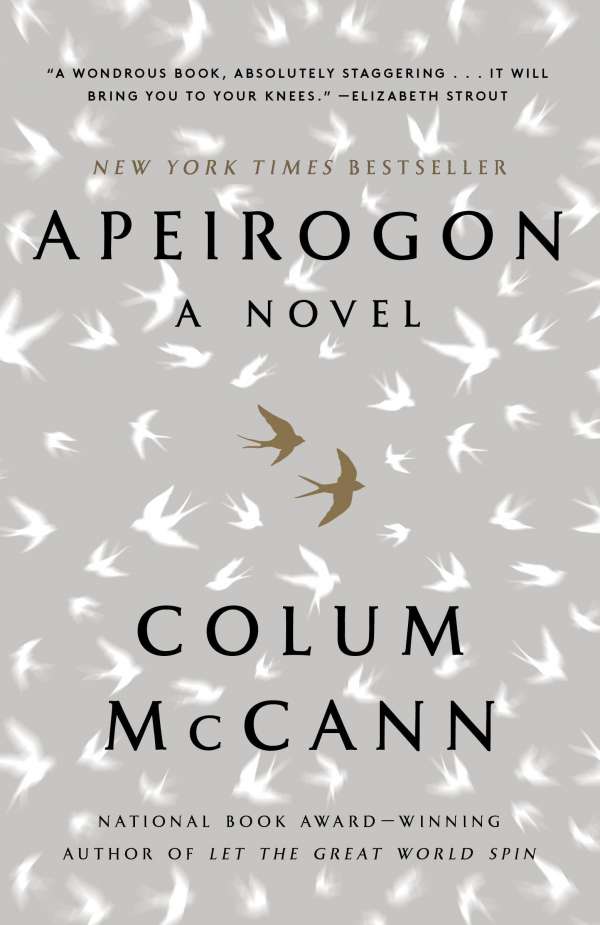
McCanns Roman besteht aus 1001 Kapiteln, von 1 bis 500 hoch zählend und dann wieder zurück. In der Mitte des Buches kommen Bassam und Rami jeweils in einem Kapitel 500 persönlich und aus Ich-Perspektive zu Wort; Zusammenschnitten aus Gesprächen, die der Autor mit den beiden geführt hat. Kapitel 1001 bildet das Bindeglied zwischen den beiden Buchteilen. Diese Kapitelzahl und auch die explizite mehrmalige Erwähnung jenes traditionellen Werkes der Weltliteratur sind kein Zufall. Einer modernen Sheherazade gleich erzählt McCann, um das Weiter-Leben zu ermöglichen, schreibt er gegen eine scheinbare Ausweglosigkeit an, will Hoffnung aufzeigen.
Das titelgebende „Apereigon“ ist in der Geometrie ein Polygon mit einer zählbar unendlichen Anzahl an Seiten und Winkeln. Mit seinem mathematischen Aufbau, der gleichsam klar wie labyrinthisch undurchschaubar wirkt, wandelt McCann auf den Spuren von Jorge Luis Borges, den er zitiert und der Ende der 1960er Jerusalem besuchte. Sprache, so der Großmeister des literarischen Labyrinths, sei von Natur aus sukzessiv: Sie könne nur aufzählen, aber nicht den grandiosen Augenblick beschreiben, in dem er simultan Millionen köstlicher und grässlicher Vorgänge gesehen habe. So erhält auch der Leser von McCanns Roman den Eindruck, dass bei allem Formwillen und erzählerischen Hakenschlägen lediglich Schlaglichter auf die komplexe Situation im Nahen Osten geworfen werden. Dem Nebeneinander, der Gleichzeitigkeit von Geburt und Tod, Glück und Trauer, Liebe und Gewalt, von familiären Momenten und Weltpolitik, kommt der Ire mit diesem Buch allerdings sehr nah. McCann präsentiert keine Lösungen für die Konflikte dieser Welt – aber er lässt keinen Zweifel daran, dass die beiden portraitierten Männer und ihre nicht minder starken Frauen den einzig wirklich Erfolg versprechenden Weg eingeschlagen haben.
Frank Schorneck
Colum McCann: Apeirogon (2020). Aus dem Englischen von Volker Oldenburg. Rowohlt, Hamburg 2020. 608 Seiten, 25 Euro.










