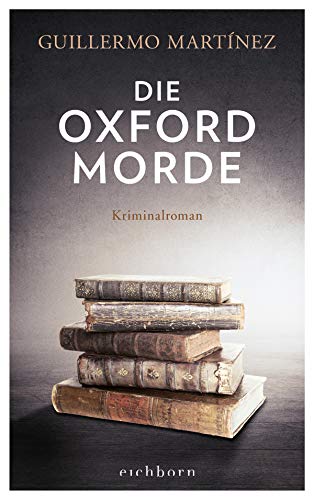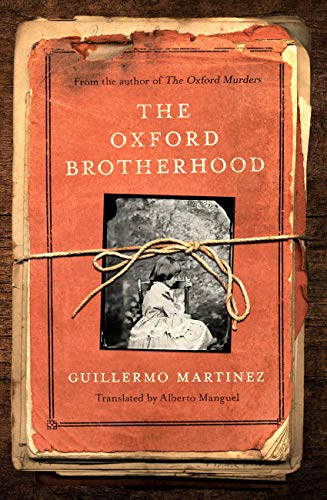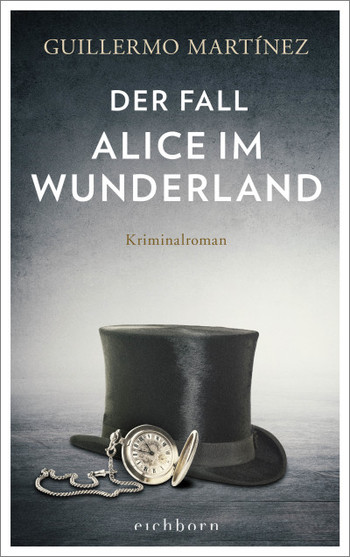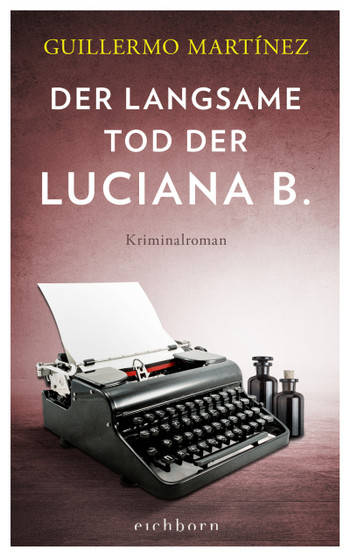
Borges-k und anti-modern
Eine Erkundung von Thomas Wörtche
Der Argentinier Guillermo Martínez ist vermutlich (neben Pablo de Santis) der Autor, der den Geist von Jorge Luis Borges am Deutlichsten in die kriminalliterarische Jetztzeit überführt hat: Kriminalliteratur als streng intellektuelles Spiel, als großes, abstraktes Feld, auf dem sich „Realität“ und Fiktionen in verblüffenden, mysteriösen Konstellationen neu sortieren. Wobei „Realität“ deutlich keine sozialen und politischen Realitäten meint, sondern mathematische (Martínez ist Mathematiker) und philosophische Theoreme, die schon so avanciert sind, dass sie ihrerseits Züge des Fiktionalen tragen. „Die Pythagoras-Morde“, sein bisher größer Erfolg von 2003, jongliert etwa mit der Heissenbergschen Unschärferelation und Wittgensteins Überlegungen zum Regelfolgen (cf. „Philosophische Untersuchungen“), Romane mit Bezügen zu Gödel („Gödel (para todos)“, 2009) und zum Großmeister höchstselbst („Borges y la Matematica“, 2006) beschreiben das Universum von Martínez recht gut: Der Kriminalroman als Denksportaufgabe, wobei das „Denken“ nicht auf die Deduktion beschränkt ist, sondern die Rationalität derart exzessiv ausweitet und transzendiert, dass es ins Irrationale und Phantastische kippt, zumindest potentiell. Der menschliche Geist als riesengroßer, monadenhaft geschlossener kriminalliterarischer Erfahrungsraum, könnte man sagen.
So auch bei „Der langsame Tod der Luciana B.“ (original 2007). Ein namenloser, nicht sonderlich erfolgreicher Schriftsteller übernimmt vertretungsweise von dem enigmatischen und sehr erfolgreichen Kollegen Koster die „Schreibkraft“ Luciana B. Eine hübsche junge Frau, deren Talente beim Diktataufnehmen unschlagbar sind. Luciana wirft dem namenlosen Ich-Erzähler die Brocken hin, nachdem sie sich von ihm sexuell belästigt fühlt. Zehn Jahre später kontaktiert sie ihn wieder, heruntergekommen an Leib und Seele. Sie bezichtigt Koster, ihren Verlobten, ihre Eltern, ihren Bruder und ihre Großmutter umgebracht zu haben und befürchtet nun, er habe es auch auf ihre kleine Schwester abgesehen. Sie bittet unseren „Helden“ ihr bei dem Beweis zu helfen, dass Koster ein Mörder ist. Denn alle Todesfälle lassen sich irgendwie, aber nicht konkret mit Koster in Verbindung bringen. Luciana hatte auch Koster gekündigt, nachdem der ihr zu nahe getreten war. Der darauffolgende Prozess hatte Koster seiner neurotischen Ehefrau entfremdet, die kleine Tochter des Paares war dann unerklärlicherweise gestorben. Und für diesen Tod, so behauptet Luciana, mache Koster sie verantwortlich und übe jetzt, nach biblischer Vorgabe, Vergeltung. So teuflisch, so raffiniert, dass man ihn nie und nimmer belangen könne.
Der Erzähler kontaktiert den von ihm beneideten und bewunderten Koster und verwickelt ihn in lange Gespräche, in der Hoffnung, ihm ein Geständnis entlocken zu können. Koster redet – ob aus Eitelkeit, aus echter Reue, oder um falsche Spuren zu legen. Er entwickelt eine Theorie, wonach nicht die Realität, die Wirklichkeit sein Schreiben, seine Texte beeinflusst, sondern seine Kriminalromane die Wirklichkeit prägen. Denn alle Todesarten, die er sich angeblich ausdenkt, realisieren sich mehr oder weniger analog in den Todesarten, aufgrund derer Lucianas Familie peu à peu umkommt. Koster ist der Geist, der die Realität beeinflusst, die sich nach ihm richtet. Und nicht nur nach ihm, denn, so behauptet er, nicht er schreibe seine Werke, sondern ein „Es“ diktiere sie ihm, notfalls sogar gegen seinen Willen. Wobei dieses „Es“ nicht etwa das Freud´sche Unterbewusstsein ist, sondern eine ominöse Entität (oder ein Phantasma), das sich einer genaueren Beschreibung entzieht. Das ist entweder ein Abenteuer des Geistes oder Ausdruck einer psychotischen Megalomanie, die rhetorische Tarnung „perfekter Morde“ oder schlichtweg bescheuerter Fidelwipp. Brillant inszeniert ist es auf jeden Fall. Und diese Brillanz erklärt auch den Feuilleton-Erfolg und den Erfolg bei einem Publikum, das sich Kriminalliteratur am liebsten als „Rätsel“ wünscht, das in einem realitätsgeschützten Raum als intellektuelle Herausforderung für den Armchair Detective inszeniert wird. Also das tut, was der Whodunit des Golden Age auf einem weniger avancierten Niveau immer zu tun vorgab. Martínez rüstet die Modernitätsabwehr dieses Musters intellektuell auf. So wie Borges, ein herausragender Vertreter der literarischen Moderne, es bewerkstelligt hatte, dennoch epistemologisch eine Art phantastische Anti-Moderne zu erbauen, mit bekanntlich fatalen realpolitischen Implikationen (Stichwort Borges und die Junta).
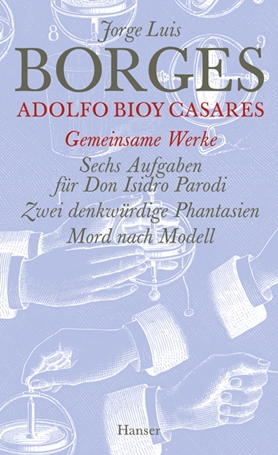
Es gab gute Gründe für die hispanophone lateinamerikanische Kriminalliteratur, sich von dem Übervater Borges zu befreien und sich ins Handgemenge mit den grausamen politischen Realitäten des Subkontinents zu begeben. Grob gesagt, die Rodolfo-Walsh-Tradition (plus die Einflüsse des us-amerikanischen Hardboilers und dem französischen Néo-Polar) führte zur Ausbildung der dann zunehmend dominanten lateinamerikanischen politischen Novela Negra contra Borges, bis er, bei den eher freestyle-haften Konzepten von Claudia Piñeiro aus Argentinien oder Mercedes Rosende aus Uruquay etwa, selbst als Negativfolie verblasst war.
Aber die Realität ist ein mächtiges Ding. Nolens volens sickert sie auch in „Der langsame Tod der Luciana B.“ ein. Selbst wenn die Echos der Rezession von 2002 noch schwach zu spüren sind, so basiert doch der Roman überdeutlich auf dem gesellschaftsimmanenten Machismo, der inzwischen als „(sexualisierte) Gewalt gegen Frauen“, mit den „Femiziden“ als Eskalationsstadium, zurecht in den Fokus gerückt ist. Wenn der Ich-Erzähler Frauen beschreibt, also Luciana und deren Schwester Valentina, dann zieht er sie mit den Augen aus, spekuliert über die Größe ihrer Brüste, und wenn er Kosters Blick auf Valentina beschreibt, spiegelt das nur seinen eigenen wider. Zumal sich beide Herren einig sind, dass Luciana ihre sexuellen Übergriffigkeiten selbst provoziert, in dem sie Dehnungsübungen mit ihrem Hals und Nacken in neckischer Lolita-Unschuld oder aufreizender Absicht macht. Und so etwas führt erst zum Verfall und dann zum Tode. Das ist konsequentes me-too-pur, so ganz ohne Reflexionssignale. Und damit eben doch sehr realistisch, allen philosophisch-metaphysisch-transzendentem Überbau zum Trotz. In solchen Passagen, die ja kein Beiwerk sind, sondern Motor der Handlung, erweist sich das ganze Konzept als das, was es auch auf ästhetisch-intellektueller Ebene ist: Anti-modern, regressiv und letztlich reaktionär.
Will heißen: Kriminalliteratur kann sich, bei aller Artifizialität, nicht von ihren gesellschaftlichen Bedingungen entkoppeln. Eigentlich trivial, aber anscheinend immer wieder gerne ignoriert.
Thomas Wörtche
Guillermo Martínez: Der langsame Tod der Luciana B. (La muerte lenta de Luciana B., 2007). Deutsch von Angelica Ammar. Eichborn/ Bastei-Lübbe, Köln 2021. 220 Seiten, 16 Euro.