Rentabilität statt Qualität
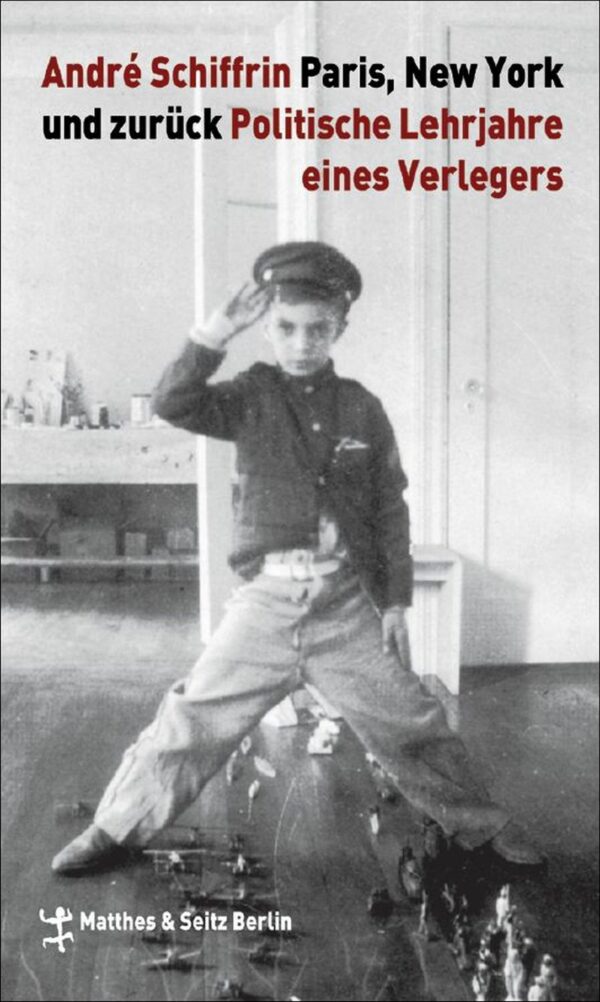
Vor mir liegen zwei Werke des Mannes, der eigentlich mehr Büchermacher als Autor ist. Neu aufgelegt und schon vor zehn Jahren bei Matthes & Seitz sind die „Lehrjahre“ erschienen, es handelt von the making of a publisher. Die Lektüre fand ich so spannend, dass ich mir den Band Verlage ohne Verleger besorgt habe, der im Jahr 2000 bei Wagenbach erschienen war. Das Original des wieder aufgelegten Buchs über die Lehrjahre Schiffrins war schon 2007 herausgekommen. Das scheint lange her, zumal das Buchgewerbe sich in den letzten Jahren rasend schnell verändert hat. Und doch sind beide Bücher aktuell, lehrreich und aufklärend (und auch gut zu lesen). Weit über das eine Gewerbe hinaus schildert diese Nacherzählung der Entwicklung des Verlagswesens die Veränderungen des Kapitalismus seit Mitte des 20. Jahrhunderts – samt Auswirkung nicht nur auf das Lesen, sondern auf die Öffentlichkeit und damit die Demokratie.
André Schiffrin war nicht nur einer der wichtigsten, auch einer der interessantesten Verleger im englischsprachigen Raum – mit Ausstrahlung bis nach Deutschland, von Frankreich in die USA, weil er die amerikanischen Leser mit den französischen Meisterdenkern und Literaten bekannt gemacht hat, von England bis Skandinavien etc.
Der Verleger kommt aus einer russischen Familie, der Großvater wurde von der Revolution enteignet, die Familie floh nach Frankreich, wo der Vater als Verleger die Editions de la Pléiade gründet und bedeutende Intellektuelle wie Jean Piaget und Rabindranath Tagore herausgibt. Ein Teil der frühen Erinnerungen stützt sich auf den Briefwechsel seines Vaters mit André Gide – der der Familie mehrfach geholfen hat. Man erfährt einiges über die Willfährigkeit der französischen Verleger, die Jacques Schiffrin, weil sogenannter Jude, entlassen. Auch in Frankreich haben Nachbarn die Wohnungen ausgereister Juden geplündert.
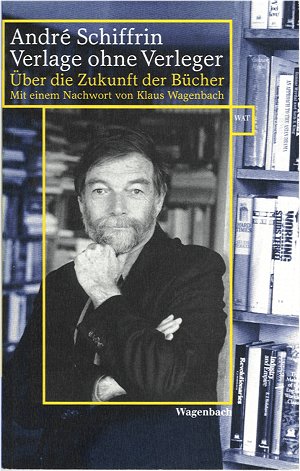
André wurde 1935 in Paris geboren, war also noch ein kleines Kind, als die Familie nach der Besetzung Frankreichs nach Südfrankreich fliehen musste, wo er „eine idyllische Kindheit“ erlebt. Er hat keine „unangenehmen Erinnerungen an die Flucht,“ die dank der Hilfe berühmter Freunde und der Aktion Varian Frys via Casablanca in die USA führt. Der Vater gründet wieder einen Verlag und gibt französische Bücher heraus, André fühlt sich als Amerikaner, ist schon als Schüler, später an der Universität, politisch stark engagiert und bezeichnet sich als Sozialisten. Man erfährt viel über das Amerika unter McCarthy – einschließlich Antisemitismus an amerikanischen Universitäten (maximal 10 % Juden dürfen, Schwarze konnten so gut wie gar nicht studieren), über die Vorgeschichte des Aufbruchs der 60er Jahre und des amerikanischen SDS. In den 50er Jahren wurden bestimmte Bücher nicht mehr herausgegeben oder besprochen, weil Journalisten und Verlagsmitarbeiter Angst hatten, ihren Job zu verlieren, an den Universitäten wurden die Lehrenden, vermutlich auch die Studierenden überwacht, das FBI hatte ein Büro auf dem Campus eingerichtet. Der Informationshunger des Jugendlichen ist riesig, man staunt, was der 15-Jährige alles liest, und erfährt nebenbei, dass es zehn Mal so viele Buchläden gab wie „heute“ – das hat er 2007 geschrieben.
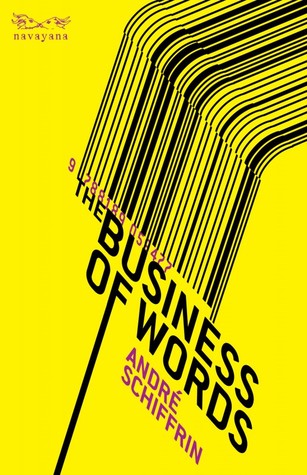
Mit 13 fährt er erstmals seit der Kindheit nach Frankreich, als Student dann für zwei Jahre nach England, und die Unterschiede und Wechselbeziehungen zwischen dem alten und neuen Kontinent, englisches Universitätsleben, die Bekanntschaft mit allen, die Rang und Namen in der intellektuellen Szene haben, und seine ersten Schritte in die Verlagswelt lesen sich wie eine Enzyklopädie des vorigen Jahrhunderts. Noch spannender aber fand ich die Beobachtungen der einzelnen Schritte, mit denen Großunternehmen – wie unter anderem und an prominenter Stelle Bertelsmann – das Verlagswesen zerstörten. Davor und parallel dazu waren ja schon unter Thatcher, Reagan und auch Blair der öffentliche Dienst und viele sozialen Einrichtungen privatisiert worden.
Die Erzählung über Tricks, Betrügereien und Erpressungen, mit denen der so wichtige Pantheon-Verlag kaputt gemacht wurde, hat mich dann bewogen, das Buch über Schiffrins Verlagslaufbahn zu besorgen. Schiffrin hatte, als der Druck der Manager im einverleibten Pantheon-Verlag unerträglich wurde, einen neuen Verlag, The New Press gegründet, dessen Wirkung für das geistige Leben nicht nur in den USA, sondern auch in Europa, immens war. Die Aufzählung nur der wichtigsten Autoren, Götter des Wissenschafts- und Literaturhimmels, würde viele Seiten füllen.
Das vor zwanzig Jahren erschienene und mit einem Nachwort von Klaus Wagenbach versehene Buch über die Veränderungen im Verlagswesen treibt einem die Tränen in die Augen. Vulgarisierung als sicherster Weg zu mehr Profit wurde ja nicht nur in den Bücher- Konzernen zum Credo der Kulturbetriebe. Es ist, schreibt er schon 2000, kein Zufall, dass Neuerscheinungen zunehmend rechtslastig werden. Riesenvorschüsse für Talmi, controlling und marketing ersetzen das Lektorat, das Geschäft wird nur noch über Agenten abgewickelt. Gewinnträchtige Titel werden bei Auktionen versteigert, Lektoren sollten, statt der zuvor üblichen 1 – 2 %, mindestens 15 % Rendite erwirtschaften, Aufkäufe, Rationalisierung, Entlassungen folgen, – all das ist nur exemplarisch, denn, wie Schiffrin schreibt, die Entwicklung gilt für Anwälte, Ärzte etc. genauso.
Als alter Linker schrieb er auch „Die Schlacht um die Leser ist noch nicht völlig verloren.“ Man müsse neue Mittel und Wege zur Beibehaltung eines Diskurses finden, der „früher als unverzichtbarer Bestandteil einer demokratischen Gesellschaft galt“. Es geht eben nicht nur um Bücher und Büchermacher, sondern um die Demokratie.
Als alter Fan von Klein- und Kleinstverlagen schließe ich diese Buchempfehlung mit dem Hinweis, dass – wenngleich mit niedrigen Renditen – hier wo ich lebe, immer wieder kleine Verlage, sogar Print-Zeitschriften und Buchhandlungen gegründet werden und – wenn auch mit Mühe – überleben. Schiffrins zwanzig Jahre alter Trotzdemismus ist offenkundig noch nicht ausgestorben.
Ein Nachwort des kontinuierlich expandierenden Matthes & Seitz-Verlags wäre auch interessant gewesen, das fehlt leider.
Hazel Rosenstrauch
André Schiffrin: Paris, New York und zurück. Politische Lehrjahre eines Verlegers (A Political Education. Coming of Age in Paris and New York, 2007). Aus dem Englischen von Andrea Marenzeller. Matthes & Seitz, Berlin 2010. 254 Seiten, 22,90 Euro.
ders.: Verlage ohne Verleger. Über die Zukunft der Bücher. Klaus Wagenbach Verlag, Berlin 2000. 128 Seiten, 9,10 Euro.
Hazel E. Rosenstrauch, geb. in London, aufgewachsen in Wien, lebt in Berlin. Studium der Germanistik, Soziologie, Philosophie in Berlin, Promotion in Empirischer Kulturwissenschaft in Tübingen. Lehre und Forschung an verschiedenen Universitäten, Arbeit als Journalistin, Lektorin, Redakteurin, freie Autorin. Publikationen zu historischen und aktuellen Themen, über Aufklärer, frühe Romantiker, Juden, Henker, Frauen, Eitelkeit, Wiener Kongress, Liebe und Ausgrenzung um 1800 in Büchern und Blogs. Ihre Internetseite hier: www.hazelrosenstrauch.de
Ihre Texte bei CulturMag hier. Ihr Buch „Karl Huss, der empfindsame Henker“ hier besprochen.Aus jüngerer Zeit: „Simon Veit. Der missachtete Mann einer berühmten Frau“ (persona Verlag, 112 Seiten, 10 Euro). CulturMag-Besprechung hier.











