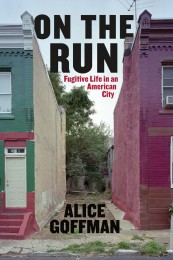 Auf der Flucht
Auf der Flucht
Von einer Bevölkerungsgruppe auf der Flucht, erhobenen Händen als Widerstandsform, empirischer Feldforschung in einem Stadtviertel von West-Philadelphia, von Rahmenhandlungen, totaler Institution, Asylen und Stigmata, vom Battlestar Galaktika und Obamas Unterhaltung mit David Simon über „The Wire“.
Manchmal erzwingt die Aktualität einen zweiten Blick auf ein Buch. Peter Münder hatte sich im September 2014 mit „On the Run“ (siehe hier) beschäftigt. Inzwischen hat sich der Zustand der Nation noch einmal verschärft.
Deswegen hat Alf Mayer Goffmans Studie noch einmal neu beleuchtet.
Warum Walter Scott am Ostersamstag um halb zehn Uhr morgens in der Stadt North Charleston in South Carolina vor dem Polizisten Michael Slager weglief, das lässt einen der Handyfilm des Zufallszeugen nicht verstehen, durch den dieser aktuelle Fall von Polizeigewalt überhaupt öffentlich wurde. Wir hätten sonst wieder von einem berechtigten und notwendigen Schusswaffengebrauch gegen einen polizeibekannten Tunichtgut gelesen. (Hier eine solche aus den üblichen Medienversatzstücken gebaute „Information“.
Ein weißer Polizist kontrolliert einen schwarzen Mann in dessen Auto, geht zur Überprüfung von Daten zu seinem Streifenwagen zurück, sagt, er komme gleich wieder. Der Kontrollierte steigt aus, erhält die Anweisung, sich wieder ins Auto zu setzen, was er auch tut. Doch dann steigt er wieder aus, rennt davon. Wird von fünf der acht auf ihn in den Rücken abgefeuerten Schüssen niedergestreckt, fällt, das Gesicht voran, zu Boden. Der nacheilende Schütze fesselt dem Reglosen die Hände auf den Rücken anstatt Erste Hilfe zu leisten. Immerhin dauert es, nachdem das Video öffentlich wird, keinen Tag, bevor die Polizei selbst von einem Mord spricht.
 Der „nationale Fluch des weißen Rassismus“
Der „nationale Fluch des weißen Rassismus“
Aus Ferguson/Missouri, von Michael Browns Erschießung am 9. August 2014 gibt es kein Video, nur Augenzeugenberichte. Michael Brown hatte die Hände hoch gehoben, als Zeichen, dass er sich ergibt. In der Woche nach Ostern gibt es Luftaufnahmen von einer Verhaftung im kalifornischen San Bernardino County, wo Polizisten einen nach einer Verfolgung sich ausgestreckt hingelegten Mann über 50 Mal treten und schlagen.
Allein im März 2015 erschossen US-Polizisten 115 Verdächtige, so etwa Charly Keunang in Los Angeles, Rony Robinson in Madison, Wisconsin, Anthony Hill in DeKalb County, Georgia, oder Brandon Jones in Cleveland, Ohio. Nein, nicht alle dieser 115 Märzgefallen waren schwarz oder brave Samariter, aber die Lage ist eindeutig, das sagt auch die nach Ferguson eingesetzte Präsidentenkommission. Amerikas Polizei ist rassistisch. CM-Korrespondent Thomas Adcock spricht vom „nationalen Fluch des weißen Rassismus“, der bis ins Jahr 1607 zurückreicht, dem Jahr der Ankunft des ersten Sklavenschiffes aus Afrika.
In Philadelphia erschoss die Polizei in sieben Jahren 400 Menschen – mehr als 80 Prozent von ihnen waren Schwarze. (Der Polizeichef dieser Stadt ist Autor des „White House Task Force Report“, in dem dringend Polizeireformen verlangt werden.) Erst kürzlich setzte die US-Regierung den „Death in Custody Act“ in Kraft, der fortan ALLE Behörden verpflichtet, ALLE „Todesfälle in Gewahrsam“ zu melden. Bisher war das freiwillig und offenkundig ungenügend. 115 Polizeitote als Monatsdurchschnitt, das sind mehr als 1.200 im Jahr – mehr Opfer von US-Polizeikugeln in einem Jahr als alle toten US-Soldaten in 20 Jahren Afghanistan- und Irak-Krieg zusammengenommen. Der Polizist, der Michael Brown in Ferguson erschoss, gab mehr Schüsse ab als die gesamte britische Polizei im Jahr 2013. In der letzten Dekade gab es zwei Jahre, in denen die Polizei in England keinen einzigen Bürger erschoss. (Deutscher Durchschnitt übrigens 7,3 Tote durch Polizistenkugeln, siehe „Stoppt den SEK-Wahnsinn im Fernsehen! Offener Brief an die ARD-Programmkommission“.)
 Nur ein schwarzer, davon rennender Mann
Nur ein schwarzer, davon rennender Mann
Rund 80 Prozent der Polizisten in North Charleston sind weiß, dies in einer Stadt, in der 47 von 100 Einwohner schwarz sind. Warum Walter Scott am Ostersamstag davonrannte, wissen wir nicht. Zehn Arreste verzeichnet sein (in USA sofort öffentliches) Strafregister. 1987 war er wegen häuslicher Gewalt verhaftet worden, also vor 28 Jahren; 1991, weil er einen Knüppel trug. Die meisten Arreste beruhten auf ausstehenden Unterhaltszahlungen. Er war kein Gewalttäter. Nur ein schwarzer, vor der Polizei davon rennender Mann. Chester Himes hob so einen bereits 1960 auf den Titel eines Romans: „Run, Man, Run“ (Lauf, Mann, lauf). Ed McBain titelte schon 1954 „Lauf um dein Leben, Nigger“ (Runaway Black), der deutsche Titel wurde später zu „Harlemfieber“ abgeschwächt.
Es ist dem Verlag Antje Kunstmann zu danken, dass zum Phänomen der weglaufenden schwarzen Männer seit Anfang April ein wegweisendes Buch auf Deutsch vorliegt. „On the Run. Die Kriminalisierung der Armen in Amerika“, von Alice Goffman. Es ist die als Buch gefasste Dissertation der Tochter eines großen Namens, 2011 von der American Sociological Association zur besten Dissertation gewählt – weil sie, so die Begründung , „nicht nur ein wichtiger Beitrag zum Studium von Armut und rassebedingten Benachteiligungen in den USA ist, sondern auch ein Eckstein urbaner Ethnografie, der einer neuen Generation von Feldforschern den Wert und Sinn von respektvoller und aufmerksamer Langzeitbeobachtung des Alltagslebens vor Augen führt“. Im Herbst 2014 wurde die Studie von der University of Chicago Press veröffentlicht, bei CM wurde sie im September 2014 vorgestellt.
Peter Münder beschäftigte sich in seinem CM-Zweiteiler (hier zu Teil 1) ausgiebig mit jener Form empirischen Feldforschung, die sich für ihre Studien tief in das Milieu von Drogendealern und Kriminellen begibt und dann nicht nur mit Titeln wie „Gang Leader for a Day“ oder „On the Run“ aneckt, sondern – ein beliebtes Streitthema bei Ethnologen und Dokumentarfilmern – sich für manchen Geschmack zu sehr bei dieser „Total Immersion“- mit ihrer Klientel identifiziert. Ich selbst finde solches Naserümpfen meist wahlweise abenteuerlich, puristisch oder heuchlerisch, weil dabei gerne die Sache selbst aus dem Blick gerät, um die es eigentlich geht und gehen sollte. Alice Goffman erging es so als eingeladene Rednerin beim ASA-Soziologenkongress, Roberto Saviano konnte es mit „Gomorrha“ erleben, der Brite Gavin Knight ging mit „The Hood“ (2012 bei Ullstein), tiefenscharfe Beobachtungen in London, Manchester und Glasgow, weithin unbeachtet unter.
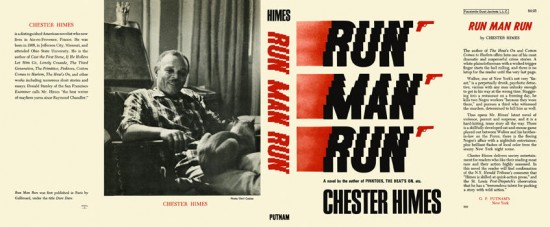
Musil und die Zivilisation
Die Wirklichkeit, wenn man sie uns denn auftischt, wird uns von einem Teil der akademischen Kritik mit allerlei Methodendiskussion möglichst vom Leib gehalten. Das galt schon 1893 für Henry Blake Fuller und seine realistischen Chicago-Roman „The Cliff-Dwellers“ (Die Klippensiedler), in dem er der Gier und den Rassen- und Klassenproblemen der ersten Hochhausstadt Amerikas schockierend nahe kam, viele Zeitgenossen erschreckte, aber ganze Generationen von Schriftstellern prägte. Charles Bowden, auch einer, der für manchen Geschmack ethnografisch zu nahe heran ging, etwa mit „Murder City“, seinem Bericht über ein Jahr in Ciudad-Juarez (dazu AM hier), unternahm in einem seiner allerersten Bücher eine Ehrenrettung Burkes, in „Street Signs Chicago. Neighborhood and the Illusions of Big-City Life“ (1981). Bowdens poetische, auf Bordsteinkante heruntergebrochene Sozialgeschichte Chicagos war nicht nur eine ungemütliche Bestandsaufnahme, sondern ein früher Hinweis auf den Zerfall oder besser Rückfall des „modernen“ Amerikas in alte rassistische Zeiten. „Menschliches Leid ist der Preis solcher Städte“, notierte er, „die Straßen übersät von zerschellten Träumen.“ Robert Musil kommentierte das trocken: „Der Mensch hat sich eine Zivilisation geschaffen, der er nicht gewachsen ist.“
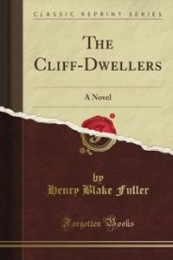 Ein Vor-Ort-Bericht des Gefängnisbooms
Ein Vor-Ort-Bericht des Gefängnisbooms
Alice Goffman näherte sich ihrem Thema nicht wie eine bestens präparierte Expedition mit allerlei Forschungszielen. Sie geriet im westlichen Philadelphia, in West-Philly, als junge Frau auf privater, kleiner und freundschaftlicher Ebene in etwas, das sich ihr allmählich als Milieu und Community herausschälte; sie geriet in eine Welt, der sie in ihrem Buch das Pseudonym „6th Street” gibt, derer sie sich beobachtend, teilnehmend und schreibend versichert. Für manche mag das zu wenig „Forschen“ sein, Erleben aber ist es und Teilhaben. Ebenso sehr wie sie in ihrem Buch eine bestimmte Welt zu beschreiben sucht, schreibt sie sich auch etwas von der Seele. Für manche mag das „Betroffenheit“ oder „Angemaßtes“ sein, bleibt die Frage, wie man denn überhaupt aus einer Welt, die Außenstehende oder Weiße nicht betreten können, berichten kann. Natürlich gibt es auch jene schwarzen Stimmen, die Netzbeschmutzung oder eine Festschreibung schwarzer Existenzen auf Ghetto und Kriminalität vermuten. Aber Herrgott: Es ist einfach dokumentarisch, was Alice Goffman macht, pfeif auf die Etikettenbastler. Es geht um die Sache. Die ist, in Alice Goffmans Worten:
„Dieses Buch ist ein Vor-Ort-Bericht des Gefängnisbooms in den USA: ein Blick aus nächster Nähe auf junge Männer und Frauen, die in einem armen, hauptsächlich von Schwarzen bewohnten Viertel leben, das von einer beispiellosen Inhaftierungsquote und damit einhergehenden, aber mehr im Verborgenen ablaufenden Überwachungs- und Kontroll-Systemen geprägt und verändert wurde. Da die grundlegenden Bereiche des alltäglichen Lebens – Arbeit, Familie, Liebesbeziehungen, Freundschaften und sogar die medizinische Versorgung in Notfällen – von der Angst vor der Festnahme und Haft durchdrungen sind, ist dies eine Studie einer Community on the run – auf der Flucht.“
Wehrlos, die Hände zum Zeichen der Kapitulation erhoben, das ist in den USA seit Ferguson zu einer Demonstrationsgeste geworden. 70 Jahre nach dem (dort zusammengeknüppelten) Friedensmarsch auf die Brücke von Selma – dessen aktuelle filmische Würdigung bei der überwiegend von weißen Jurymitgliedern Oscarverleihung leer ausging –, ist es wieder so weit, dass schwarze Demonstranten Tränengas, Knüppel und Polizeikugeln fürchten müssen, die heute beinahe 800.000 amerikanischen Polizisten aber inzwischen weit militärischer ausgerüstet sind, mit Schützenpanzern, Lärmkanonen und Scharfschützen aufmarschieren. Gegen Demonstranten, die ihre Hände erhoben haben als seien sie Kriegsgefangene. Amerika im Kriegszustand. Zuhause. (Siehe auch den CM-Essay „Wenn der Krieg nach Hause kommt“.)
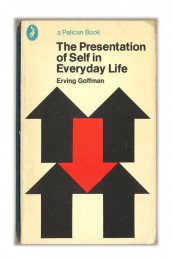 Der FBI-Chef: „Amerika, wir haben ein Rassenproblem“
Der FBI-Chef: „Amerika, wir haben ein Rassenproblem“
James B. Comey, Chef der Bundespolizei FBI, wandte sich am 12. Februar dieses Jahres mit einer Rede des Titels „Harte Wahrheiten. Über Polizeidienst und Rasse“ an die amerikanische Öffentlichkeit. Mit dem Tod von Michael Brown in Ferguson, dem Tod von Eric Garner auf Staten Island und den anhaltenden Protesten im Land „sind wir an einer Wegscheide. Als Gesellschaft können wir uns entscheiden, unsere Leben weiterzuführen, Familien zu haben und zur Arbeit zu gehen und darauf hoffen, dass jemand, irgendwo etwas tun wird, um die Spannungen zu mildern, den Konflikt zu entspannen. Wir können unsere Seitenfenster schließen und um diese Probleme herumfahren oder uns entscheiden, eine offene und ehrliche Diskussion über unsere Verhältnisse zu beginnen …
Als Erstes müssen wir alle im Polizei- und Gesetzesvollzugsdienst aufrichtig genug sein, um einzugestehen, dass vieles unserer Geschichte nicht schön ist. An vielen Punkten der amerikanischen Geschichte hat die Polizei den Status quo durchgesetzt, einen Zustand, der oft brutal unfair zu benachteiligten Bevölkerungsgruppen war. Ich selbst stamme von irischen Einwanderern. Vor einem Jahrhundert wussten die Iren gut, wie die amerikanische Gesellschaft – und die Polizei – sie sah: als Trunkenbolde, Rabauken und Kriminelle. Die voreingenommene Sicht der Polizei auf die Iren lebt bis heute weiter in dem Spitznamen für die Gefangenentransporter. Immer noch ist es der ‚paddy wagon‘.“
Comey bat darum, dass die Amerikaner Polizisten als „vollwertige Menschen“ sehen, räumte aber auch ein, dass „viele von uns im Polizeidienst ihre Anstrengungen verdoppeln müssen, um Vorurteilen und Vorverurteilungen zu widerstehen. Ja, unsere Polizei hat ein Problem mit Rasse.“ Wie groß das ist, weiß man gar nicht offiziell. In seiner Rede erwähnte Comey, dass er kurz nach Ferguson von seinen Mitarbeitern „wissen wollte, wie viele Afro-Amerikaner in diesem Land von der Polizei erschossen werden. Ich wollte Trends sehen. Ich wollte Information. Aber es gab sie nicht. Diese Daten werden nicht regelmäßig von unserem ‚Uniform Crime Reporting Program‘ erfasst. Meldungen dafür sind freiwillig, alle Zahlen sind also unvollständig.“
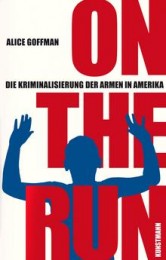 Rahmenanalyse: Der Alltag, von außen geprägt
Rahmenanalyse: Der Alltag, von außen geprägt
Alice Goffman war 19, als sie als junge Studentin mit ihren Feldnotizen in Philadelphia begann. Ihr berühmter Vater starb 1982 im Jahr ihrer Geburt. Gewiss ließen sich viele von Erving Goffman entwickelte soziologische Begrifflichkeiten auf das von seiner Tochter beschrittene ethnosoziologische Feld anwenden. Eine „Rahmenanalyse“ – die beständige Inventur des Umfelds, in dem man sich bewegt, die Reflektion der eigenen und die einem von anderen zugedachte Rolle, die Vermessung der ganzen Theaterbühne, auf der man sich bewegt/ bewegen muss –, das verlangen die Umstände jeden Moment von den jungen, sich auf der Flucht vor Repression befindlichen schwarzen Männern, deren Leben Alice beschreibt. Ihre Protagonisten sind – und dies ist das gesellschaftliche Problem, das mittlerweile sogar der FBI-Direktor beschreibt – in einer Rolle gefangen, aus der es kaum ein Entkommen gibt. Erving Goffman beschrieb das 1959 in seinem Standardwerk „The presentation of self in everyday life“ (dtsch. Wir alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag, 1983) so: „Man versucht, in Interaktionen ein gewisses Bild von sich zu vermitteln, da man weiß, dass man beobachtet wird. Wenn man diesen Gedanken fortführt, kommt man zum Schluss, dass alle Menschen prinzipiell immer Theater spielen und sich eine Fassade schaffen, ein standardisiertes Ausdrucksrepertoire mit Bühnenbild und Requisiten.“ Goffman sagt: „Wenn ein Darsteller eine etablierte soziale Rolle übernimmt (z. B. Kellner), wird er feststellen, dass es bereits eine bestimmte Fassade für diese Rolle gibt.“
Die prototypische 6th Street, in die uns Alice Goffman führt, ist eine vielfältig überwachte „totale Institution“ im Sinne ihres Vaters, in der alle Lebensäußerungen ihrer sozialen Akteure einer vielfältigen Überwachung unterliegen, in der – wie in Gefängnissen oder auf Schiffen – streng zwischen Personal und Verwalteten unterschieden wird.
Auch die 6th Street zählt zu Erving Goffmans „Asylen“, deren Regeln und Gesetze er 1961 in „Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and other Inmates“ (dtsch 1973) beschrieb. Die hierarchische Trennung, postulierte er damals, sei für die sozialen Konflikte und Probleme innerhalb dieser Institutionen verantwortlich. Die jungen Männer der 6th Street und auch Walter Scott aus North Charleston tragen das ihnen von einer rassistischen weißen Gesellschaft aufgedrückte Brandmal. Sie sind stigmatisiert. Auch hier hat der alte Goffman vorgearbeitet mit Stigma. Notes on the management of spoiled identity, (1963, dtsch 2010 als Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität).
Gefängnisstaat U.S.A.
CM-Korrespondent Thomas Adcock erinnert in dieser CM-Ausgabe an den Gefängnisstaat USA, in dem als Ergebnis des „War on Drugs“ einer von sechs schwarzen Männern in USA hinter Gittern ist: „Zwischen 1980 und 2008 hat sich die Zahl der Gefangenen in USA von 500.000 auf gut 2,3 Millionen mehr als vierfacht. Beinahe die Hälfte dieser Männer ist schwarz, meist sind sie wegen nicht gewalttätiger Drogendelikte verurteilt – in einem Land, das zu zwölf Prozent schwarz ist.“ 2010 saßen in den Staatsgefängnissen ein Drittel und in den übergeordneten Bundesgefängnissen mehr als die Hälfte aller Insassen wegen Drogendelikten ein.
Die zentralen Charaktere in Alice Goffmans Bericht sind Mike und Chuck, sie wurden Freunde, wohnten sogar zusammen. Alice war oft die einzige Frau unter den jungen Männern, die einzige Weiße ohnehin. Als sie neu im Viertel war, wurde sie für eine Polizistin oder eine Bewährungshelferin gehalten, andere Zuschreibungen sind dort für weiße Frauen nicht vorgesehen. Chuck, dessen Mutter eine Crackdealerin gewesen war, und seine beiden jüngeren Brüder waren ständige Kunden der Gefängnisse und Verwahranstalten des Viertels. Mike, der etwas behüteter aufwuchs, landete dennoch für dreieinhalb Jahre im Gefängnis, musste in der Zeit, in der er draußen war, 51 Mal vor Gericht erscheinen, für jedes Mal Nichterscheinen mit Arrest bedroht. In Mikes und Chucks Welt war (und ist) so etwas völlig alltäglich – und ist ein ständiges Problem auch für ihre Umgebung. Denn die Polizei, so berichtet Alice Goffman mehrfach, bedroht „unkooperative“ Freundinnen und Familienmitglieder mit dem Entzug der Sorgerechte ihrer Kinder. Eine Mitteilung an die Jungendfürsorge, dass eine junge Mutter einem Drogendealer Unterschlupf gibt, reicht aus, um ihre Kinder ins Heim zu bringen. Diese Freundinnen sind so ständig unter Druck, ihre Freunde oder ihre Kinder zu verlieren. Verrat und Misstrauen liegt wie ein Schatten über der Gemeinschaft, verstärkt die männliche Gangbildung.
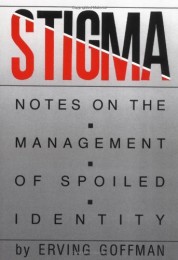 „Bericht aus einem besetzten Land“
„Bericht aus einem besetzten Land“
Der „Krieg gegen die Drogen“ entlarvt sich hier als gemeinschaftszerstörende Strategie. Nur eine höchst prekäre Existenz gewährt er jenen jungen Männern, die dauernd in und aus dem Gefängnis sind, immer auf der Flucht, immer in Gefahr, schon wegen Kleinigkeiten oder Missverständnissen wieder in der Mühle zu landen. Ohne Chance je auf einen anständigen Job. Ohne Chance, in die Welt der „Sauberen“ übertreten die zu können, die Alice Goffman auch beschreibt.
70 Jahre nach dem Bürgerrechtsjubiläum von Selma zeigt Alice Goffman, dass die jungen schwarzen Männer der 6th Street ihrer Bürgerrechte beraubt sind, dass sie wie Flüchtige leben. „Das ist die niedrigste Sorte Menschen in unserem Land, wenn der Staat auf der Jagd nach dir ist.“ James Baldwins „Bericht aus einem besetzten Land“, auch daran erinnert Thomas Adcock, datiert von 1966, fast 60 Jahre später scheint davon etwas sogar in der selbstkritischen Rede des FBI-Chefs auf, wenn er davon spricht, dass die Polizei in Amerika zu oft den Status quo durchgesetzt hat. Bei Baldwin, der entsprechend verfolgt wurde, klang das 1966 so: „The police are simply the hired enemies of this population: they are present to keep the Negro in his place and to protect white business interests, and they have no other function.“
Kleindealer und Kleinkriminelle gab es auf Goffmans 6th Street – und dauernde Polizeipräsenz. Als sie 2001 ins Viertel kam, galt dort eine nächtliche Ausgangssperre für alle unter 18, „was im Grunde bedeutete, dass jeder unter 30 jederzeit angehalten, durchsucht und kontrolliert werden konnte. In meinen ersten 18 Monaten gab es nur fünf Tage, an denen ich nicht sah, wie die Polizei Autos oder Fußgänger anhielt, sie durchsuchte, ihre Namen durchs System laufen ließ, ob es offene Zustellbescheide oder was immer gegen sie gab, oder sie zum Verhör einbestellte. 52 Mal sah ich in dieser Zeit die Polizei Türen eintreten, Häuser durchsuchen, Mobiliar zertrümmern, Menschen jagen, Hubschrauber mit Flutlicht über dem Viertel. 14 Mal in diesen ersten eineinhalb Jahren sah ich, wie Polizisten mit ihren Schlagstöcken auf jungen Männern einschlugen und prügelten, sie traten oder würgten. In einem solchen Viertel entwickelt man ein anderes Verhältnis zur Polizei. Wer kann, rennt davon.“
Alice Goffman übrigens zerstörte all ihre Feldnotizen und Aufzeichnungen aus Sorge, sie könnten beschlagnahmt und in Verfahren verwendet werden. Die 6th Street, lernte sie später in Gesprächen mit Polizeibeamten, galt noch nicht einmal als besonders schlimmes oder besonders armes Viertel. Es war nicht einmal richtig auf dem Radar der Polizei.
Ihre Bewohner erlebten die Polizei dennoch als Besatzungsmacht. Goffman beschreibt ein Viertel, in dem das Vertrauen vor die Hunde gegangen ist, wo junge Männer sogar ihre Freundinnen vermeiden, wo eine Untergrund-Ökonomie des „fugitive life“ entstanden ist, die zum Beispiel auch sauberen Urin an junge Männer mit Bewährungsauflagen verkauft.
All dies lernen schon die Kinder. In ihrer ersten Woche sah Alice Goffman zwei kleine Jungs „Jagen und Nageln“ spielen. Der kleine „Polizist“ durchsuchte die Taschen des anderen, fand eine Münze und lachte und schrie: „Das beschlagnahme ich.“ Im Monat darauf sah Alice, wie die Kinder mit auf den Rücken gelegten Armen rannten und spielten, als trügen sie Handschellen, würden sie über ein Auto oder an die Wand gelehnt oder müssten sich flach auf den Boden legen, die Hände am Kopf verschränkt. Und sie riefen: „I’m gonna lock you up! I’m gonna lock you up and you’re never coming home!“
Bewegende und erhellende Lektüre sind auch die „Notizen zur Methodik“ im Anhang. 67 persönliche Seiten, auch allen Anhängern der „reinen“ Ethnografie, was immer sie wäre, empfohlen. Ein kleiner Auszug:
„Ich lernte auf Stichwort, in kurzen Intervallen und von Lärm umgeben zu schlafen; zwischen Schüssen und anderen lauten Knallgeräuschen zu unterscheiden, wegzurennen und mich zu verstecken, wenn die Polizei kam; die Automodelle, Haarschnitte und Körpersprache von verdeckten Ermittlern zu erkennen. Ich lernte, wie ich durch eine Kontrolle kam, ohne mich selbst oder andere in Gefahr zu bringen, und wie ich während der Vernehmungen schwieg, um keine Informationen preiszugeben. Ich lernte, eine Frau in enger Verbindung zu einem Mann auf der Flucht zu sein, mit ihm seine Verfolgungsjagd und seine Festnahme, seine Gerichtstermine, seine Zeit in Haft und seine Entlassung durchzustehen.“
Das nächste logische Buch im verdienstvollen Kunstmann-Programm wäre nach David Simons „Homicide. Ein Jahr auf mörderischen Straßen“ und „The Corner.Bericht aus dem dunklen Herzen einer amerikanischen Stadt“sowie Alice Goffmans „On the Run“ nun Ridley Balkos „The Rise of the Warrior Cop. The Militarization of the American Police“, auf das ich bei CM mehrfach hingewiesen habe. Hallo, deutsche Verlage, es gibt sie, die wichtigen Sachbücher (siehe dazu hier und hier).

Obama redet mit David Simon über „The Wire“
Der Grund, warum du Militär und die Polizei voneinander trennst, sagt Admiral William Adama in „Battlestar Galactica“, ist der, „dass die einen die Feinde des Staates zu bekämpfen haben, während die anderen die Bürger beschützen. Wenn das Militär zu beidem wird, dann kann es sein, dass die Bürger zu Staatsfeinden werden“.
Jetzt im März 2015 lud US-Präsident Obama den Schöpfer der US-Serie „The Wire“ ins Weiße Haus und interviewte ihn in einem bei uns so nicht denkbaren Gespräch vor der Kamera. David Simons HBO-Serie lief von 2002 bis 2008. Sie zeigt den Stadtkosmos Baltimores und kreist um das Scheitern des „War on Drugs“, des amerikanischen Gefängnissystems und der Zivilgesellgesellschaft. Obama bezeichnete dabei „The Wire“ als „one of the greatest pieces of art in the last couple of decades“. David Simon, der frühere Polizeireporter der „Baltimore Sun“, fasste seine Erfahrungen so zusammen: „Was die Drogen nicht zerstören, das wird vom ‚Krieg gegen die Drogen‘ in Stücke gerissen.“ Obama – dies klar auf Haushaltsverhandlungen und zur republikanischen und Tea-Party-Seite hin gemeint – betonte in dem Gespräch immer wieder die ökonomischen Kosten des Gefängnissystems und dass junge Männer wegen ihrer Haftstrafenvergangenheit trotz aller neu geschaffener Jobs oft keine Anstellungen fänden. „Wir müssen ihnen einen Pfad eröffnen zu einem selbstverantworteten Leben. Mit Härte kommen wir nicht weiter.“ Hier, besser: hier)
Im amerikanischen Senat aber regieren die Hardliner der „Tough on Crime“-Haltung. So bleiben sie also wohl auf der Flucht, Amerikas junge schwarze Männer.
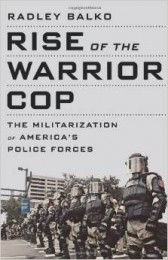 Wählengehen können – vergiss es
Wählengehen können – vergiss es
Nachsatz: Mit dem Wählen übrigens ist das für die Männer auf der Flucht so eine Sache. In Ferguson, wo über Monate demonstriert wurde und politisches Bewusstsein gewiss Artikulation gefunden hat, lag jetzt bei den Stadtratswahlen die Wahlbeteiligung der schwarzen Bevölkerung bei 30 Prozent, doppelt so hoch wie zuvor. Immerhin ist das Gremium jetzt paritätisch besetzt, entspricht aber längst noch nicht den Verhältnissen in der Stadt. Besonders die republikanisch regierten US-Bundesstaaten tun sich damit hervor, immer neue Hürden für die Eintragung ins Wahlregister zu errichten. Angeblich geht es um die Verhinderung von Wahlbetrug (wofür Schwarze ja notorisch bekannt zu sein scheinen). Sogar der von Ronald Reagan ernannte Bundesrichter Richard Posner nannte solche Gesetze pure Schikane zum Schutz republikanischer Mehrheiten. Sie stünden in der bösen Tradition jener Gesetze, die Analphabeten aus den Wahllokalen verbannt haben. Vom Wahlrecht Gebrauch machen kann in den USA nur, wer ins Wahlverzeichnis eingetragen ist. Jeder Bürger muss sich darum selbst bemühen. Wer bei einer Gemeinde etwa durch ein Strafmandat aus einer Verkehrskontrolle Schulden hat – und es werden gerade Schwarze unverhältnismäßig oft kontrolliert – und nicht bezahlt, dessen Schulden bei der Gemeinde wachsen an, sie potenzieren sich schnell. Auch können Gläubiger generell die Wählerverzeihnisse einsehen, das Eintreiben von Schulden und Gebühren ist ein lukratives Geschäft, wie Krimileser aus allerlei bail-bondsmen-Geschichten wissen.
Während diese Zeilen entstanden, wurde wieder ein Video öffentlich, in dem in Tulsa/ Oklahoma ein 73 Jahre alter Reserve-Sheriff einen davonflitzenden Schwarzen erschießt. Er habe seine Pistole mit seinem Elektroschocker verwechselt, sagte er als Begründung.
PS: Als klassisch Erving Goffman’sche Rahmenhandlung und Setting einer gesellschaftlichen Theaterbühne lässt sich natürlich die berühmte Schachszene aus „The Wire“ lesen. In „The Buys“, Episode 3 der ersten Staffel, also ziemlich zu Beginn der insgesamt 60 Folgen erklärt der Drogendealer D’Angelo zwei seiner Jungs die Verhältnisse im Viertel mit dem Schachspiel, übersetzt die Regel in den Straßenslang – ein wunderbares Stück Poesie im Fernsehen: „This the king pin. Aw right? Now he da man. You get the other dude’s king, you got the game.” Bodie fragt nach den Bauern: „What about the little ball-headed bitches there?” D’Angelo erklärt ihm, wie ein Bauer zur Dame wird, wenn er die andere Seite des Schachbretts zu erreichen vermag, wie die Bauern aber in Wirklichkeit oft geschlagen werden, was im Schach den Tod bedeutet: „The pawns, man, in the game, they be capped quick. They be out early.” Bodie, immer auf der Suche nach einem Vorteil, meint dazu: „Unless they some smart ass pawns.”
Die Schachszene in „The Wire“:
PPS: Seit 2007 liegt in Hollywood das Script für „L.A. Riots“, in dem John Ridley die Rassenunruhen von 1992 aufzuarbeiten sucht, die nach Bekanntwerden der Polizeibrutalität gegen Rodney King ausgebrochen waren. Spike Lee war als Regisseur vorgesehen, nach John Ridleys Drehbucherfolg mit „Twelve Years a Slave“ kam Justin Lin an Bord, der sowohl in Sundance mit Autorenfilmen wie mehrfach mit „Fast and Furious“-Blockbustern reüssierte. Das Projekt ruht derzeit wieder. Justin Lin dreht die Pilotepisode der zweiten Staffel von „True Detective“.
Jetzt im April 2015 erschienen ist eine fiktionale Bearbeitung der Unruhen von 1992, „All Involved“ von Ryan Gattis, in dem er aus siebzehn Haupt- und vielen Nebenperspektiven eine explodierende Stadt beschreibt. Gangmitglieder, Feuerwehrleute, Krankenschwestern, Grafitti-Kids und Underdogs erhalten eine Stimme. Die Kritik spricht bereits von einem neuen Richard Price der East-Coast.
PPPS: Immersive oder interaktionistische Ethnografie wie die von Alice Goffman hat in den USA eine lange Geschichte, ist eng mit den Anfängen des Muckracking im Journalismus verbunden. Ganz wörtlich, das Wühlen im Schmutz, auch „slum ethnography” genannt. Dies schon zu Zeiten, als die amerikanischen Slums vorwiegend irisch, italienisch oder jüdisch waren. Die klassischen Studien tragen Titel wie „The Gold Coast and the Slum (1929), „Street Corner Society: The Social Structure of an Italian Slum (1943) oder „ The Social Order of the Slum“ (1968). Die amerikanische Originalausgabe des Buches von Alice Goffman zeigt zwar eine freudlose Gasse zwischen zwei heruntergekommenen Häusern, niemand aber würde sich heute trauen, in einem Buch über amerikanische Städte das Wort „Slum“ groß herauszustellen.
Alf Mayer












