Schmonzetten, Schmäh und Parodie
 Plakat von Paul Haase aus dem Jahr 1912
Plakat von Paul Haase aus dem Jahr 1912
Wort- und Tondichtungen des frühen 20. Jahrhunderts aus den Beständen des Deutschen Musikarchivs der Deutschen Nationalbibliothek auf Youtube
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ziehen Tonträger in die Privathaushalte ein. Musik ist nicht mehr an Konzerthallen oder Hausmusikabende, nicht mehr an den Moment gebunden. Auf Phonographenwalzen oder später auf Schallplatten aus Schellack kann Ton in die eigenen vier Wände geholt werden. Ein damit häufig verbundenes Bild zeigt ein gutbürgerliches Wohnzimmer mit Familie vor einem Grammophon. Doch welche Musik über diese frühen Plattenteller lief, zeigt das Bild nicht: Statt großer Orchesterstücke und opulenter Arien könnten auch Witze, Gedichte oder Zeitkritik aus dem Trichter geklungen sein. Denn nicht nur die Entwicklung der Tonträger- und Abspielgerätetechnik gewinnt in dieser Zeit an erheblichem Schwung, sondern auch die Unterhaltungsindustrie, insbesondere das Kabarett und Varieté.
In den europäischen Großstädten entstanden nach französischem Vorbild (beispielsweise des Le Chat Noir in Paris) mit Beginn des 20. Jahrhunderts neue Theater und Kleinkunstbühnen. Berlin, Wien und Budapest waren die Metropolen des deutschsprachigen Kabaretts. Andernorts – so in München, Hamburg, Leipzig oder Zürich – eröffneten ebenfalls bedeutende Spielhäuser. Das Ende des Deutschen Kaiserreichs und dessen strenger Theaterzensur begünstigte diese Entwicklung.
Kabarettisten, Volkssänger, Diseusen und Gesangskomiker und -komikerinnen nutzen nicht nur die Bühne sondern auch die Tonaufnahme. Insbesondere für die Phonographenwalzen waren deutliche Sprachaufnahmen besser geeignet als komplexe Orchesterstücke, da sich die Aufnahme- und Abspielqualität deutlich von der heutigen unterschied. Im Verlauf der 1920er-Jahre kam das Radio als publikumswirksame technische Neuerung hinzu. Zu den am häufigsten aufgenommenen Kabarettisten und Kabarettistinnen zählen Otto Reutter, Claire Waldoff, Paul O‘Montis und Willy Rosen, aber auch Martin und Paul Bendix, die heute weniger bekannt sind.
Sie beschreiben komische Alltagssituationen ("Wofor is‘ er denn, der Sonntachmorgn? Dass der Mensch sich in sein Bette drückt und verjisst die janzen Alltachssorgn!" – Paul Graetz) und tönen in derben Versen ("Was ist das grässlichste in unserem Sein? […] ‘ne alte, dürre, böse Schwiegermutter!" – Robert Johannes). Klischees werden zuhauf bedient. Auch Zeitkritik und Politisches sind in unterschiedlicher Form vertreten: Otto Reutter erwähnt augenzwinkernd die immer neuen Wahlen in der Weimarer Republik, Willy Rosen bindet den Völkerbund in sein "Wenn das Wörtchen ‚Wenn‘ nicht wär!" ein und Anton Wildgans prangert mit seinem "Lied des Schmarotzers" Reichtum und Arbeitswut an. Beliebt waren auch Mundartdichtungen oder Parodien. So wurden die Schauspieler Alexander Moissi und Max Pallenberg gleich von mehreren Kabarettisten nachgeahmt. Technische Neuerungen werden genauso kommentiert ("und wenn man diesen Knopf berührt: Denn sieht man hier im kleen' Fensta, was alles in der Welt passiert." – Ernst Suppek) wie das Verkehrsaufkommen der Großstädte ("Zwei Beamte mussten so lange störend in den Verkehr eingreifen bis der dritte Gelegenheit hatte, ihn wieder zu regeln." – Paul Nikolaus).
Nicht nur die Aufnahmen beinhalten zeitgeschichtlich interessante Informationen, sondern ebenso das Medium Tonträger selbst. In Zeiten von Mangelwirtschaft, bedingt durch zwei Weltkriege und die Weltwirtschaftskrise, wurden viele Schallplatten wieder abgegeben und gegen neue getauscht. Denn Schellack kann eingeschmolzen und erneut verwendet werden. Das lässt den Schluss zu, dass die Tonträger, die heute noch erhalten sind, sehr oft angehört wurden – dementsprechend abgespielt sind sie bisweilen, was schließlich dem Digitalisat der Aufnahmen anzuhören ist. Im Gegenzug kann das bedeuten, dass speziellere Platten heute nicht mehr erhalten sind. Statt einer Aufnahme, der wir heute einen hohen künstlerischen Wert zusprechen würden, ist vielleicht ein unterhaltendes Couplet geblieben.
Das NS-Regime bedeutete wie für viele andere Künste einen Bruch für die vielfältige Kabarett- und Varietélandschaft. Weil ihre Musik und Texte als entartet angeprangert wurden, die Künstler und Künstlerinnen jüdische Wurzeln hatten, politisch unliebsam waren oder in homosexuellen Partnerschaften lebten, wurde Unzähligen schrittweise ab 1933 jedes weitere öffentliche Auftreten verwehrt. Ihre Lieder und Sketche durften nicht mehr im Radio gespielt werden. Nicht wenige wurden verfolgt. Viele Kabarettisten zogen sich zurück oder gingen ins Exil wie z.B. Willy Rosen, Kurt Gerron oder Max Ehrlich: Sie gründeten Exiltheater in Wien, Zürich und Amsterdam, manche sogar in Skandinavien und den USA oder spielten in deren Ensembles. Doch wo die deutschen Truppen später einmarschierten, waren auch die Kabarettistinnen und Kabarettisten im Exil nicht mehr sicher: Rosen, Gerron und Ehrlich wurden deportiert und in KZs umgebracht, ebenso wie Paul O‘Montis, Paul Bendix, Franz Engel, Paul Morgan und Ernst Suppek.
Heute erinnert man sich wieder einiger großer Namen der damaligen Unterhaltungskultur. Andere zu Beginn des 20. Jahrhunderts erfolgreiche Sängerinnen, Sänger, Komikerinnen und Komiker sind jedoch fast aus dem kulturellen Gedächtnis verschwunden. Aus den mittlerweile über 250.000 Schellackplatten und Phonographenwalzen in seinem Bestand bringt das Deutsche Musikarchiv mit "Schmonzetten, Schmäh und Parodie" diese Aufnahmen gesungenen und gesprochenen Wortes auf Youtube wieder zum Klingen.
Pressetext ©Deutsche Nationalbibliothek

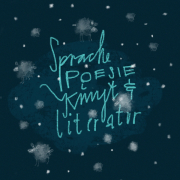

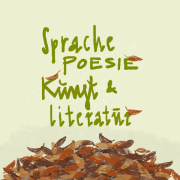
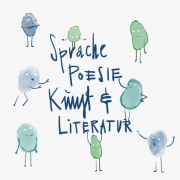
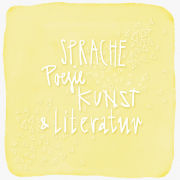
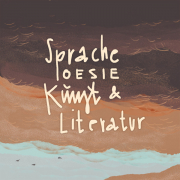
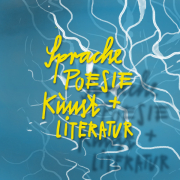
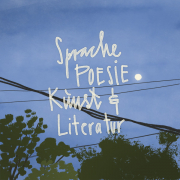
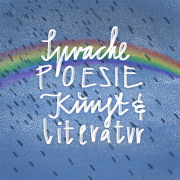
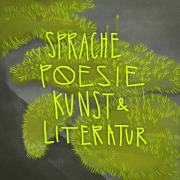
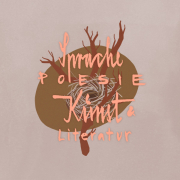
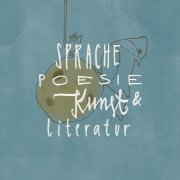
Neuen Kommentar schreiben