Linolgeschnitten
 Claas Gutsche - 'Archiv'. Aus der Mappe "3 x 2" der Linoschneider Philipp Hennevogl, Claas Gutsche und Sebastian Speckmann. (Quelle: Frankfurter Büchergilde)
Claas Gutsche - 'Archiv'. Aus der Mappe "3 x 2" der Linoschneider Philipp Hennevogl, Claas Gutsche und Sebastian Speckmann. (Quelle: Frankfurter Büchergilde)
Nur eine kurze Zeit lang zu sehen, noch bis bis 7.3.2020, Montag bis Samstag 10.00 bis 19.00 Uhr, in der Frankfurter Büchergilde Buchhandlung & Galerie: Seit Picasso ist es Kunst: Der Linolschnitt
Es gibt grafische Techniken, vor denen steht man voller Ehrfurcht: die Radierung z.B., die, wenn man es nie live gesehen hat, auf unvorstellbare Weise Farbe aus Plattenvertiefungen saugt, oder die Lithografie, noch unbegreiflicher, weil in mit bloßem Auge nicht sichtbaren Poren eines spiegelglatt geschliffenen Kalksteins, der auch noch „Schiefer“ genannt wird, Partikel eines Fettkreidestifts hängen bleiben, die nach alchemistischer Behandlung des Steins auf diesen aufgewalzte Farbe unter Druck an Papier abgeben. Der Linolschnitt aber, den haben doch (hoffentlich) die meisten von uns schon in der Grundschule selbst ausgeübt, kinderleicht, keine große Kunst also? Mal sehen – im wahrsten Sinne des Wortes:
1903 hat der Expressionist Erich Heckel wohl als erster namhafter Künstler eine Linolplatte als Druckträger für den Hochdruck bearbeitet – Hochdruck heißt die Technik wie auch der Holzschnitt deswegen, weil Vertiefungen in die Platte geschnitten oder geritzt werden, aber nur die unbearbeiteten, dadurch noch hochstehenden Teile eines Druckstocks etwas zu Papier bringen.
Erfunden hat das Linoleum der englische Ingenieur Frederick Walton, der nach einer Rezeptur für schnelltrocknende Farben suchte. Er entdeckte, dass Farben, vermischt mit oxidiertem Leinöl, eine relativ feste, gummiartige Masse ergeben. Für dieses „Linoxin“ erhielt er 1860 ein Patent. Sein Verfahren, diese Masse auf Gewebebahnen aufzutragen, patentierte er 1864, und ab 1867 trat das Linoleum (aus Linum für Lein und oleum für Öl) seinen Siegeszug rund um die Welt an als „warmer, weicher und haltbarer Fußbodenbelag“. Die heutigen Linolschnittplatten bestehen aus Korkmehl, Harz und Linoxin.
Auch Ernst Ludwig Kirchner nutzte 1904/05 Linoleumplatten als Druckstöcke, August Mackes berühmte Grafik „Begrüßung“ von 1912 ist ein Farblinolschnitt, Christian Rohlfs und Otto Pankok begannen ab ca. 1910 in Linol zu schneiden. Aber der weiche, leicht zu bearbeitende Stoff konnte der expressionistischen Idealisierung des „heroischen Materials“ Holz mit seiner Aura des Rohen, Archaischen nicht standhalten, und so versank der Linolschnitt erst einmal wieder im Dornröschenschlaf, aus dem erst Picasso ihn Mitte der fünfziger Jahre weckte.

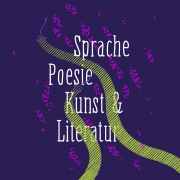


Neuen Kommentar schreiben