
Kurzbesprechungen von fiction – Joachim Feldmann (JF), Alf Mayer (AM), Frank Rumpel (rum) und Thomas Wörtche (TW) über:
Steph Cha: Brandsätze
Lee Child, Andrew Child: The Sentinel. A Jack Reacher Novel
Stephen Hunter: Im Visier des Snipers
Un-Su Kim: Heisses Blut
Martin Michaud: Aus dem Schatten des Vergessens
Denise Mina: Götter und Tiere
Joachim B. Schmidt: Kalmann
Wolfgang Schorlau: Kreuzberg Blues
David Whish-Wilson: Das große Aufräumen
und noch mehr to come … Schauen Sie wieder vorbei.
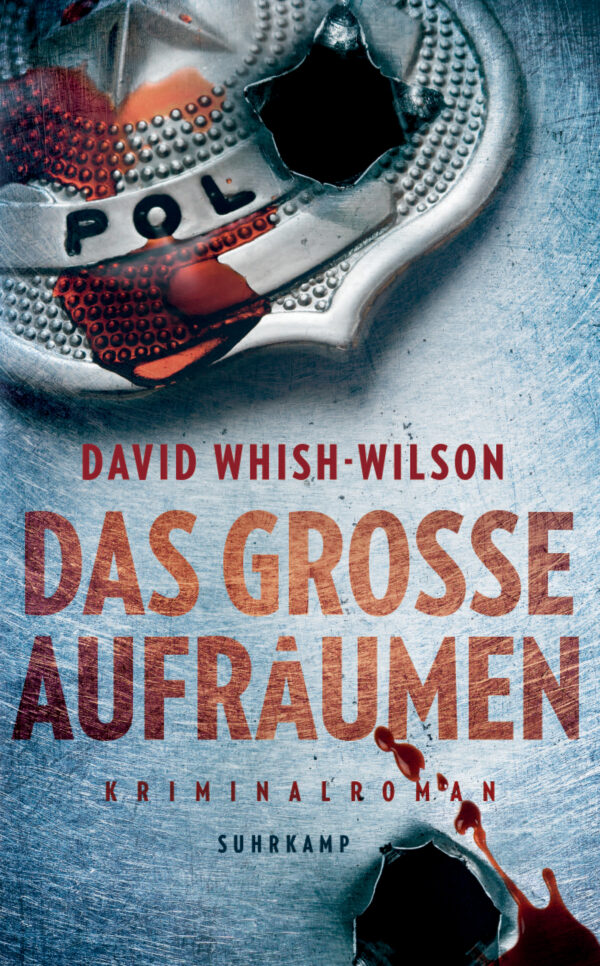
Lakonische Sprache, finstere Welt
(JF) Frank Swann, einst Polizist, dann Privatdetektiv, ist plötzlich ein gefragter Mann. Seit er seinen neuen Job als Sicherheitsberater des frischgebackenen Premierministers von Western Australia angetreten hat, stehen zwielichtige Gestalten Schlange vor seinem Büro. Und sie haben gute Gründe dafür. Denn in Perth, der Hauptstadt des Bundesstaates, werden gerade, wir befinden uns in den frühen achtziger Jahren, die Pfründe aus illegalen Geschäften neu verhandelt. Dabei ist die Grenze zu legalen wirtschaftlichen Aktivitäten ziemlich durchlässig. Wenn ein „langjähriger Pferdewettschieber und Immobilienhai“ in einem leerstehenden Schuhgeschäft seine eigene Bank eröffnen kann, die schon wenig später mit Millionenbeträgen jongliert, erübrigt sich die Frage nach Recht und Gesetz, zumal der Polizeichef es mit jedem professionellen Gangster an Skrupellosigkeit aufnehmen kann.
In einer solchen Umgebung hat es eine ehrliche Haut wie Swann, dem es vor allem um ein friedliches Familienleben geht, nicht leicht. Aber selbst in einer finsteren Welt, wie sie David Wish-Wilson im dritten Roman um seinen desillusionierten Helden beschreibt, gibt es Freundschaft und Loyalität. Swann findet Verbündete, auch auf der anderen Seite des Gesetzes, und überlebt „Das große Aufräumen“, so der deutsche Titel, um Haaresbreite. Für all das die passende lakonische Sprache gefunden zu haben, ist das Verdienst des Autors und seines Übersetzers Sven Koch.
David Whish-Wilson: Das große Aufräumen (Old Scores, 2016). Aus dem australischen Englisch von Sven Koch. Suhrkamp Verlag, Berlin 2020. 329 Seiten, 10 Euro.
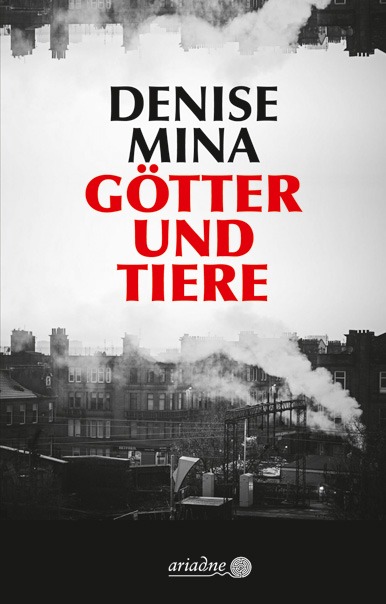
Vielschichtig, sorgfältig und scharfsinnig
(TW) Mit Götter und Tiere ist nach mittlerweile acht Jahren der bisher fehlende dritte Roman aus Denise Minas Alex-Morrow-Serie erschienen. Die fünf Romane um Detective Sergeant Morrow, die in Glasgow Dienst tut, gehören deutlich in den Kontext des „neuen britischen Polizeiromans“ (also in die Linie John Harvey, Ian Rankin, Bill James etc.), touristische Labels wie „Tartan Noir“ sind da eher wenig explikativ. Zu diesem Konzept gehören u.a. ein möglichst scheuklappenfreier Blick auf die Spezifität der jeweiligen Verbrechen in einem bestimmten sozialpolitischen Umfeld, eine gewisse Skepsis gegenüber „Aufklärung“ und „Polizeiarbeit“ und Selbstreflexivität staatlichen Handelns. Es geht um literarische Nachbearbeitung von „Realität“, und weniger um die literarische Generierung von Konzepten von Realität. So auch hier: Morrow hat es, ganz konventionell, mit drei Erzählsträngen zu tun: Mit einem blutigen rätselhaften, anscheinend aus dem Ruder gelaufenen Postraub, mit zwei Streifenpolizisten, die Schmiergeld annehmen und dann lieber zurückrudern möchten und damit in Teufels Küche kommen, und um einen Lokalpolitiker, der unbedingt den Skandal verhindern möchte, dass er ein Verhältnis mit einer minderjährigen Mitarbeiterin hat. Gut, dass Morrow einen profikriminellen Bruder hat, der die großen Zusammenhänge sieht. Streng auktorial erzählt, leuchtet Mina diverse Milieus aus, vom Subproletariat über die Kleinbürger, die korrupten Sphären von Politik und Polizei bis hin zu einem unermesslich reichen Millionär – die, schon fast in schöner demokratischer Einheitlichkeit, ihre kriminellen Aspekte haben. So entsteht eine sehr sorgfältige, vielschichtige und scharfsinnige, fiktiv verkleidete Kriminalreportage über das Glasgow des Jahres 2012 (oder 2010, je nachdem, wann das Manuskript entstanden ist). Als sehr schönes Surplus übrigens sieht man nach der Lektüre die Taxiunternehmen in Großstädten mit ganz anderen Blicken.
Denise Mina: Götter und Tiere (Gods and Beasts, 2012). Deutsch von Karen Gerwig. Ariadne, Hamburg 2020. 348 Seiten, 21 Euro.
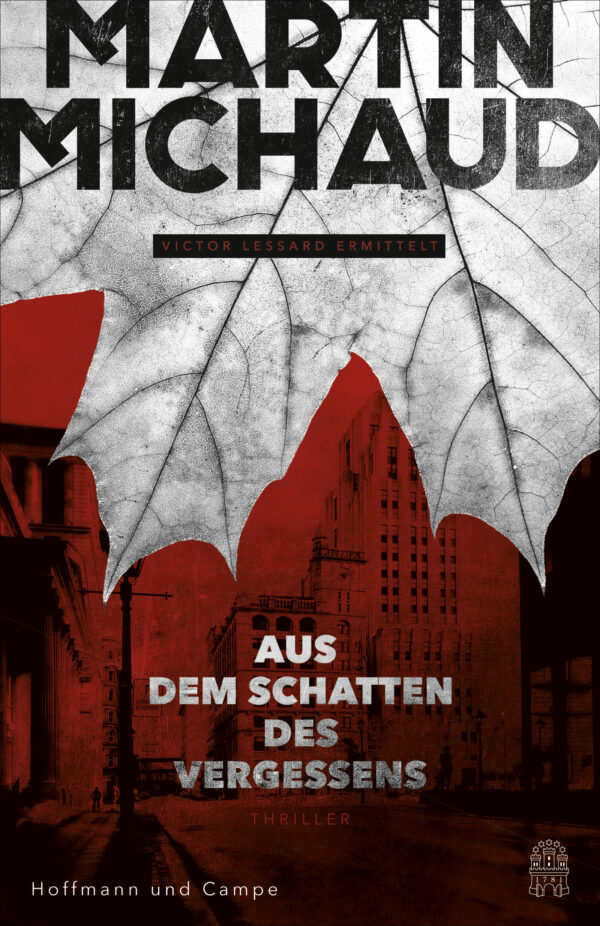
Demnächst als Fernsehserie
(JF) Ein Mord, eine Entführung, ein Suizid – und natürlich weiß weder der ermittelnde Kriminalist noch seine wackere Partnerin, dass alle drei Ereignisse in einem Zusammenhang stehen. Ganz im Gegensatz zur Leserin, die durch einen sensationalistischen Klappentext neugierig geworden, den dickleibigen Thriller Aus dem Schatten des Vergessens des frankokanadischen Autors Martin Michaud erworben hat und sich auf über 600 Seiten Nervenkitzel freut. Leider ist die Reise „in die dunkelsten Abgründe sowohl der menschlichen Seele als auch der amerikanischen Geschichte“, die der Verlag verspricht, mit drögen Dialogen gepflastert. „Der Mörder wollte, dass wir die Zahlen finden“, weiß Victor Lessard, Sergent-Détective bei der Polizei in Montreal. „Warum? Um uns auf eine Spur zu locken?“, fragt Kollegin Jacinthe Taillon. Um herauszufinden, ob die beiden richtig liegen, fehlte ihrem Rezensenten die Geduld. Auf Seite 118 angelangt, legte er die „Thrillersensation aus Kanada“ (Verlagsinformation) zur Seite.
Tatsächlich scheint Michaud in seinem Heimatland ein Bestsellerautor zu sein. Seine bislang fünf Victor Lessard-Reihe Romane sind sogar Grundlage einer Fernsehserie, mit der demnächst auch deutsche Zuschauer beglückt werden. Dass mit „Je me souviens“ nun ausgerechnet der dritte Band übersetzt und als Auftakt der Reihe angekündigt wurde, bleibt ein Geheimnis des Verlages. Aber vielleicht werden, den Erfolg des ziegelsteinformatigen Paperbacks vorausgesetzt, die Vorgänger nachgeliefert. Und wer mag, wird dann auch erfahren, was es mit den „Ermittlungen gegen den König der Fliegen“, an die sich Lessard auf Seite 87 erinnert, auf sich hat. Ihr Rezensent verzichtet schon jetzt.
Martin Michaud: Aus dem Schatten des Vergessens (Je me souviens, 2012). Aus dem kanadischen Französisch von Anabelle Assaf und Reiner Pfleiderer. Hoffmann & Campe, Hamburg 2020. 638 Seiten, 16,90 Euro.
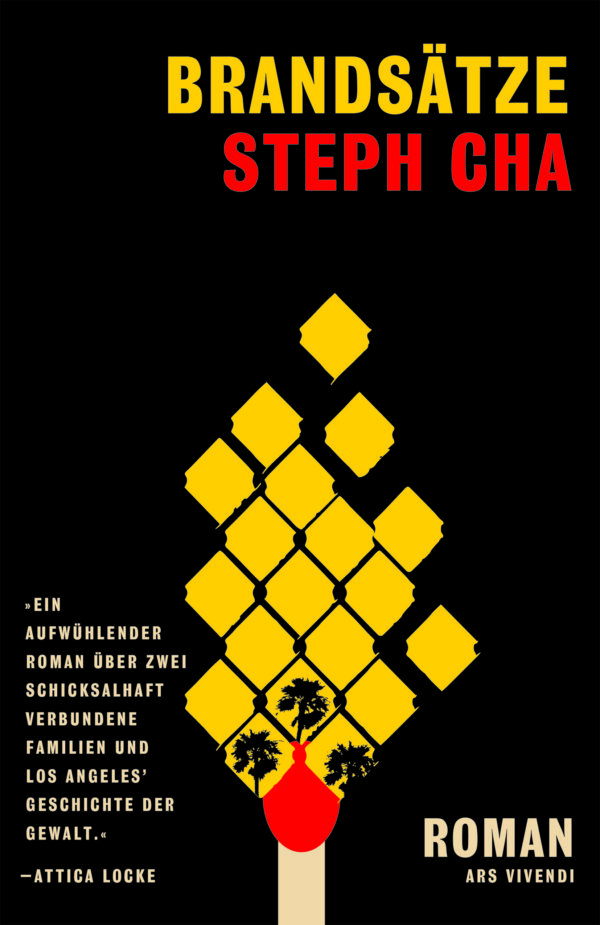
Ausnahmsweise
(TW) Im März 1991 wurde Rodney King Opfer von Polizeigewalt in Los Angeles – zufällig auf Video festgehalten. Die Polizisten (drei Weiße und ein Latino) prügelten und traten den schwarzen King beinahe tot und wurden später freigesprochen. Dieser Freispruch galt als Auslöser der „LA Riots“ von 1992. Ebenfalls im März 1991 wurde die 15jährige schwarze Latasha Harlin von der koreastämmigen Soon Ja Du tödlich in den Hinterkopf geschossen, weil sie angeblich Ladendiebstahl begangen und sich gegen diese Unterstellung gewehrt hatte. Soon Ja Du wurde nicht verurteilt. Die ebenfalls koreastämmige Autorin Steph Cha benutzt in ihrem Roman Brandsätze mit der Thematisierung dieses Skandals auch die Ursachen für die erwähnten „LA Riots“ differenzierter darzustellen. Schon Mike Davis hatte in den 1990er Jahren darauf hingewiesen, dass die Riots keinesfalls nur ein Schwarz gegen Weiß-Ding waren und schon gar nicht ein Schwarz gegen Latinos-Konflikt, wie der bei uns unverständlicherweise (oder ahnungslos) so hochgejazzte Roman „In den Straßen die Wut“ von Ryan Gattis grob ideologisch verzerrend insinuierte. Die Bruchlinie lief eben entscheidend auch zwischen deklassierten Schwarzen und ökonomisch eher prosperierenden asiatischen, insbesondere koreanischen Communities. Steph Chas großes Verdienst ist, das Narrativ über die Entstehung der Riots in diese Richtung korrigiert zu haben. 2019, so setzt die Jetztzeit-Handlung ein, wird die Frau, deren Vorlage in der Realität Soon Ja Du ist, auf einem Parkplatz vor ihrer Apotheke angeschossen und lebensgefährlich verletzt. Ein Racheakt für damals? Steph Cha seziert auf fiktionalem Weg zwei Familiengeschichten, die der schwarzen „Opferfamilie“ und die der koreanischen „Täterfamilie“, deren beider Ressentiments und Vorurteile, die Fälle naiver Benevolenz, den impliziten, ubiquitären Rassismus in einer rassistischen Gesellschaft, deren Toxik beinahe ausweglos erscheint. Auch wenn der Roman ein bisschen arg bieder gestrickt ist (die kluge Übersetzung von Karen Witthuhn hebt schon ein wenig) – in diesem Fall sind mir das Statement und die Positionierung des Buches wichtiger als die ästhetische Ausführung. Ausnahmsweise.
Steph Cha: Brandsätze (Your House Will Pay, 2019). Deutsch von Karen Witthuhn. Ars Vivendi. Cadolzburg. 2020. 336 Seiten. 22 Euro.
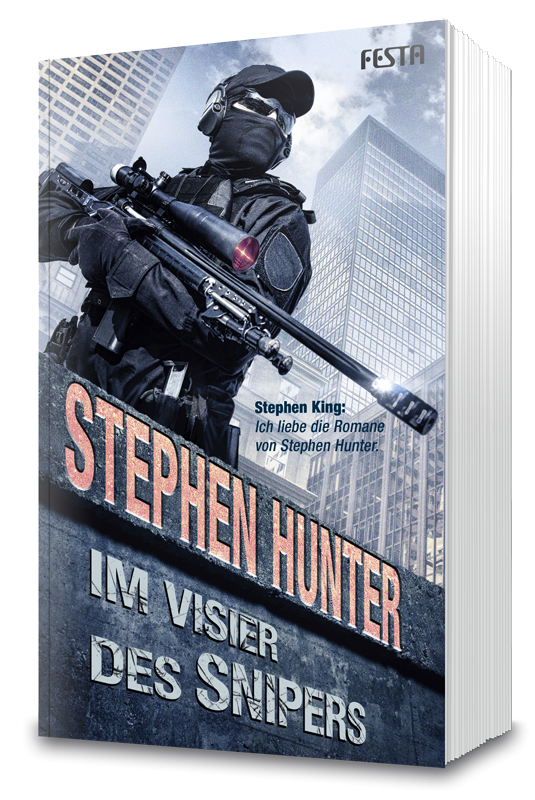
Wenn Scharfschütze, dann der Beste
(AM) „Wollen Sie auch die Daten zu Flanders? Da ist es dasselbe. Genau in die Mitte, wenn man den Winkel zum Ziel bedenkt. Wenn der Kerl auf eine Zielscheibe geschossen hätte, dann wären diese vier Kugeln in einem Bereich von etwa 0,79 Zentimetern gelandet, und das bei verschiedenen Entfernungen und verschiedenen Umständen bei bisher vier Opfern. Kein Mensch kann so gut schießen. Das kann nur Gott.“ So lautet die Expertise von Bob Lee Swagger, den das FBI hinzuzieht, weil die Öffentlichkeit in Aufruhr ist.
Joan Flanders (bei der es sich um die kaum camouflierte Jane Fonda handelt) und drei weitere Berühmtheiten der amerikanischen Antikriegsbewegung sind aus je großer Entfernung von einem Scharfschützen ermordet worden. Alle Indizien weisen auf Carl Hitchcock, den besten Sniper des Vietnam-Krieges (kaum camoufliert: Marine Gunnery Sergeant Carlos Norman Hathcock II, der auf 93 bestätigte sowie über 200 unbestätigte Abschüsse kam, eine Ikone der Konservativen und der NRA). Stephen Hunters Bob Lee Swagger ist wie er aus Arkansas-Holz geschnitzt, jetzt liegt sein (literarisches) Vorbild tot in einem Motelzimmer, mit der eigenen Waffe selbst gerichtet. Fall geklärt. Perfektes Motiv, eindeutige Beweise.
Nur dass die Beweise und gar die Schüsse selbst einen Tick zu perfekt sind. Wer also war in Wirklichkeit der Schütze? Was steckt hinter allem? Unser Textauszug in dieser Ausgabe macht klar: Um einen Scharfschützen zu kriegen, braucht man keine Special Agents, sondern einen Scharfschützen. Ein neuer Fall also für Bob Lee Swagger. Und was für einer, geht es doch neben allerlei politischen Unkorrektheiten auch noch um den „menschlichen Faktor“ versus eines superperfekten Computerprogramms bei der Hochleistungsdisziplin Scharfschießen. Also um das Metier selbst. Kein Autor kennt sich damit besser aus, Stephen Hunter ist ein „gun enthusiast“, aber anders als Don Winslow und andere, die gerne mit allerlei Kalibern hantieren, schafft er es zuverlässig, das auch für Nichtbewaffnete und Nichtmilitärs spannend und anschaulich zu machen.
Im Visier des Snipers (Originaltitel, an Micky Spillane angelehnt: I, Sniper) ist einer der besten Romane von Stephen Hunter, er kommt mit elfjähriger Verspätung zu uns. Aber immerhin. Der Festa Verlag aus Leipzig macht ihn uns in einer klasse Übersetzung von Patrick Baumann jetzt zugänglich. Derzeit sind in diesem Verlag sechs weitere Bob Lee Swagger-Romane verfügbar. Und wie Hunter zu seiner Figur fand, das können sie bei uns nachlesen.
Stephen Hunter: Im Visier des Snipers (I, Sniper, 2009). Aus dem Amerikanischen von Patrick Baumann. Festa Verlag, Leipzig 2020. 592 Seiten, 14,99 Euro.
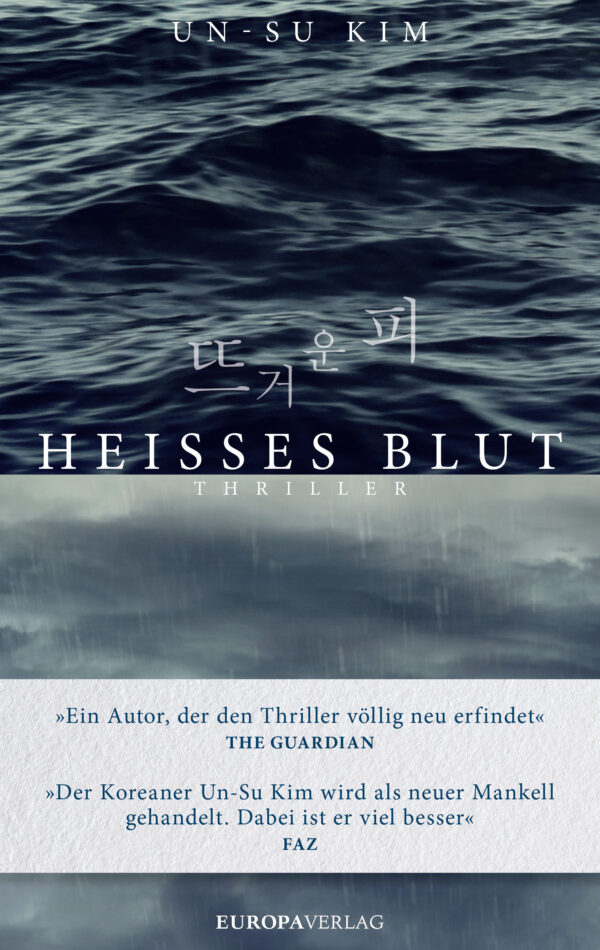
Mythen zerschreddert
(TW) Ein gewaltiges Epos ist Heisses Blut von Un-Su Kim. Eine südkoreanische Gangster-Saga, die in den 1990er Jahren in Busan, und dort in dem Hafenviertel Guam spielt. Hier hält sich der Pate, Vater Son, seit drei Jahrzehnten an der Macht, die Hauptfigur des Romans, Huisu, ist eine Art Consigliere, der aber nicht recht in der Hierarchie vorankommt und entsprechend frustriert ist. Zudem richten andere Clans ihre Begehrlichkeiten auf den Hafen von Guam – ein Krieg bricht los, bei dem jeder gegen jeden kämpft. Robust und sehr blutig, gerne auch bei sorgfältig inszenierten Festivitäten und Gelagen, während der Verzehr von Instant-Nudeln beim Fußvolk beeindruckend ist. Huisu gerät in einen Loyalitätskonflikt, Vater Son verschließt sich dem Drogengeschäft, die korrupten Politiker hängen ihr Fähnchen nach dem Wind, Verbrechen ist ein Weg des sozialen Aufstiegs, auch für Immigranten, die hier aus Vietnam, China oder den Philippinen kommen. Das kommt uns bekannt vor, aus unzähligen Mafia-Narrativen, allerspätestens seit dem „Paten“. Un-Su Kims Roman ist denn auch ein gigantisches Palimpsest, bei dem alle einschlägigen Geschichten und Themen mit koreanischen Verhältnissen überschrieben werden. Mit einem entscheidenden Unterschied: Un-Su Kim kommentiert Figuren und Handlung mit einer sarkastischen, ethisch-wertenden Erzählerstimme, die jede Mythentauglichkeit der Figuren zerschreddert.
Un-Su Kim: Heisses Blut (Tteugeoun Pi, 2016). Deutsch von Sabine Schwenk. Europa Verlag. München 2020. 584 Seiten. 24 Euro. Siehe auch das große Interview von Tobias Gohlis in dieser CrimeMag-Ausgabe.
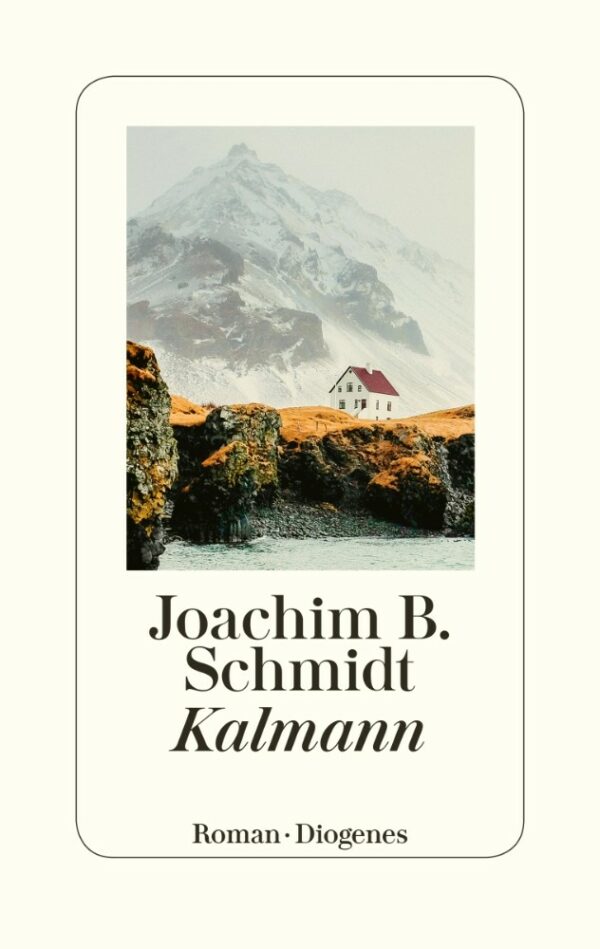
Großes Vergnügen
(TW) Nur ein paar Kilometer vom Polarkreis entfernt liegt im Nordosten Islands das Dorf Raufarhöfn. Früher war die Gemeinde ein lebhafter Umschlagplatz für den Heringsfang, heute hat der Strukturwandel das Dörfchen ausgeblutet, bald wird die Schule schließen, denn nur ganze 175 Einwohner sind übriggeblieben. Am Ende von Joachim B. Schmidts Roman Kalmann sind es noch 173. Kalmann Óðinsson, die titelgebende Hauptfigur, wacht über sein Dorf, ausgerüstet mit Cowboyhut, Sheriffstern und einer Mauser aus dem Koreakrieg. Als Kalmann eine Blutlache findet und der ortsansässige Hotelier und Unternehmer verschwindet, kommt Leben in die abgelegene Gegend. Die Polizei taucht auf, Drogen werden aus dem Wasser gefischt und zudem könnte ein hungriger Eisbär, von Grönland herübergeschwommen, sich gefährlich nahe an Raufarhöfn tummeln.
Der Schweizer Autor Joachim B. Schmidt, der selbst seit dreizehn Jahren auf Island lebt, präsentiert, so gesehen, das ideale Setting für einen klassischen Island-Krimi, oder neudeutsch: Nordic Noir. Bizarre Details wie eine Menschenhand im Magen eines erlegten Hais, dubiose litauische Menschen, die sich an den Rändern der Handlung tummeln sowie ein weiterer rätselhafter Todesfall, der mit dem Verzehr von Gammelhai zu tun haben könnte, verstärken diesen Eindruck noch. Aber die Geschichte wird uns von Kalmann erzählt. Der ist ein wunderlicher Mensch, böse Zungen bezeichnen ihn als den „Dorfdepp“, was entschieden nicht stimmt. Kalmann ist nicht nur ein geschickter Haifischer (und produziert den „zweitbesten Gammelhai auf Island“: gewöhnungsbedürftiges, fermentiertes Haifleisch), Jäger und Spurenleser, sondern auch ein entfernter Verwandter von John Irvings „Garp“ oder Forrest Gump, also ein extrem subjektiver Ich-Erzähler, der ganz eigene Wahrheiten und Einsichten in den Lauf der Welt anbietet. Schmidt benutzt dafür die literarische Technik des „skaz“ – also die hochliterarische Verschriftlichung anscheinend naiven mündlichen Erzählens, bei dem wir über den Wahrheitsgehalt des Erzählten nur das wissen können, was durch den Filter von Kalmanns Weltbild durchdringt. Dabei wissen wir auch nicht, was er verschweigt. Und wir wissen nicht, wie naiv Kalmann wirklich ist und können nur spekulieren, ob er leicht retardiert ist oder einfach nur ein sehr origineller Kopf.
Das berührt eine Kernfrage des Kriminalromans an sich. Denn der muss ja, um eine Realität hinter der Realität aufdecken zu können, eine stabile erste Realität etablieren. Das tun Kalmann, der Roman, und Kalmann, die Figur, gerade nicht. Zumindest nicht bis zu dem Punkt, an dem Kalmann selbst enthüllt, was es mit dem verschwundenen Hotelier auf sich hat. Auch diese Enthüllung steht dann natürlich unter dem grundsätzlichen Vorbehalt der Erzählperspektive. Das ist sehr tricky gemacht und bietet, neben grandiosen Vignetten über das Leben in einem gottvergessenen Winkel der Welt, über die raue Natur und über die Menschen, die dort ausharren, ein erhebliches intellektuelles Vergnügen.
Kalmann ist ein großartiger Nicht-Kriminalroman, der, weil in der Negation das Negierte bestehen bleiben kann, dennoch ein großartiger Kriminalroman ist.
Joachim B. Schmidt: Kalmann. Diogenes, Zürich 2020. 351 Seiten, 22 Euro.
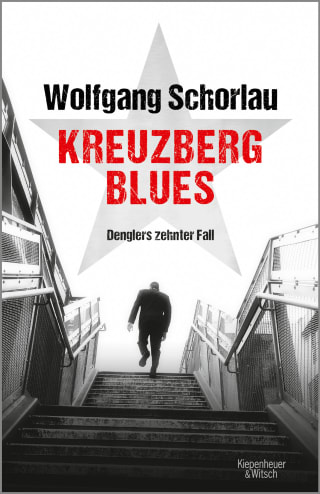
Querdenker und Miethaie
(rum) Um Mieter loszuwerden, zieht eine Immobilienfirma in Berlin alle Register, lässt aggressive Ratten im Hausflur aussetzen oder im Januar Fenster austauschen – wobei zwischen Aus- und Einbau etliche Tage liegen. Wolfgang Schorlaus Stuttgarter Privatdetektiv Georg Dengler schlittert eher zufällig in diese Geschichte, will es dann aber doch genauer wissen. Er nimmt den Immobilienhai Kröger unter die Lupe. Der will die Häuser entmieten, um etwas Rentableres zu bauen. Dabei stößt Dengler auf ein weit verzweigtes Firmengeflecht und auf eine Branche, in der perfide Ideen gedeihen und mit harten Bandagen gekämpft wird.
Es ist der zehnte Roman um Schorlaus Privatdetektiv Georg Dengler und er unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt von den bisherigen. Denn diese Geschichte sollte aus Aktualitätsgründen (Berliner Mietendeckel) rasch verfilmt werden, obwohl Schorlau noch mitten im Schreibprozess steckte. Also zog er für einige Zeit nach Berlin, entwickelte dort zusammen mit Lars Kraume ein Treatment, anhand dessen das Drehbuch und der Roman entstanden. Das hat dem Text offensichtlich gut getan, der stringenter und homogener erzählt ist, als die Vorgänger, in denen die Geschichte stets um die gut recherchierten Themen herumgezimmert war. Feingliedrig ist auch dieser Roman nicht. Schorlau erzählt plakativ, trägt dick auf, hat zudem alle paar Seiten einen Erklärbären stehen.
Der Stuttgarter Autor erzählt hier von einer in den frühen 2000er Jahren begonnenen Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt, als der Berliner Senat in der „Arm, aber sexy“-Phase des Regierenden Bürgermeisters Klaus Wowereit tausende Wohnungen samt kommunaler Wohnungsbaugesellschaften zu einem Spottpreis an Hedgefonds verkaufte. Die Mieten stiegen, Leute verloren ihre Wohnungen, die plötzlich zu einem verheißungsvollen Faktor im Finanzmarkt geworden waren.
Schorlaus Roman ist noch in anderer Hinsicht interessant, ist er wohl der erste, der den Beginn der Corona-Pandemie miteinbezieht. Die führt zu einem Bruch innerhalb der Geschichte, droht sie zeitweilig zu überwuchern – fast wie im richtigen Leben. Es gab die ersten Meldungen aus Wuhan, als Schorlau gerade am Manuskript saß und entschied, angesichts der dramatischen und einschneidenden Entwicklungen, die Pandemie mit in den Roman zu packen. Sie in einem Text, der im hier und heute spielt, zu ignorieren, wäre ihm komisch vorgekommen, sagte Schorlau in einem Interview. Schorlau nutzt es, um Aktualität und Authentizität herzustellen. Das ist legitim, aber in ein paar Jahren wahrscheinlich interessanter, als im Moment.
Freilich bildet er nicht nur die Pandemieentwicklung nach, sondern macht sich auch Gedanken über die politischen Implikationen. Eine zentrale Rolle spielt im Roman eine rechte Seilschaft innerhalb des Verfassungsschutzes (zu der auch ein gewisser Herr Meesen gehört, der später zum Chef der Behörde aufstieg). Und die wittert ihre Chance, die Querdenker-Bewegung aus Esoterikern, Anthroposophen und Impfgegner gezielt zu unterwandern. Es sei eine Massenbewegung, sagt da einer, „die zum ersten mal nicht links, sondern offen, sehr weit offen für die rechten Kräfte ist. Wir führen sie der nationalen Bewegung zu. Darum geht es jetzt.“ Und das exerziert Schorlau auch gleich durch, indem er einen von Denglers Freunden zum Querdenker mutieren lässt, der plötzlich, man kennt es, bizarre Thesen und Meinungen vertritt. Die lässt Schorlau freilich nicht so stehen, sondern von Denglers Freundin Olga gleich einem Faktencheck unterziehen. Denn Fakten sind es, die Schorlau interessieren. „Finden und erfinden“ heißt seine Devise. Er will mit seinen Romanen für Themen sensibilisieren, die von gesellschaftlicher Relevanz sind. Es ist ein journalistischer Anspruch, den er da in seine Texte trägt und der ihn nicht zum elegantest erzählenden, aber sicher zum engagiertesten Kriminalautor hierzulande macht.
Wolfgang Schorlau: Kreuzberg Blues. Kipenheuer und Witsch, Köln 2020. 413 Seiten, 22 Euro.
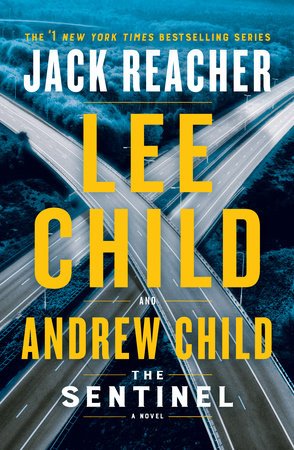
Beleidigend lustlos
(AM) Am 27. Oktober 2020, also kurz vor den Präsidentschaftswahlen, erschien in den USA The Sentinel, der 25. Jack Reacher-Roman. Inhalt: Die Russen, getarnt als Nazis, wollen eine in 48 US-Staaten eingesetzte Wahl-Sicherheitssoftware namens „The Sentinel“ kapern, um die Wahl zu manipulieren. Auftritt Jack Reacher, der sich zufällig am richtigen Ort befindet, im Örtchen Pleasantville nahe Nashville, Tennessee. Die Buch-PR-Maschine richtete ihren Fokus jedoch nicht auf dieses Thema, sondern auf die Staffelübergabe an Lee Childs jüngeren Bruder Andrew Grant, ebenfalls Thrillerautor, mit seinen bisher neun Büchern noch nicht weiter aufgefallenen. Künftig soll er die in 100 Ländern eingeführte Marke Reacher weiterführen, während Lee sich um das Supervising seiner Figur als Amazon-Streamingserie, das gute Leben auf einer neu gekauften 15-Hektar-Ranch in Montana und um seinen Nachruhm kümmern will. Die im Oktober erschienene Biografie von Heather Martin „The Reacher Guy“ ist von ihm autorisiert, sie wäre easy Anwärterin für die devoteste Autorenverherrlichung der letzten Jahre, das ganze Buch eine speichelleckende Schleimspur. Auch ein Rekord.
Bei „The Sentinel“ treten die Brüder gemeinsam als Autoren auf, geplant ist aber, dass Lee Child den Griffel abgibt. Ein Fan der Reihe zu sein, kann man mir bestimmt nicht absprechen (siehe etwa hier), aber Buch Nr. 25 eine gruslige Enttäuschung zu nennen wäre höflich. Natürlich konnte niemand ahnen, dass Donald Trump selbst die größte Gefahr für die US-Wahl wird und die Arbeit der Russen am besten erledigt. Der Gimmick von „The Sentinel“ sind irgendwelche „Server“, die man kopiert oder infiziert (??). Um deren Übergabe/ Austausch/ Handel gibt es endlose Prozedere–Prozeduren, wieder und wieder muss man dafür mit dem Auto um den Block fahren, Straßenseiten wechseln usw. – lauter Pseudo-Undercover- und Spionage-Craft, die auch die letzten Andrew Vachss-Romane zu Tortur und Karikatur machten. Adam Hall hat so etwas schon vor 50 Jahren hundert Mal spannender und literarisch avancierter erledigt (sein CrimeMag-Porträt hier).
Der Romananfang, bei dem Jack Reacher sich zum Manager einer ausgebeuteten Indie-Rockband macht, ist noch witzig, auch noch, dass er einmal für jemand von der Antifa gehalten wird, ansonsten aber wird es zunehmend Scherenschnitt. Aus grobem Karton. Die Figuren heißen Smith, Fisher, Sands, Goodyear, es gibt den „Moscow guy“, „die Russen“ und „die Nazis“. Reacher korrigiert die Grammatik seiner Opponenten, hält ihnen Vorträge (auch Lee Child kann man dafür buchen, wirbt sein Verlag im Buch). Aus der eigentlich guten Frage, wie man den vierstelligen Zifferncode eines Zahlenschlosses ermittelt (10 000 Möglichkeiten) und einem praktischen Trick, der das auf 81 Varianten reduziert, wird dann sofort, ja klar, haben wir es doch mit Nazis zu tun, 0420. Hitlers Geburtstag. Nur wenige Seiten später sind „die Nazis“ als „die Russen“ enttarnt und deren Geheimzahl ist natürlich für Nick Knatterton Reacher jetzt kein Problem: Stalins Geburtstag. Rosa Klebb, der Haushälterin mit der Giftnadel aus „James Bond – 007 jagt Dr. No“ (von 1962) begegnen wir ebenso wie etwa zweihundertfünfzig weiteren abgehalfterten Klischees. Was für eine armselige Veranstaltung. So mühsam habe ich mich schon lange keinem Ende eines Buches mehr entgegen geschleppt.
Bis es bei uns erscheint, wird Zeit vergehen, das mit der US-Wahl ist dann erst Recht egal. Diesen Sommer erschien „Der Bluthund“ (The Midnight Line), 2017 vor Donald Trumps Wahl herausgekommen, damals ein realitätstüchtiges Streiflicht auf die Opioid-Krise der USA. Zwei weitere, noch nicht für den deutschsprachigen Markt übersetzte Reacher-Romane liegen noch vor „The Sentinel“. Ich finde ihn einen unwürdigen, ja beleidigend lustlosen Abschied.
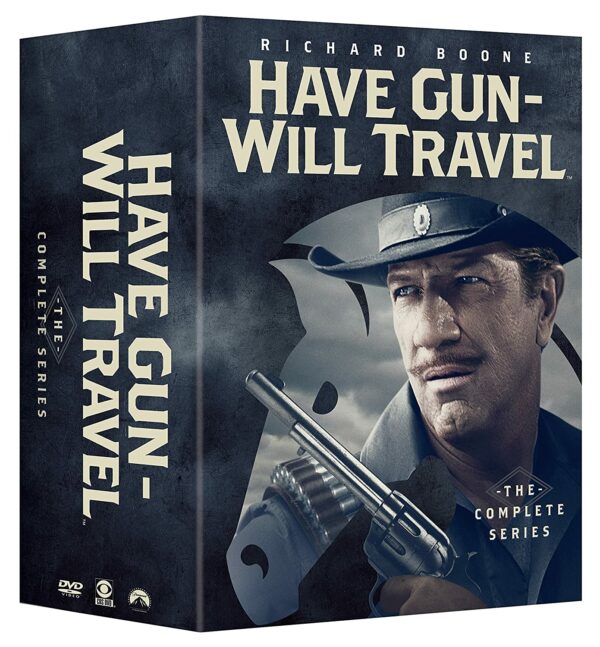
Der ehemalige TV-Producer James Dover Grant, den wir als Lee Child kennen, hat ironischerweise einst als englischer Autor erkannt, welch Potential die Modernisierung des einsamen Helden aus den Western-Geschichten noch heutzutage bietet. Mit jetzt 25 Romanen hat er das nun bis zur Langeweile ausgereizt. Seine Hauptvorlage hingegen, die nie in den deutschen Sprachraum gelangte US-Fernsehserie „Have Gun – Will Travel“, brachte es auf 226 Folgen und sechs Staffeln (1957 – 1963). Richard Boone, nur „Paladin“ genannt und mit eigenem Sinn für Gerechtigkeit ausgestattet, reitet darin durch den Wilden Westen, lässt sich als Revolvermann und Troubleshooter anheuern oder ist für Ärmere kostenlos ein Ritter. Er hat einen College-Abschluss und als Offizier im Bürgerkrieg gedient, ist der Inbegriff des einsam herumziehenden Kämpfers für das Gute, die Serie galt als „The Thinking Man’s Western“. 36 Jahre später, 1997 mit „Killing Floor“, ließ Lee Child die Figur mit dem ehemaligen Militärpolizisten Jack Reacher wieder auferstehen. Eine Leerstelle übrigens wird nun wohl offenbleiben: Reachers Armee-Einheit, real, ist die, die in Abu Graib für das Gefängnis zuständig war. Lee Child oder seine Figur haben das nie thematisiert.
Lee Child, Andrew Child: The Sentinel. A Jack Reacher Novel. Delecorte Press, New York 2020. 354 Seiten, 28,99 USD.











