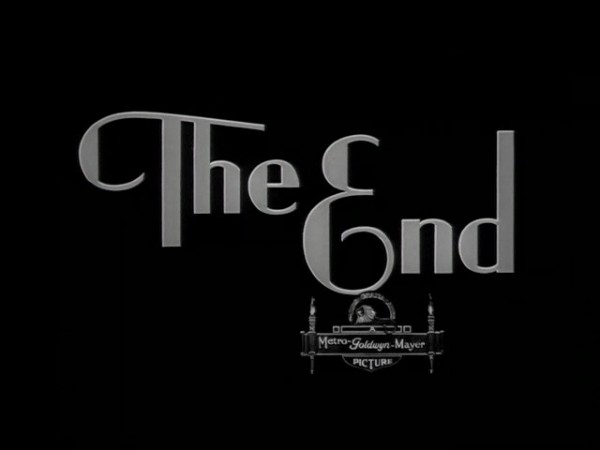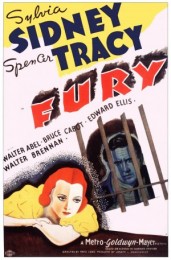 Film, Verbrechen und ungleiche Mittel
Film, Verbrechen und ungleiche Mittel
Heute: Fritz Lang – „Fury“. Von Max Annas.
Die beeindruckendsten und verstörendsten Bilder aus Fritz Langs mittlerweile 80 Jahre altem Film sind jene, in denen ein Mob eine Polizeistation anzündet. Die Atmosphäre in einer kleinen Stadt hat sich aufgeheizt, weil es Gerüchte gibt, dass der Entführer eines kleinen Mädchens dort eingesperrt ist. Leute finden sich zusammen, reden, schreien, wiegeln einander auf, werden mehr und mehr, schließlich ziehen sie zur Station und vertreiben mit Prügeln, Steinen und Feuer die dort anwesenden und wartenden Polizisten. Als das Gebäude schließlich beginnt zu brennen, stehen die Menschen der kleinen Stadt vor dem Gebäude und starren so erregt wie begeistert darauf. Schließlich setzen sie noch Dynamit ein, um dem in einer Zelle eingesperrten Beschuldigten den Rest zu geben.
„Fury“ ist im Mai 1936 uraufgeführt worden und war der erste von 22 Filmen, die Lang in Hollywood innerhalb von 21 Jahren fertiggestellt hat, zwei weitere wurden 1941 und 1942 von Archie Mayo am Set übernommen. Langs erster Film in den USA ging aus von einer Kurzgeschichte Norman Krasnas, die auf dem Lynchmord an Thomas Harold Thurmond und John M. Holmes beruhte, zwei Männern, die 1933 vor tausenden Menschen und unter dem neugierigen Blick der Medien nördlich von San Francisco aufgehängt wurden. Sie hatten einen jungen Mann entführt und ermordet, den Sohn eines bekannten Händlers. In Langs Film ist es Joe Wilson, gespielt von Spencer Tracy, der der Entführung eines Mädchens beschuldigt wird. Genauso wie die beiden Männer landet er als Verdächtiger in einer Zelle. Anders als die beiden Männer 1933, die aus ihren Zellen geholt wurden, sieht Wilson, wie das Gebäude in Flamen aufgeht. (Cy Endfield hat seinen Film „The Sound of Fury“ 1950 näher an den Geschehnissen des Jahres 1933 angelegt.)
Mehr als von allem anderen ist „Fury“ von Misstrauen geprägt, von Langs Misstrauen gegenüber dem Menschen. Der Film beginnt mit einer Szene, die typisch ist für die lustigen Charaden, die der Hays-Code über das Kino des Landes gebracht hatte. Spencer Tracy als Joe Wilson und Silvia Sidney als seine Verlobte Katherine Grant blicken in das Schaufenster eines Möbelgeschäfts und sehen ein fertig eingerichtetes Schlafzimmer – mit getrennten Betten. Was für eine schlechte Welt. Sie leben und arbeiten weit von einander entfernt und werden den Zustand auch noch ein Weile aufrecht erhalten, des Geldes wegen. Als Joe, der mit seinen Brüdern eine Tankstelle betreibt, ein Jahr später genug Geld verdient hat für ein Auto und eine marriage license, macht er sich auf, Katherine zu treffen. Unterwegs wird er vom Polizisten Meyers (Walter Brennan) angehalten. Das Drama nimmt seinen Lauf.

Lang erzählt wie immer ökonomisch. 10 Minuten, um die Beziehung von Joe und Katherine zu etablieren, 5 Minuten, um Joe zusammen mit seinen Brüdern und die gemeinsame Arbeit zu zeigen, außerdem macht sich Joe auf und wird verhaftet. Dann geht Lang ein wenig mehr in die Tiefe. Weitere 5 Minuten vergehen, in denen Lang die Polizeistation darstellt und das Verhör, dem Joe unterworfen wird. Die Polizisten sind keine bösen Figuren, vielleicht nicht besonders schlau, aber ernsthaft in ihrem Bemühen, ein Verbrechen aufzuklären. Der Sheriff (Edward Ellis) stellt Joe eine Falle, in die der hineintappt. Damit ist der Fall für die Polizei fast schon aufgeklärt. Der Film ist 20 Minuten alt und steuert auf seine wichtigste Sequenz zu.
Beinah 20 Minuten nimmt sich Lang, die kurze Zeitspanne zu schildern, in der die Temperatur des Städtchens bis zum Siedepunkt ansteigt. Vielleicht wäre alles ganz anders gekommen, wenn der Polizist Meyers beim Friseur nicht mehr gesagt hätte als er durfte. Möglicherweise hätte es einen anderen Impuls gegeben. Oder alles wäre friedlich geblieben in der Kleinstadt. So aber startet der Friseur, der anders als sein zugewanderter Angestellter die amerikanische Verfassung nicht kennt, eine Kette von Ereignissen, indem er seine Gattin anruft und von Meyers Bemerkungen berichtet, die Polizei hätte jemanden wegen der Entführung festgenommen. Die Gattin erzählt es ihrer Nachbarin. Die Nachbarin tratscht im Geschäft, natürlich unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Zur Strafe für ihre Plapperei vergleicht Lang die Frauen im Laden in einem Zwischenschnitt ganz stummfilmmäßig mit gackernden Hühnern. Nur um dann zu zeigen, dass die Männer auch nicht besser sind. So geht’s vom Laden auf die Straße und in die Kneipe, wo sich die Stimmung endgültig entzündet.
Sehr beeindruckend ist eine kleine Montage inmitten dieser 20-minütigen Passage. Der Mob hat sich schon gefunden, für einige Sekunden sind marschierend fröhlich schwatzende Leute zu sehen, die genau so gut zu einem Sportereignis oder einem Karnevalsumzug gehen könnten. Zu gut und aufgekratzt ist ihre Stimmung für einen Lynchmob, dem Lang hier eine Freude einschreibt, die er später noch einige Male bestätigen wird. Für zwei oder drei Sekunden sehen wir dann Joe in seiner Zelle, der panisch umherspringt, weil er schon weiß, was wir auch im nächsten Bild noch nicht geboten kriegen. Mit dem nächsten Schnitt geraten wir nämlich in eine mehr als 50-sekündige Kamerafahrt auf die Polizeistation zu. Dort stehen, auf den Stufen und dem Trottoir, der Sheriff und acht weitere bewaffnete Polizisten, die wie Joe allesamt schon wissen, was uns noch vorenthalten wird. Und noch vor dem nächsten Schnitt, eine Sekunde davor vielleicht, hören wir eine Stimme aus dem Off, die den Sheriff adressiert. Mit dem Schnitt dann sehen wir den Redner und hinter ihm den Lynchmob.
Lang hat für diese Kamerafahrt die Perspektive des Mobs gewählt. Das ist eine interessante Wahl, und ich habe mich gefragt, was sie motiviert hat. Vielleicht dies: Die wachsende Menge, samt der Bewegung durch den öffentlichen Raum, war im revolutionären Sowjetkino oder im linken Tonfilm der letzten Jahre Weimars mit linken politischen Codes besetzt. Aufstand gegen Ungerechtigkeit oder Zusammenhalt der Armen. Möglich, dass Lang diesen Gedanken hatte und solche Bilder nicht im Zusammenhang mit dem Lynchmob zeigen wollte, der dabei war, einen Unschuldigen aufzuknüpfen. So sehen wir den Mob also schon in Bewegung durch dessen Blick. Der Blick der Kamera steht für den bösen Blick der vielen, die gekommen sind, Joe zu ermorden. Fury war 1936 entstanden. Lang war drei Jahre zuvor aus Deutschland geflohen. Leute auf der Straße, viele Leute auf der Straße ergaben nicht notwendig mehr ein Bild, das einen positiven Eindruck hinterließ. Das musste sich in diesem Film wiederfinden.
Der Sprecher des Mobs fordert den Sheriff dann auf, der Menge eine Unterredung mit dem Gefangenen zu gestatten, was eine Herausgabe zum Lynchen bedeutete. Die Polizisten weigern sich, verbarrikadieren sich, werden überfallen und aus dem Gebäude gejagt, das dann in Flammen aufgeht. Als der Sprecher den Sheriff zum ersten Mal adressiert, ist es noch hell. Als die Flammen aus dem Gebäude schlagen, ist es schon dunkel geworden. Katherine ist auf der Suche nach Joe mittlerweile in der Stadt angekommen und sieht das Gesicht ihres Verlobten im brennenden Haus hinter den Gittern der Zelle. Um sie herum tobt und feixt und jubiliert die Menge.
Als der Reichstag in Berlin brannte, war Langs letzter deutscher Film vor der Emigration noch nicht veröffentlicht worden. Erst im Mai 1933 hatte „Das Testament des Dr. Mabuse“ seine Uraufführung. Der Film brachte Lang einigen Ärger ein, weil der offenbar gestörte Mabuse am Ende des Films in Sätzen zu hören war, die als Hitlers Worte gelesen werden konnten. In dem legendären Filminterview (oder: Interviewfilm!) mit William Friedkin beschreibt der Regisseur 1974 das Gespräch, das er nach der Konfiszierung einiger Kopien des Films mit Propagandaminister Goebbels hatte. Er wusste um die Sprengkraft der Mabuseworte, und er wusste, dass nach dem Brand andere Künstler schon verhaftet worden waren – Linke allerdings, so hat sich Lang nie verortet. Umso überraschter war er trotzdem, als ihm Goebbels die Leitung der UFA anvertrauen wollte. Noch in der folgenden Nacht verließ er Deutschland. Es liegt nahe, den Brand der Polizeistation, die die aufrechten, aber nicht besonders klugen Bullen aufgeben müssen, als Reflex auf den Reichstagsbrand zu verstehen, der als Begründung für so viel Terror des Nazis benutzt wurde. Aber Lang hat sich oft gewehrt, wenn es darum ging, seinen Filmen einen Bedeutungsrahmen zu geben. Sollen das doch andere tun, sagte er dann.
Wenn ich „Fury“ heute wiedersehe, denke ich nicht an einen Brand vor 83 Jahren. Der Mob, der sich organisiert, durch die Stadt zieht, ein Gebäude anzündet und dabei zusieht, wie das Haus niederbrennt und jene mit, die sich darin befinden, erscheint mir, die Bilder aus Deutschland des letzten halben Jahres im Kopf, als Vorgriff auf die Feuer, die dieser Tage hier gelegt werden. Ungefähr so stelle ich mir die Dynamik vor, die sich in Gemeinden und Städtchen, Städten und Dörfern entwickelt, wenn Leute zu Flüchtlingsunterkünften ziehen und diese mit Feuer eindecken. Nur die Rolle der Polizei hat Lang nicht so angemessen vorhergesehen. Aber auch da spielte der Code eine Rolle.
Der Film hat mit dem Brand erst die Hälfte seiner Laufzeit erreicht. Und die zweite Hälfte ist durchaus interessant und hat ihre dringende dramaturgische Berechtigung. Joe entkommt. Es gibt einen Prozess. Ein engagierter Anwalt steht knapp vor einem Erfolg gegen zahlreiche Bürger des Städtchens. Kurz vor Ende taucht Joe dann auf und löst die Anklage wegen Mord durch sein Erscheinen auf. Hier und da ist die Rolle Joes kritisiert worden, der sich in der zweiten Hälfte von „Fury“ zuerst zum Rächer entwickelt, der von außen versucht, Einfluss zu nehmen auf den Prozess, dann aber geläutert wird durch Katherines Liebe und den Angeklagten eine Strafe erspart. Die Dreiviertelstunde wirkt in der Tat etwas kurz für diese zwei Metamorphosen und ist eine deutliche Schwäche des Films. Trotzdem bleibt „Fury“ ein frühes filmisches Testament des Misstrauens dem Menschen gegenüber und seine Fähigkeit, in der Gruppe fatale Destruktionskräfte zu entwickeln. Der Schurke ist nicht ein fehlendes Individuum, es geht auch nicht um eine kleine Gruppe, die sich außerhalb der Mehrheit platziert. Es ist jene Mehrheit, vor der Lang seine Angst formuliert.
Max Annas
Fury (Blinde Wut); USA 1936; Regie: Fritz Lang; Drehbuch: Bartlett Cormack, Fritz Lang; Kamera: Joseph Ruttenberg; Musik: Franz Waxman; DarstellerInnen: Spencer Tracy, Silvia Sidney, Edward Ellis, Walter Brennan, Bruce Cabot; Länge: 96 min.
Bisher sind in dieser Reihe erschienen:
(6) Claude Chabrol: „Nada“ und die Bücher von Jean-Patrick Manchette im Kino.
(5) David Miller: „Executive Action“, nach einem Drehbuch von Dalton Trumbo.
(4) Anthony Mann: „Devil´s Doorway“
(3) Yilmaz Güney: „ACI“
(2) Carlos Saura: „Deprisa, deprisa“
(1) Pietro Germi: „La città si difende“
Offenlegung: Im Rowohlt Taschenbuch Verlag erscheint am 21. Mai als zweiter Roman von Krimi-Preisträger Max Annas der Thriller „Die Mauer“.