
Sachbücher, kurz und bündig
Sekundärliteratur ist unerlässlich, wenn man nicht nur konsumieren will. Alf Mayer (AM) war auf einem Streifzug im Revier unterwegs. Ein Teil der hier angekündigten Rezensionen folgt noch in den nächsten Stunden bzw am Montag. Schauen Sie wieder vorbei.
Bruno Cabanes (Hg.): Eine Geschichte des Krieges
Georges Manolescu: Fürst Lahovary. Mein abenteuerliches Leben als Hochstapler
Christian Metz: Kitzel. Genealogie einer menschlichen Empfindung
Rita Mielke: Atlas der verlorenen Sprachen
Mittelweg 36: Von einsamen Wölfen und ihren Rudeln
Franziska Richter (Hg.): Echoräume des Schocks. Wie uns die Corona-Zeit verändert
Daniela Rüther: Der „Fall Nährwert“
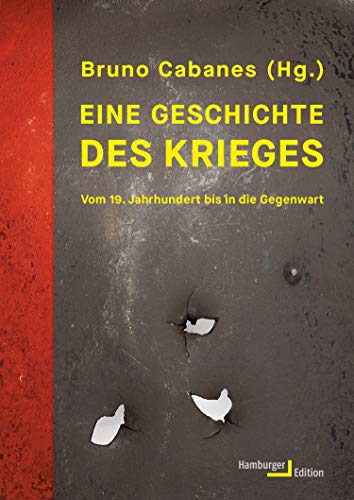
Goldstandard
(AM) Wir in Europa leben in einer nun schon langen Friedenszeit. In Frankreich muss man für die letzte formelle Kriegserklärung bis zum 3. September 1939 zurückgehen, notiert Herausgeber Bruno Cabanes in der Einführung zu seinem monumentalen Kompendium Eine Geschichte des Krieges. Vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Der in USA lehrende französische Historiker weiter: „’Wir befinden uns im Krieg.‘ Wie oft haben wir diese prätentiöse Erklärung von offizieller Seite schon vernommen? Seit dem 11. September 2001 gilt jedes Attentat bereits als ‚Kriegshandlung‘. Der ‚Krieg gegen den Terrorismus‘ scheint endlos; zusätzlich drohen Cyberkriege, Kriege mit chemischen oder bakteriologischen Kampfstoffen und sogar die neuerliche Proliferation von Atomwaffen. Der Krieg hat sich zu einem Phänomen entwickelt, das alle Lebensbereiche betrifft und Gesellschaft, Politik, Kultur und Ökonomie verändert.“ Der moderne Krieg ist entgrenzt, Partisanenkämpfe, Terroranschläge, Massaker oder ethnische Säuberungen gehören dazu, er richtet sich zunehmend auch gegen die Zivilbevölkerung – schert sich um kein Völkerrecht oder herkömmliche Regeln der Kriegsführung.
Multiperspektivisch und mit globaler Sicht untersucht ein Aufgebot von 57 internationalen namhaften Expertinnen und Experten aus Geschichts- und Politikwissenschaft, Soziologie, Psychologie, Ökonomie und Anthropologie den grundlegenden Wandel moderner Kriege. Das faszinierende Buch geht in vier großen Kapiteln ans Thema : Der moderne Krieg/ Soldatische Welten/ Kriegserfahrungen/ Kriegsfolgen. Die Lektüre ist enorm bereichernd. Dieses Buch wird noch lange Standardwerk sein. Große Empfehlung. – Wir freuen uns, Ihnen in dieser Ausgabe auch einen Textauszug präsentieren zu können: Bruno Cabanes über Kriegsheimkehrer*innen.
Bruno Cabanes (Hg.): Eine Geschichte des Krieges. Vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart (Une histoire de la guerre. Du XIXe siècle à nos jours, 2018). Unter Mitarbeit von Thomas Dodman, Hervé Mazurel und Gene Tempest. Mit Beiträgen von 57 Autorinnen und Autoren. Aus dem Französischen von Daniel Fastner, Michael Halfbrodt und Felix Kurz. Hamburger Edition, Hamburg 2020. Gebunden, 903 Seiten, umfangreicher Index, 39 Euro.
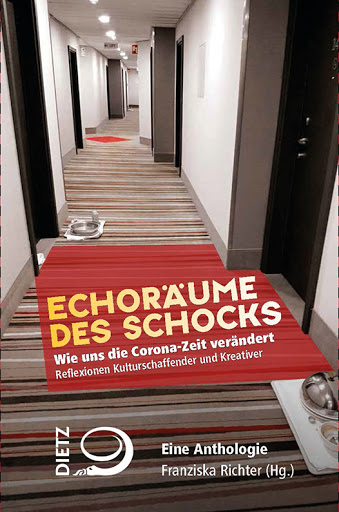
Wichtige Debatte
(AM) Für den April dieses Jahres war die 7. Kulturpolitische Jahrestagung der Friedrich-Ebert-Stiftung geplant, das Thema: „Kultur (Politik) als Aufruf! Gestaltung gesellschaftlicher Räume und Erkundung von Zukunft“. Die Tagung wollte danach fragen, wie Kunst und Kultur zur Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und zur Auseinandersetzung mit Populismus und Fremdenfeindlichkeit beitragen kann. Kurz vor der Einladung kam die Ankündigung des bundesweiten Lockdowns, die Veranstaltung war damit gegessen. Für Franziska Richter, die Kulturreferentin bei der Stiftung, entwickelte sich aus der Kommunikation der Tagungsabsage ein reger Meinungsaustausch – und schließlich das nun vorliegende Buch.
Die Anthologie Echoräume des Schocks. Wie uns die Corona-Zeit verändert versammelt Reflexionen Kulturschaffender und Kreativer, die 25 Beiträge beschreiben Ängste und Hoffnungen im Ausnahmezustand des Corona-Alltags und handeln davon, wie Künstler und Kunst versuchen, weiter sichtbar zu bleiben und dagegen ankämpfen, dass Kultur als nicht „systemrelevant“ gesehen wird.
Die Beiträge entstanden März bis Ende Juni 2020, also unmittelbar unter dem Eindruck der Ausgangsbeschränkungen – jetzt gerade im November erleben wir eine Neuausgabe und damit auch eine Verschärfung der in diesem Buch beschriebenen Probleme. Das ansprechend gestaltete und sehr lesbare Buch hat nichts an Aktualität verloren, sondern im Gegenteil neue gewonnen. Die Fragen, wie es in und nach der Pandemie weitergeht und welche Chancen sich für ein neues solidarisches und demokratisches Miteinander ergeben (könnten), sind nur noch drängender geworden. Siehe bei uns auch den Streikaufruf von Iris Boss in dieser Ausgabe, den Essay von Georg Seeßlen zur Systemrelevanz von Kultur aus unserer August-Ausgabe.
Franziska Richter (Hg.): Echoräume des Schocks. Wie uns die Corona-Zeit verändert. Reflexionen Kulturschaffender und Kreativer Eine Anthologie. Verlag J.H.W. Dietz Nachf. Bonn 2020. 192 Seiten Klappenbroschur 16 Euro.
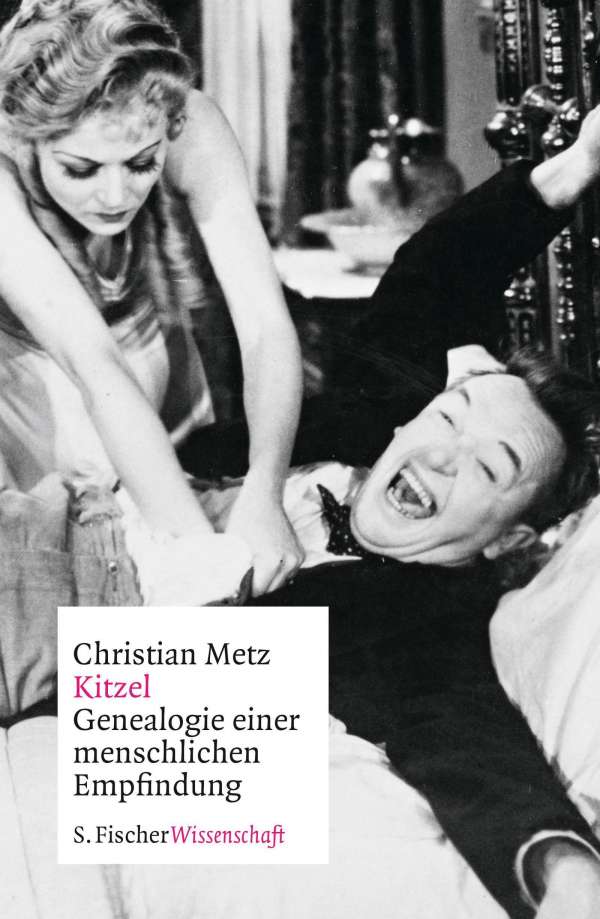
Gratwanderung mit großem Panorama
(AM) Wow! Welch ein Buch. Welch ein Thema. Christian Metz ist mit Kitzel. Genealogie einer menschlichen Empfindung auf eine Goldader gestoßen. Welcher Wissenschaftler, egal welcher Coleur, möchte nicht Neuland entdecken? Hier ist es ein ganzer Kontinent. Der Autor selbst stellt anhand seiner 37seitigen Bibliografie zum Thema verblüfft fest: „Es existiert weder eine Natur- noch eine Wissens- oder Kulturgeschichte des Kitzels, von einer systematischen Studie über die Ästhetik des Kitzels ganz zu schweigen … Es gibt bis heute keine systematische Forschung zum Kitzel.“
Aristoteles schon begriff das Kitzeln als Gratwanderung und Kulturtechnik, mit dem Gleichgewicht eines anderen umzugehen. Übertreibt man, wird es zu viel, stimmt die Dosierung wird man Vertrauensperson, Vater, Mutter, Geschwister, Freund, Lieblingsautor, Lieblingsmaler, Lieblingskomiker, Lieblingskoch… Metz sieht den Kitzel aufgrund seines Doppelcharakters als „eine entscheidende Triebkraft der Künste“ – Kriminalliteratur, wir hören dich trapsen, Hegels „Diebs-Mörder-Dichter-Kitzel“ inklusive –, „aus der wieder und wieder neue Erzählungen entspringen“. Seine als Text 490seitige, auf jeder Seite verblüffende Studie fokussiert sich „auf jene Phasen, in denen künstlerische Arbeiten das Kitzlerwissen und –geheimnis neu codieren und in denen sich gleichzeitig aus dem Kitzel besonders faszinierende Kunst generiert“.
Das Buch löst nicht die naturwissenschaftlichen Rätsel des Kitzels, sondern häuft neue Fragen und Rätsel an, steigert gezielt die Komplexität des Phänomens. Wer den Blick erst einmal für das Kitzeln geschärft hat, wird feststellen, dass es überall präsent ist: in der Philosophie, Biologie, Medizin und Anthropologie bis hin zu Literatur, Malerei, Film und Musik. Als kindlicher Kitzel, lukrezischer Gaumenkitzel (Jean Pauls Pikat-Süßes), Dichterkitzel (im Kopf), Lustkitzel in Sport und Spiel, als Nervenkitzel (etwa im Kino), Augen- und Sinneskitzel und als weibliches Organ, das grandios verkannt und unterschätzt wurde – wie überhaupt das ganze Phänomen. Mein Preis für das überraschendste Sachbuch des Jahres.
Christian Metz: Kitzel. Genealogie einer menschlichen Empfindung. S. Fischer Verlag, Frankfurt 2020. 636 Seiten, 32 Euro.
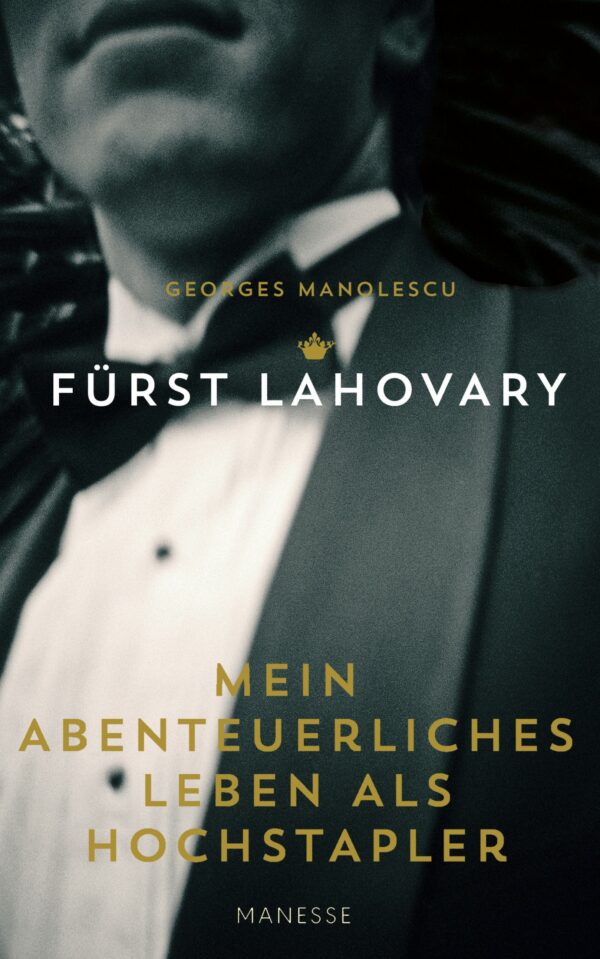
Großmeister des Bluffs
(AM) Goldene Buchdeckel. Darunter geht es nicht, wenn zum ersten Mal seit mehr als hundert Jahren die Memoiren von Georges Manolescu wiederaufgelegt werden. Fürst Lahovary. Mein abenteuerliches Leben als Hochstapler versammelt die beiden Bestseller des Jahres 1905 in einem Buch: „Ein Fürst der Diebe“ und „Gescheitert. Aus dem Seelenleben eines Verbrechers“. Kommentiert wird die Neuausgabe von Manesse-Verleger Horst Lauinger höchst selbst, das Nachwort stammt vom Thomas Mann- & Felix Krull-Spezialisten Thomas Sprecher. Thomas Mann war von der „noch nie geübten autobiografischen Direktheit“ dieser Memoiren beeindruckt, bis in die Stilmittel hinein beeinflussten sie seine „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“.
„Erlebtes und Erlittenes“ lautete der Untertitel der von Verleger Paul Langenscheidt aus dem Französischen ins Deutsche gebrachten Erinnerungen, die 1905 binnen weniger Monate in die fünfte Auflage gingen und noch im gleichen Jahr einen zweiten Band folgen ließen. Die Hochstapler-Bekenntnisse trafen einen Nerv; in der Ära Trump gibt es dafür vielleicht wieder eine neue Sensibilität, und ich frage mich auch, ob Ross Thomas mit seiner Galerie unverfrorener Bluffer und Betrüger sie gekannt hat. Der selbst ernannte Fürst Lahovary kam als Georgiu Mercadente Manulescu (1871–1908) in der Walachischen Tiefebene zur Welt, floh mit vierzehn aus der Armee, betörte in Athen die griechische Königin und brach mit 23 nach Halifax, Chicago, San Francisco, Honolulu und Yokohama auf. Zurück in Europa, beklaute er die Hautevolee von Paris, London und Nizza in ihren mondänen Hotels, heiratete als Fürst von eigenen Gnaden eine deutsche Gräfin und renommierte als Boxer, Segler und Motorbootfahrer, Juwelnendieb und Glücksspieler. Als er mit nur 37 Jahren in Mailand starb, hinterließ er zwölf Anzüge, 40 Seidenhemden, zehn Paar Lackschuhe und einen gefälschten Adelsbrief.
Das Buch ist eine Perle der Autofiktion. Sprache, Sprachfiguren und Verbrechen werden bei Manolescu eins, dienen der kreativen Konstituierung einer Idealidentität. Ein Hochstapler hört, was andere sagen, und sagt, was andere hören wollen, die bürgerlichen (Sekundär)-Tugenden nutzt er für verbrecherische Zwecke, er ist unentwegt Schauspieler, schwebt beständig zwischen Komödie und Lüge, seine Lügen entsprechen den Regeln der Gesellschaft, letztlich überführt er die Welt der Hochstapelei. Wir sind Trump. Wir sind Manolescu.
Georges Manolescu: Fürst Lahovary. Mein abenteuerliches Leben als Hochstapler. Aus dem Französischen von Paul Langenscheidt, kommentiert von Horst Lauinger, Nachwort von Thomas Sprecher. Manesse Verlag, München 2020. Hardcover, 448 Seiten, 24 Euro.
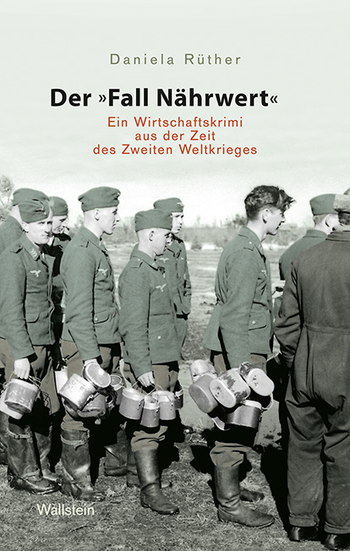
Tatsächlich ein Krimi
(AM) Mein Vater, Frontschwein des Russlandfeldzuges, Stalingrad inklusive, pflegte seine Erzählungen vom Zweiten Weltkrieg stets mit einem Seitenhieb auf die „verfluchten Verbrecher, die für die Verpflegung zuständig waren“ zu versehen. Himmler wollte immer, dass SS-Sturmbannführer Schenk das Buch „Tschingis Chan und sein Erbe“ von Michael Prawdin „durcharbeite“, um dem Fleischtrocknungs-verfahren der Mongolen auf die Spur zu kommen. Mit einem Stoßseufzer ob der aus seiner Sicht vertanen Chancen in Stalingrad meinte Himmler: „Wie viel konserviertes und mit allen Vitaminen versehenes Fleisch hätten wir gewinnen können, wenn alle gefallenen Pferde in der Weise behandelt worden wären, wie es die Mongolen taten.“
Jener Professor Dr. Ernst Günther Schenk war seit 1940 Ernährungs-inspekteur der Waffen-SS und maßgeblich beteiligt an der Gründung der von der SS getragenen Deutschen Versuchsanstalt für Ernährung und Verpflegung, war verantwortlich für Ernährungsversuche an Häftlingen im KZ Mauthausen, wurde 1944 zum Inspekteur für Truppenernährung im Oberkommando der Wehrmacht (OKH) ernannt, war zuständig also für die Frontverpflegung, den Nazis und vor allem der SS ebenso wichtig wie Munition.
SS-Mann Schenk, der nach dem Krieg weich fiel, an der Legende von der „sauberen“ Wehrmacht mitstrickte und dem Eichinger-Film „Der Untergang“ die Vorlage lieferte, ist einer der Protagonisten im Sachbuch-Wirtschaftskrimi Der Fall „Nährwert“ von Daniela Rüther. Die Historikerin stieß im Rahmen ihrer Mitarbeit am Projekt „Tengelmann im Dritten Reich“ auf das Thema, die weithin unbekannte Geschichte der „Gesellschaft für Nährwerterhaltung“ zu erforschen – und das ist tatsächlich ein Krimi. Die „Nährwert“, wie sie kurz genannt wurde, ging auf die Initiative des Chefs der Verpflegungsabteilung im OKH, Geheimrat Ernst Pieszczek, zurück und war ein Public-Private-Partnership-Projekt des Heeresverwaltungsamtes mit führenden Unternehmen der Lebensmittelindustrie, das die Aufgabe hatte, Produkte aus getrocknetem Obst und Gemüse herzustellen. Beteiligte Unternehmen: Knorr, Tengelmann und Dr. Oetker und andere. Nicht wenige der im Krieg entwickelten Verfahren bildeten die Grundlage späterer Unternehmensblüte und Produkte. Die „Bulette mit pflanzlichen Rohstoffen“ war bereits für die Wehrmachtssoldaten in Entwicklung, möge es heutigen Veganern munden.
Kontinuitäten aufzuzeigen ist einer der Pluspunkte dieses vorzüglich lesbar geschriebenen Wissenschafts-Buches – Fachterminus: empirische Fallstudie –, ein Register handelnder Personen mit Kurzbiografien einer der zahlreichen Mehrwertaspekte. Ein anderer ist der mit viel Quellenmaterial unterfütterte Einblick in die Maschinerie der Nazi-Kriegsmaschine, in die Intrigen zwischen Wehrmacht und SS und ein zum gegenseitigem Nutzen aktives Wissenskartell von Staat, Industrie und Wissenschaft, in dem KZ-Häftlinge als Versuchskaninchen gern billigend in Kauf genommen wurden, ja sogar einen einzigartigen Weltmarktbonus darstellten. Es geht um Vorteilsnahme und Netzwerke, Lügen, Verrat, Intrigen, leere Bäuche und Ausbeutung, volle Konten und buchstäblich um Leben und Tod.
Daniela Rüther: Der „Fall Nährwert“: Ein Wirtschaftskrimi aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Wallstein Verlag, Göttingen 2020. 228 Seiten, 24,90 Euro.
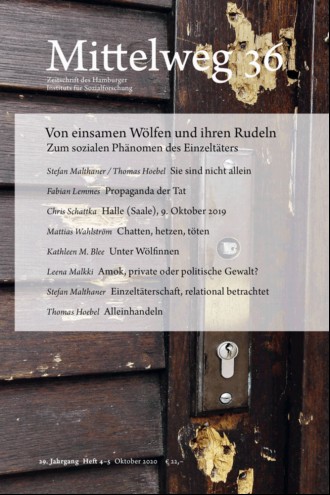
Perspektivwechsel
(AM). „Sie sind nicht allein“, überschreiben Stefan Malthaner und Thomas Hoebel ihre Untersuchung zu Stand und Heraus-forderungen der Einzeltäterforschung. Terroristische Anschläge wie jetzt Anfang November in Wien, die in Nizza, in Halle oder Hanau, in Utøya, Christchurch oder El Paso brennen sich ins kollektive Gedächtnis, in der öffentlichen Berichterstattung wie auch der wissenschaftlichen Forschung werden solche Taten gern einem „Einzeltäters“ zugeschrieben. Diese Einordnung hat sich etabliert, aber es ist Zeit, findet Mittelweg 36, die von uns geschätzte Zweimonats-Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung (Besprechungen hier, hier und hier), die Einzeltäterschaft als soziales Phänomen zu begreifen und auch die vielfältigen Beziehungen und Bedingungen in den Blick zu nehmen, aus denen sie hervorgehen. Selten lebten die Täter vor der Tat zurückgezogen oder isoliert. Meistens waren sie eingebettet in soziale Kontexte wie reale oder virtuelle Netzwerke, in denen sie sich austauschten und nach Aufmerksamkeit und Anerkennung strebten.
Von einsamen Wölfen und ihren Rudeln heißt das Themenheft, das sich in acht großen Beiträgen mit dem – ausdrücklich so benannten – sozialen Phänomen des Einzeltäters beschäftigt. Fabian Lemmes schaut zurück zu der von militanten Anarchisten des 19. Jahrhunderts verfolgte Strategie einer „Propaganda der Tat“. Mattias Wahlström untersucht, wie rechtsextreme Gruppen die sozialen Medien für ihre Zwecke nutzen und ein von Hass und Verachtung geprägtes Klima erzeugen, das Radikalisierungsprozesse und Gewalthandeln begünstigt. Kathleen M. Blee beleuchtet die von der Forschung lange vernachlässigte Rolle von Frauen in gewaltbereiten rechtsextremistischen Gruppierungen und Leena Malkki widmet sich dem Milieu der sogenannten School Shooter und derer eigenen virtuellen Subkultur; sie plädiert für ein erweitertes Verständnis politischer Gewalt. Stefan Malthaner argumentiert für einen Perspektivwechsel: Statt nach den psychischen Dispositionen der Täter zu fragen, sollte der sozialen Kontext mehr Beachtung finden und Einzeltäterschaft als eine spezifische Konstellation von Beziehungen zu radikalen Milieus und Bewegungen gedeutet werden. Viel interessanter Stoff also.
Mittelweg 36: Von einsamen Wölfen und ihren Rudeln. Zum sozialen Phänomen des Einzeltäters. Zeitschrift des Hamburger Instituts für Sozialforschung. Heft 4-5, Oktober 2020. 168 Seiten, 22 Euro.

Kulturelle Identität
(AM) Die Vorsatzseite dieses appetitlich gestalten Buches zeigt ein stilisiertes kleines Schiff auf weitem blauen Grund. Der Atlas der verlorenen Sprachen von Rita Mielke mit Illustrationen von Hanna Zeckau ist eines dieser schönen und nützlichen Lehnstuhl-Reisebücher, dem man viel Publikum wünscht. Der Einstieg erfolgt mit Wilhelm von Humboldt, der Sprachen liebte, ein halbes Dutzend von ihnen sprach er fließend, mehr als dreißig weitere studierte er. Mit seiner Begeisterung für die Vielfalt und Schönheit der Sprachen, so die Autorin, war er seiner Zeit weit voraus. „Jede Sprache öffnete für ihn auf je eigene Weise eine Tür zu einer neuen, anderen Sicht auf die Welt. Je mehr Sprachen er kennenlernte, desto größer, vielfältiger und bunter wurde seine Weltsicht.“
Viele der fünfzig Sprachen aus fünf Kontinenten, die Rita Mielke vorstellt, sind bereits verloren oder vom Aussterben bedroht: Irokesisch zum Beispiel, Garifuna, Aramäisch, Sami, Bora, Quechua oder etwa das nur noch rund 2000 Norddeutschen gesprochene Saterfriesisch, in das sich ein amerikanischer Linguist mit kreolischem Blut in seinen Adern verliebt hat. Sein Engagement für Pflege und Erhalt der Sprache sind beispielhaft. Er hat ein mehr als 800 Seiten dickes Wörterbuch mit an die 35.000 Begriffen zusammengetragen und das Neue Testament und die biblischen Psalmen in das Idiom der laut Guinness-Buch der Rekorde „kleinsten Sprachinsel Europas“ übersetzt. Noch weniger Menschen, nämlich weniger als hundert im Bismarck-Archipel von Papua-Neuguinea, sprechen noch „Unserdeutsch“, eine Kreolsprache auf Basis deutscher Missionare. Die Maniq in Südostasien zum Beispiel haben kein Wort für Eigentum, weil alles allen gehört, aber dafür unzählbar viele Ausdrücke für Farben und Düfte. Das letzte Kapitel gehört der deutschen Sprachforscherin Luise Hercus, die Ende der 1950er Jahre erstmals australischen Boden betrat und im Bundesstaat Victoria die Sprachen der Aborigines erforschte. Ihre Herangehensweise, Sprache als Spiegel von Lebenswelten zu verstehen, sorgte für einen Paradigmenwechsel in der Sprachforschung. Über Sprache artikuliert sich – dies zu allen Zeiten und in allen Winkeln der Welt – menschliche Zu- und Zusammengehörigkeit, persönliche und kulturelle Identität. Die Autorin dieses schönen, klugen Buches teilte mit ihr die Scham über die Hybris der westlichen Welt mit der mehrheitlichen Vorstellung, fremden Völkern nicht nur Bodenschätze und Kulturgüter entreißen, sondern auch die eigene Religion und Sprache aufzwingen zu können.
Rita Mielke: Atlas der verlorenen Sprachen. Illustrationen von Hanna Zeckau. Duden Verlag, Berlin 2020. Hardcover, Format 17 x 24 cm, mit 150 Karten und Illustrationen. 240 Seiten, 28 Euro.











