
Der Krimi – ein Traum
Tobias Gohlis schreibt seit 20 Jahren die Krimi-Kolumne in der Wochenzeitung DIE ZEIT, Gelegenheit für ein paar Fragen und Antworten, vernommen hat ihn Krimi-Autor Robert Brack.
Seit zwanzig Jahren Krimi-Kolumnist für DIE ZEIT – das klingt beinahe seriös und nach großem Einfluss. Wie weit reichen deine Seriosität und dein Einfluss?
Meine Seriosität verhält sich umgekehrt proportional zu meinem Einfluss.
Wie wird man Krimi-Kritiker? Mich hat mal eine Redakteurin von NDR-Kultur in einem (sehr guten, ernsthaften) Interview gefragt, ob ich nur deshalb Autor von Kriminalliteratur geworden bin, „weil die Trauben zu hoch hingen“. Wird man Krimi-Kritiker aus Verlegenheit oder aus Leidenschaft?
Die ernsthafte NDR-Redakteurin sollte sich diese Frage mal an sich selbst stellen.
Ich habe begonnen, als Kritiker zu arbeiten, weil die Trauben für mich als Lehrer zu hoch hingen (Arbeitslosigkeit, Nichteinstellungen) und ich als Lyriker absehbar auch nicht genug Geld verdienen würde. Krimis haben mich schon immer interessiert, aus kindlichem Eskapismus, wegen der tendenziell dichotomischen Weltsicht, wegen der Größenfantasien und der unverblümten Ersatz-Gewalt. Von der Kritik der Kunstliteratur habe ich mich abgewandt, weil die Luft in den naseweisen Kreisen zu dünn war, zu luftleer, zu konkurrenzorientiert und zu intrigengesättigt. Ich habe in dem Job sehr viel Lektüre nachgeholt, zu der ich während des Studiums nicht gekommen war. Dann – nach den Lateinamerikanern, den Franzosen und etlichen Anglosaxons – kam nicht mehr viel; Fukuyamas Idee vom Ende der Geschichte hatte sich in der Kunstliteratur als Ende der Geschichten wie Mehltau niedergeschlagen. Also habe ich mich der Reiseliteratur, einem, wie ich bald erfahren musste, nicht werbetauglichen Literaturzweig zugewendet.
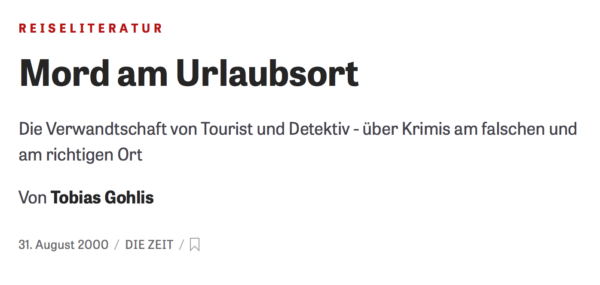
Das hätte angesichts der stetigen Zunahme des Reisens doch eine sichere Bank sein müssen.
Leider nicht, denn mit den Krisen der Buchanzeigen und damit der bezahlten Literaturkritik schrumpfte die ZEIT ihre zehnseitige wöchentliche Literaturbeilage, in der ich monatlich eine Reiseliteraturseite redaktionell betreuen durfte, sukzessive auf heute 1,5 Seiten zusammen. Kurz nach dem Ende dieser Reiseliteratur-Epoche gab der damalige Krimi-Kolumnist der ZEIT aus Altersgründen auf. Seitdem (Januar 2001) habe ich ca. 250 Kolumnen geschrieben.
Und deine Reise auf der dunklen Seite der Literatur geht immer noch weiter, du bist dem Genre treu geblieben.
Eine Kolumne schreiben, so was macht man aus Leidenschaft. Als ich anfing, dachte ich, Krimileser seit dem achten Lebensjahr, ich würde viel kennen. Nachdem ich zwei Jahre lang Kolumnen verfasst hatte, fragte mich Ulrich Greiner, damals Literaturchef, ob mir nicht langweilig würde. Da hatte ich mit dem Entdecken gerade mal begonnen. 1999 hatte Thomas Wörtche angefangen, ausschließlich nicht-deutschsprachige Titel in der metro-Reihe des Unionsverlags herauszugeben. Da war Weltliteratur im dreifachen Sinne zu entdecken: global, relevant und welthaltig.
In deiner Frage ist noch eine andere verborgen: Nein, ich habe nie versucht, Krimis zu schreiben. Aber manchmal gelingt es mir, einen komplett in einer Nacht zu träumen. Meistens finde ich ihn viel besser als den ganzen Krempel, den ich lesen muss. Dann wache ich schweißgebadet auf, versuche, die Verästelungen des Plots, die mir gerade noch gegenwärtig waren, aufzuschreiben – und stelle fest, dass Schreiben entsetzlich lange dauert.
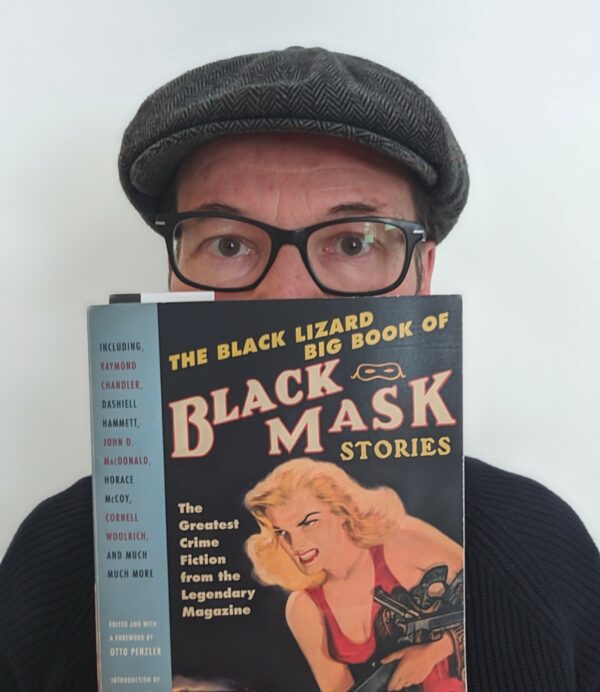
Du schreibst schon viel länger über Krimis, seit den 1980er Jahren. Wie schwer/einfach war es damals überhaupt mit so etwas anzufangen?
Damals, in den späten Achtzigern, herrschte Krimi-Aufbruchsstimmung. Ich kann mich erinnern, wie Jürgen Alberts, damals, glaube ich, Sprecher des frisch gegründeten Syndikats, in die heiligen Hallen des Literaturhauses zu Hamburg marschierte, um zu erklären, dass der deutsche Krimi genauso gut sei wie die Sachen von Grass, der gerade vor ihm rausgeschlurft war. Uwe Friesel, der sich damals auch auf den Krimi geworfen hatte, war VS-Vorsitzender, Fred Breinersdorfer folgte später dann in dem Job auf Erich Loest (der auch Krimis geschrieben hatte). Es war also nicht schwer, meiner damaligen erzkonservativen Redakteurin der Hamburg-Ausgabe der WELT (die es nicht mehr gibt) eine Serie mit Porträts Hamburger Krimi-Autoren aufzuschwätzen, wobei ich u.a. Frank Göhre, Doris Gercke, Petra Oelker und einen gewissen Robert Brack kennenlernte.
Hat es sich gelohnt, materiell und ideell?
Materiell: Ich bin nicht verhungert, musste mich nicht verbiegen, meine Rente ist niedrig.
Ideell: Zunächst einmal entpuppten sich die Krimischriftsteller als eine wesentlich angenehmere, sozial kompatiblere und weniger eingebildete Version des Berufsbildes Autor als die Kunstliteraten, die von ihrer E-haftigkeit zutiefst durchdrungen waren. Ich habe viele beeindruckende Persönlichkeiten kennengelernt, nicht zuletzt in den Jahren, in denen ich Porträtfilme über sie machen durfte.
Zudem entsprach selbst die Muss-Lektüre von Kriminalliteratur meiner Leidenschaft für welthaltige realistische Erzählungen, die ich vorher mit Reiseliteratur gepäppelt hatte. Außerdem konnte ich Geschichte, Kriminologie, Soziologie, Geografie, Kunstgeschichte, Ethnologie usw. jeweils so lange zusätzlich studieren, wie die Beschäftigung mit einem Buch dauerte. Meine Halbbildung nahm zu. Seinem Hobby beruflich nachgehen zu dürfen, kann einen zufrieden machen.
Die meisten Zeitungen bzw. Feuilletons gönnen sich bezüglich der Kriminalliteratur bestenfalls eine regelmäßige Kolumne. Der Platz ist sehr begrenzt. Wann darf ein Krimi-Kritiker eine ganze oder halbe Zeitungsseite über ein Buch füllen?
Immer dann, wenn die außerliterarischen (Skandal-) Werte hoch sind, und in Krimi-Spezials. Andererseits haben die Kolumne, das Spezial, den Vorteil, dass sie dem ständigen Kampf um den generell immer begrenzten Platz entzogen sind.
Deine Kollegin Sonja Hartl stellte einmal die Frage, ob die Krimi-Kritik wirklich gut im Feuilleton aufgehoben ist. Ich vermute, sie meinte damit, dass die traditionelle Literaturkritik nichts vom Krimi versteht, siehst du das auch so?
Natürlich ist die Krimi-Kritik im Feuilleton gut aufgehoben. Insbesondere solange sich das Feuilleton bzw. die Literaturkritik nicht selbst abgeschafft hat. Literaturkritik hat etwas mit Professionalität zu tun. Um ein Buch zu rezensieren, muss man zehn gelesen haben. Natürlich kann, wer „nebenbei“ liest, ein guter Kritiker sein, aber die Chance dazu wächst, wenn durch solides Geld die Bildungsarbeit mitbezahlt wird, die einen Kritiker ausmacht.
Ein Feuilleton ist dann gut, wenn es gute Fachkritiker für Theater, Film oder Kunst beschäftigt und im Bereich der Literatur Lyrik-, Science-Fiction-oder eben Krimi-Kenner. Ich erstaune immer wieder, wie sich z.B. in Krimi-Spezials die Kritiken meiner kunstliterarisch trainierten Kolleginnen und Kollegen in der Wahrnehmung und Bewertung von denen der Krimiprofis unterscheiden. Auffallend ist ihr beschränktes Krimiverständnis: „Krimi“ ist für sie oft etwas Formelhaftes, Ermittlungsgetriebenes, mit sehr schematischen Konstellationen von Figuren und Plots. Diese Art von (durchaus wohlwollenden) Kritiken markieren die Kante, oberhalb derer die Floskel „mehr als ein Krimi“ das Unverständnis bemäntelt. Umgekehrt ist die Nicht-Verwendung dieser Floskel ein Indiz für den Profi. Philologen der Krimi-Kritik könnten anhand meiner Kolumnen recherchieren, wann ich dieses Fettnäpfchen verlassen habe.

Neulich, bei einem Gespräch mit einem Lektor, hieß es mal wieder: Die gehobene Krimi-Kritik, das ist doch nur ein Klüngel, der im geschlossenen Kreis diskutiert, eine Blase. Wen interessiert schon, welche Bücher auf der Krimibestenliste stehen, die du 2005 begründet hast?
Das muss ein sehr wenig gehobener Lektor gewesen sein. Als Sprecher dieser „Blase“, der Jury der Krimibestenliste, antworte ich ihm, dass uns die Vorstellung eint, es gäbe so etwas wie einen guten, d.h. literarisch interessanten, thematisch ausgefallen, ästhetisch anspruchsvollen Kriminalroman, wobei die Kriterien dafür von jedem einzelnen anders gewichtet werden. Ein Lektor ist qua Job gezwungen, oft auch gegen seinen persönlichen Geschmack, sich an der Produktion der 80-90 Prozent Massenware aktiv zu beteiligen, die den Krimimarkt ausmacht. Die Leute, die sich anheischig machen, hier die Trüffel zu finden, sind zwangsläufig und notgedrungen elitär: Wer sonst soll die besten Kriminalromane finden?
Dass das kein einsames Geschäft ist, habe ich an der fünfstelligen Zahl von Fans gesehen, die bis Dezember 2020 meinen Newsletter zur Krimibestenliste abonniert hatte. Nach seiner Einstellung im Januar diesen Jahres sind etwa ein Drittel von ihnen mit einer gewissen persönlichen Anstrengung Abonnenten meiner Homepage geworden, und täglich werden es mehr. Das ist mir Beweis genug für ein konstant wachsendes Interesse an den Entdeckungen der „Blase“.
Welche Leidenschaften hegst du bezüglich des Genres? Was fasziniert dich am meisten? Welche Aspekte?
Nennen wir es die Gesellschaftsforschung: die fremden Milieus, Gewohnheiten, Sitten, Verbrechen. Die unbekannten Geographien (von Alaska oder Müngersdorf über ein Gefängnissystem bis zu entvölkerten Wäldern oder Hafengebieten). Warum gibt es keinen aktuellen Krimi, der kenntnisreich aus dem Hafenmilieu, dem Umschlagplatz von Globalisierung ins Private entwickelt ist?
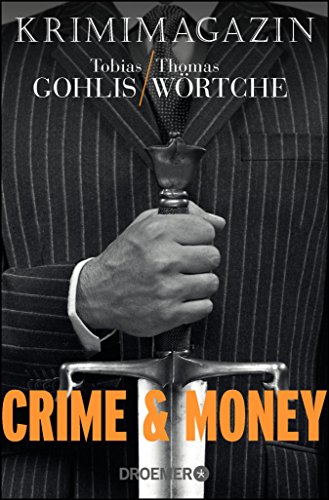
Besonders fasziniert mich der originär kriminelle Graubereich: Unter- und Oberwelten, Parallelgesellschaften, psychische Dispositionen, soziale Zwänge, Machtstrukturen, ganz besonders die Gefilde zwischen Gesetz und Gerechtigkeit und deren je nach Milieus, Land, Kultur changierenden Verfahren, das Feld von Wahn und Einbildung ausdrücklich eingeschlossen. Warum gibt es so wenig psychologisch fundierte Kriminalromane? Warum gibt es so wenig Anschauliches aus dem Bereich der Weiße-Kragen-Kriminalität? Nur, weil es in Deutschland dazu viel zu wenig Justiz gibt und Wirtschaft den Geruch des Langweiligen hat?
Wie beurteilt man literarischen (oder unliterarischen) Stil im Krimi, tut man das überhaupt?
Entscheidend ist, dass die Autorin, der Autor überhaupt einen Stil haben, den sie bewusst zu entwickeln verstehen. Ohne von ihm besoffen zu werden. Beispiele für Autoren, die hervorragend fast nur von ihrem Stil leben: Heinrich Steinfest, Simone Buchholz, Bernhard Aichner, Friedrich Ani.
Wieso wird so selten über die sprachliche Gestaltung eines Krimis diskutiert? Nichts ärgert mich mehr, als wenn ein Autor eine tolle Story mit einem super-interessanten Thema entwickelt hat und dann eine lasche biedere Sprache benutzt.

Erstens wird überhaupt viel zu selten über Kriminalromane diskutiert. Zweitens wird überhaupt viel zu selten über Kriminalromane diskutiert. Drittens wird überhaupt viel zu selten über das Literarische an Kriminalromanen diskutiert. Weshalb sie als Literatur immer noch unterschätzt sind (nicht als Ware, nicht als Ablenkung, nicht als Gattung).
Was sind die Maßstäbe eines Krimi-Kritikers? Da es sich um ein Genre handelt, also eine Kunstform mit ästhetischen/formalen Vorgaben – gibt es für Krimi-Kritiker „objektive“ Kriterien, anders als in der Literaturkritik, die die subjektive Ästhetik des jeweiligen Autors ergründet?
Den Gegensatz zwischen Genre und Kunstliteratur, den du hier aufmacht, gibt es aus meiner Sicht nicht. Da das, was du „formale Vorgaben“ nennst, inzwischen sehr weit aufgeweicht und bei guten Autoren reflektiertes Spielmaterial ist, würde ich eher von Erzählkonventionen bzw. auf der Seite des Publikums von Erwartungshaltungen reden.
Wobei hier kontextuelle oder paratextuelle Faktoren ihre eigene Rolle spielen. Zum Beispiel definieren Marketing- und Presseleute „Krimi“ oder „Thriller“ – um nur die beiden geläufigsten Erzählmuster zu nennen – völlig anders als Autoren, nicht zu reden von Subgenres. Ein Beispiel: Autor G verfasst einen sehr experimentellen Text, der etwa die Figuren fast nur durch dialogische Interaktion definiert, gibt ihnen zudem je nach Situation und Gegenüber persönliche Spitznamen, die man als Leser nur mühselig entschlüsseln kann. Auf der Bühne wären die Figuren identifizierbar, im Text bleiben sie vielfach uneindeutig. Würde der Verlag den Text als „experimentellen Anti-Krimi und rasante Cop-Novel zugleich“ ankündigen, und nicht als „Thriller“, würde er ein anderes Zielpublikum ansprechen.
Dazu fällt mir das französische Beispiel Jean-Patrick Manchette ein, der zu Lebzeiten als Autor von Action-Romanen galt und heute als Literat mit hochartifiziellem Stil gilt. Als er einmal einen Thriller ablieferte, der zwischen Seite 40 und 140 keine Action hatte, wurde der Roman von der Série Noire abgelehnt und in eine literarische Reihe verbannt.
Jeder Kriminalroman muss wie ein Roman betrachtet werden, die individuelle Ästhetik ist aus den gegebenen Voraussetzungen und Referenzen zu erschließen und auf ihre Kohärenz hin zu bewerten. Das Besondere am Kriminalroman im Unterschied zum kunstliterarischen ist ein Set der durch den Begriff „Kriminalroman“ gebildeten Elemente und ihre Schwerpunkte. Also der thematische Komplex Verbrechen und Aufklärung, nicht eine besondere Form des Erzählens. Ausschlaggebend für meine Analyse und Bewertung ist deshalb, wie diese Krimi-Elemente zueinander in Beziehung gesetzt sind und die Art der Beziehungen zwischen diesen Elementen sowie ihre Gestaltung. Ob Cop, Berufsverbrecher, Kriminalpsychologin, alleinerziehende Mutter, psychopathischer Serienkiller auf der Figurenebene, ob Cosy, Psycho- oder Politthriller oder Mischungen davon auf der Plot-Ebene: Entscheidend für mich ist, dass erkennbar wird, dass die Autorin oder der Autor neben allgemeiner Schreibfähigkeit über den Sinn und jene spezifische Sachkenntnis verfügt, die vom Kriminalroman als einem vorwiegend auf Realitäten bezogenen Genre erwartet werden kann.
Das ergibt sich zwangsläufig aus dem Thema „Verbrechen“, das gesellschaftlich definiert ist, also ohne konkrete Realität und historische Einbettung eine läppische Spielerei, eine Luftnummer wäre.
Und hier steigen die Anforderungen: Wer sich (auch als Übersetzer) nicht mit den Rangbezeichnungen und Kompetenzen der Polizeien auskennt, z.B. einen US-Detective nicht von einem DC der britischen Polizei unterscheiden kann, wer nicht weiß, dass ein Commissaire der französischen Polizei ein relativ hoher Beamter ist (Maigret z.B. ist etwa im Rang, nicht in den Kompetenzen, einem deutschen Polizeidirektor vergleichbar) hat im Krimi nichts zu suchen. Natürlich sind forensische Kenntnisse unverzichtbar. Oder psychologische oder soziologische. Wer über die „dunkle Seite“ schreibt, sollte sie kennen.
Ein gutes Beispiel für gute spezifisch kriminalliterarische Eindringungstiefe sind Friedrich Anis Tabor-Süden-Romane, die von „Vermissungen“ handeln. Ani verwendet hier einen Fachbegriff, den ein kriminalistischer Außenseiter der bayrischen Polizei entwickelt hat, als Vorschlag, um terminologisch „Vermisstenfälle“ von bürokratischem Ballast zu befreien. Bei Ani steht „Vermissung“ für den polizeilichen Blick auf etwas, das von sozialer Katastrophe bis Selbstrettung reicht.
Ein immer wieder neu zu diskutierendes Feld ist die Grenze zwischen Kriminalliteratur und Kunstliteratur. Viele Kunstliteraten scheitern bei ihren Versuchen, Krimi zu schreiben oder Krimiplots zum vermeintlichen Motor von Kunst zu machen. Das hat viele Gründe: Sie verfehlen Atmosphäre und Tonlage, verlieren sich in Nebenaspekten, ihnen entgleitet der Kern von Verbrechen und Aufklärung.
Ein Kriminalroman ist eine handlungsorientiert Literaturform. Nicht nur der Fall bzw. die Intrige, sondern auch die Charaktere werden durch Handlung erzählt. Das würde ich schon als ein grundlegendes Merkmal herausstellen.
Es ist ein beliebter Vorwurf der Kunstliteraturkritik, Kriminalromane würden zu sehr nach dem Plot beurteilt. Erstens ist das eher eine Folge des Verlustes an Plot/Erzählbarem in der Kunstliteratur. Zweitens unterschätzt das die Bedeutung des Plots: Ein Kriminalroman funktioniert von Anfang bis Ende oder gar nicht. Erst das materielle Ende legt oft die Haltung des Autors zum dargestellten „Fall“ oder den behandelten Realitäten offen: Zur Rolle von Polizei, Staat, Macht, einzelnen Figuren; ist das vorher Erzählte satirisch, parodistisch, entlarvend gemeint?
Daher respektiere ich zwar (das oftmals hysterische) Vermeiden von Spoilern, versuche aber immer, in meinen Kritiken das Ganze vom Ende her zu beurteilen. Spoilern ist auch die schärfste Waffe des Verrisses: das untergräbt die naive Konsumlust an schlechten Büchern.
Muss die Kritik im Krimi nicht auch den Trash-Faktor positiv in Rechnung stellen, d. h. das Grelle, Grobe, Billige nicht nur dulden, sondern als ästhetisches Mittel ernsthaft mit in Betracht ziehen?
Unbedingt. Trash ist ein Stilelement unter anderen, das mit Vorsicht eingesetzt werden sollte – wie jedes Stilelement. Ansonsten: Deine Frage verkennt, dass das Krasse, Groteske, meinetwegen auch Trash, seit jeher Bestandteil von Literatur ist. Was wäre die Bibel ohne Trash – oder wie würdest du so etwas wie das Kainsmal, mit dem Gott zudem einen Mörder vor Verfolgung schützt, bezeichnen? Oder Thomas‘ Grapschen in der Speerwunde Jesu?
Möglicherweise sind das Grelle/Effekthascherische und Feinsinnige/Zutiefstmenschliche auch in der „hohen“ Literatur mal Eins gewesen – bei Shakespeare? Und wurde später vom Bürgertum aus der Kunst getilgt?
Jede Zeit, Region und Kultur pflegt hingebungsvoll ihre eigenen Cancel-Cultures. Und ihre Marotten. Zurzeit sind es etwa die aus der angelsächsischen feministischen Selbstermächtigungswelle herübergeschwappten „unzuverlässigen Erzählerinnen“ – wann bitte, war je ein Erzähler, männlich oder weiblich oder nicht-binär, zuverlässig?
Apropos: Was hat sich in den letzten 20 Jahren geändert, im Genre?
Die erfreulichste Entwicklung auf dem deutschen Markt ist die Erweiterung der bornierten Perspektiven: Hier wird viel übersetzt, die Literaturen ferner Regionen geraten ins Blickfeld deutscher Leser.
Dieser erfreulichen Tendenz widerspricht allerdings die ungebrochene ökonomische, mediale Dominanz der US-Literatur, wobei sich die Marktmacht der US-Verlage mit der informationellen der (Un-)Social Media aus den USA vervielfacht.
Und natürlich – horribile dictu – die „Bad Bank“ der Kriminalliteratur, der Regiokrimi.
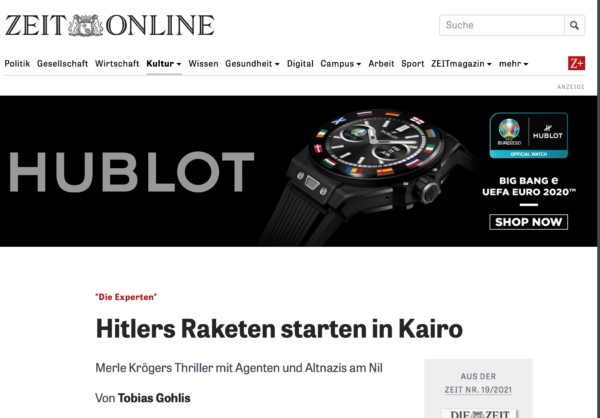
Auch in der Krimi-Kritik hat sich einiges gewandelt, vielleicht sogar zum Besseren?
Die Krimi-Kritik war vor 20 Jahren im Aufschwung. 2001 hatte ich für meine Krimikolumne in der ZEIT 4300 Zeichen zur Verfügung; vor Corona war der Umfang auf 2560 geschrumpft; derzeit bin ich in Kurzarbeit: Statt einmal alle vier Wochen sind vier „Kolumnen“ im Jahr vorgesehen.
Gegen den hier beispielhaft angezeigten Trend schmückt sich ausschließlich die FAZ seit einigen Jahren monatlich mit einer ganzen Feuilletonseite Krimikritik. Die meisten anderen Zeitungen begnügen sich mit mehr oder minder regelmäßigen Kolumnen – da herrscht eine gewisse Wellenbewegung – und mit Spezials zum Krimi. Als einzigem „populären“ Genre wird dem Krimi immerhin das zugestanden.
Ich würde schätzen, dass die Krimikritik immer noch – in den meinungsbildenden Zeitungen jedenfalls – die Fernsehkritik überwiegt. Andere Literaturgenres – in gewisser Weise die Literatur als Gattung insgesamt – werden noch viel stärker vernachlässigt.
Aber das alles hängt von der Werbestrategie der Verlage als Anzeigenkunden und damit Rezensionsraumbeschaffern ab. Die Schwerpunktverschiebung der Werbeetats auf Online/Social Media hat gravierende Konsequenzen für Literatur, Kultur, Lesegewohnheiten und kritische Auseinandersetzung. Optimiert werden nicht die Kontroverse und das Nachdenken, sondern die Anpassung an Stimmungs- und Genussmehrheiten.
Und von den Zeitungsverlegern, die sich mal andere Finanzierungsstrategien für ihre Feuilletons ausdenken müssten als die Buchanzeige. Den Trend hat jedenfalls Springer gesetzt: Mit der Umstellung des Zeitungskonzerns auf digital/online wurde die Krimikolumne des langjährigen Jurymitglieds der Krimibestenliste Elmar Krekeler abgeschafft, obwohl er seine scharfen Texte dem digitalen Anzeigenrhythmus hervorragend angepasst hatte.
Immer mehr Krimis überall. Die Stapeltische in den Buchhandlungen quellen über vor Krimis jeder Sorte. Kommerziell betrachtet ist der Krimi aus der Schmuddelecke raus, er ist sogar in der Spiegel-Bestsellerliste etabliert, dominiert die Liste bisweilen. Aber das betrifft zumeist biederes Genre-Handwerk.
Wie kommst du auf die Idee, die Spiegel-Bestsellerliste sei keine Schmuddelecke? Den grassierenden Ungeist zeigen die Umbenennungen der Literaturbeilagen des SPIEGELs über die Jahre: von KULTUR-Spiegel in LITERATUR-SPIEGEL in SPIEGEL-BESTSELLER, und die Auswahl der Rezensionen scheint dem angepasst zu werden.
Hat das Mehr an Masse auch ein Mehr an Klasse hervorgebracht?
Ohne Masse keine Klasse, einerseits. Andererseits: Autoren müssen leben und sich deshalb an den Markt und seine nicht an Klasse orientierten Mechanismen anpassen.
Nehmen wir die entwickelten Krimi-Szenen Großbritanniens und Frankreichs: Beide leben auf unterschiedlichen, breit in der Bevölkerung wie in den akademischen Sphären verankerten Krimi-Kulturen. Die deutschsprachige Krimikultur ist dagegen unterentwickelt.
Meine These: Sie hat in der Breite weder das moralische noch das ästhetische Trauma des Nationalsozialismus überwunden und reagiert darauf mit Bravheit. Ästhetisch herrschen angloamerikanische Muster vor, meist in ihrer skandinavischen Ausprägung; moralisch-politisch ist die Masse der Autorinnen und Autorinnen gesinnungsmäßig brav FDGO-konform (selbst in den herrlich satirischen de-Bodt-Romanen Christian von Ditfurths); das Böse wird individualisiert (am übelsten in den Psychopathen-Romanen Sebastian Fitzeks, stets auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste) oder klischiert (jüngstes trauriges Beispiel, wenn auch literarisch anspruchsvoller: Jan Seghers „Der Solist“).
Das mag auch ein Grund dafür sein, dass im deutschsprachigen Raum „Noirs“ so wenig Anklang finden. Deutsche Leser wollen neues Böses nicht sehen, sie ziehen die Realitätsflucht vor; deutsche Autoren scheinen sich mehrheitlich als Antifaschisten zu sehen, die glücklicherweise den Nazismus hinter sich haben und deshalb den neugewonnen Common sense nicht allzu sehr gefährden möchten, und schreiben deshalb brav – und vielleicht ist das auch gut so.
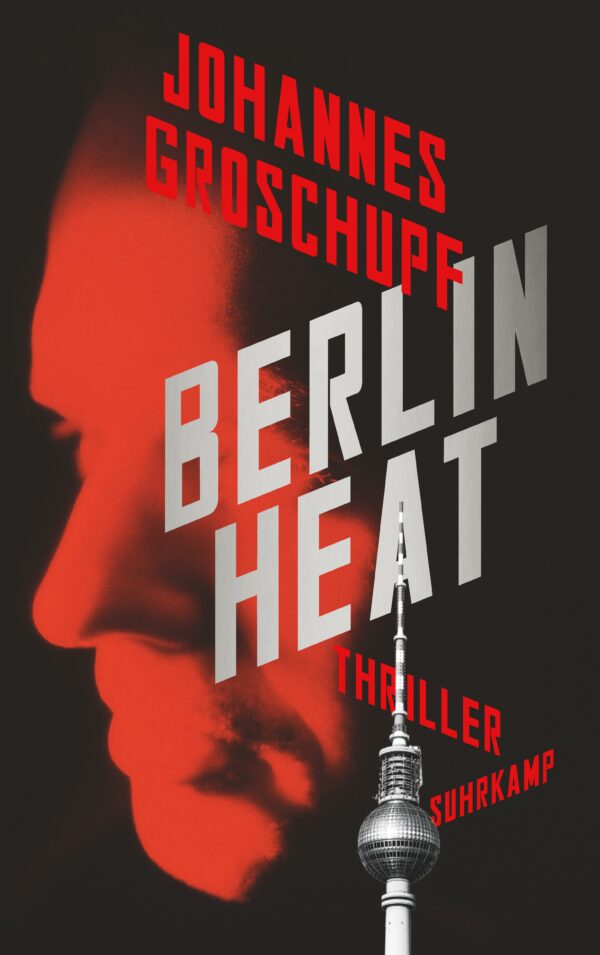
Aber das ändert sich: Johannes Groschupf – persönlich Opfer schwerster Verbrennungen nach einem Hubschrauberabsturz in der Sahara – ist einer, der mit seinen beiden Berlin-Romanen tief in den Dreck der Gegenwart packt – für mich ist das weniger „Noir“, sondern „Braun“ – eine neue ästhetische Kategorie, die den Braunen sogar ihre Farbe streitig machen kann und will.
Gibt es etwas, dass dich an der heutigen Kriminalliteratur wirklich nervt?
Mich nerven: Übersetzungen, die kein Deutsch können, insbesondere Anglizismen; die Geringschätzung der literarischen Arbeit, die in Kriminalliteratur steckt, durch die Akzeptanz von Verwertungsprozessen, aus denen Krimis wie fast-fashion herauskommen; die Überbewertung von Social-Media-Wellen bei der Beurteilung der Relevanz von Kriminalromanen; Verachtung der Leser, Routine, Klischees, Scheiß.
Wer kritisiert die Kritiker? Inwieweit gibt es einen Dialog zwischen den Kritikern?
Insgesamt ist es ein Manko der deutschsprachigen (Krimi-)Kultur, dass viel zu wenig literarische Kritik geübt wird. Das beginnt mit der Verschiebung von der Rezension zu „weicheren“ Verständnis-Besprechungen. Von Ausnahmen abgesehen, werden die für sachkundige Kritik zur Verfügung stehenden honorierten Plätze immer weiter reduziert: das Ergebnis sind Empfehlungen bzw. sehr pauschale Bewertungen. Da ist wenig Raum für Auseinandersetzungen. Und Kämpfe kosten Kraft, Geld und Zeit.
Die Gruppe der Kritikerinnen und Kritiker, die überhaupt halbwegs professionell Krimikritik betreiben, ist so klein, dass eine öffentliche Auseinandersetzung drastische soziale Folgen haben kann. Eh man sich versieht, werden aus Freunden Feinde. Und ein Publikum – außer dem marginalen Fachpublikum – gibt es dafür nicht.

Formen einer brancheninternen Auseinandersetzung wie auf den vier Symposien von „Krimis Machen“, die ich initiiert habe, scheinen sich nach vier anregenden Begegnungen erschöpft zu haben.
Dialog, Kontroverse, unterschiedliche ästhetische Positionen finden im deutschsprachigen Raum (mit Wirkung über den hinaus) ihren Platz eigentlich nur an dieser Stelle, im CulturMag, kenntnisreich, voller Leidenschaft, außerhalb der ökonomischen Verwertungszwänge.

Hat sich durch die Blogger etwas geändert? Werden die ernst genommen oder schaut man auf sie herab?
Das ist keine soziale Klassenfrage. Zum Zustand der deutschen Krimikultur gehört, dass Blogger – von Ausnahmen abgesehen – ihrem Selbstverständnis nach nicht kritisieren, sondern ihre subjektiven Meinungen, Empfindungen und Erlebnisse zu einem Titel zum Besten geben. Damit sind sie – im Unterschied zur literarischen Kritik – dem öffentlichen Diskurs entzogen, da ihre Wertungskriterien subjektiv und privat sind. Blogger sind keine Kritiker, sondern als besonders aktive Leser ein Teil der Krimikultur. Die sozialen Lesezirkel wie Vorablesen.de usw. erreichen mit ihren ebenfalls eher subjektivistischen Statements leider nicht das kritische Niveau, das in der US-amerikanischen Online-Kultur ein Forum wie Goodreads vor der Einverleibung durch Amazon hatte, in dem engagierte Leserinnen und Leser sowie academics sich argumentativ über Bücher und Autoren austauschten.
Wie groß ist der Anteil von Verrissen unter deinen Rezensionen? Und warum?
Er beträgt 1 Prozent. Verrisse lohnen sich nicht, da sie keiner liest.
Hat sich nicht in den letzten Jahrzehnten ein Trend durchgesetzt, nämlich die Trennung in U und E auch im Genre, also zwischen „Konzernschrott“ (wie du es mal ausgedrückt hast) und literarisch ernstzunehmender Kriminalliteratur.
Wo hast du dieses Zitat her?
Mit eigenen Ohren gehört!
Die klassische Unterscheidung zwischen U und E (Unterhaltungsliteratur gegen Ernsthafte Literatur) ist obsolet. Allerdings teile ich die Auffassung von Friedrich Ani, dass es im Kriminalroman um Leben und Tod geht, und dass das von Autoren (und Kritikern) ernst genommen werden sollte.
„Konzernschrott“ entzieht sich der literaturkritischen Bewertung, ist für Ökonomen, Soziologen und Ethnologen interessant und ernährt die systemrelevanten Müllwerker.
Hat der Krimi als Genre eine Zukunft? Die ernsthafte, realistische Kriminalliteratur begann mit Dashiell Hammett 1923 und wurde zur Erzählung des 20. Jahrhunderts, wie der Jazz der Soundtrack des 20. Jahrhunderts wurde. Hammett und seine Nachfolger beanspruchten soziale und politische Relevanz für ihre Geschichten. Sie folgten einem Drang zur Aufklärung. Aber ist die im 21. Jahrhundert beinahe naiv wirkende Aufklärungsstrategie eines Kriminalromans noch tauglich zur Wirklichkeitsbewältigung?
Die Kriminalliteratur ist keine „realistische“ Literatur oder nur insofern, als sie mit den Realien des Lebens auf ihre besondere Weise umgeht. Nehmen wir als Beispiel das höchst artifizielle Gebiet der Detektiverzählung seit Edgar Allen Poe: – äußerst weltfremd, paranoid und narzisstisch.
„Realismus“ ist daher für mich nur ein Kriterium zur Beurteilung von Kriminalliteratur; „ernsthaft“ ist jede Form von Krimi, die ihren Gegenstand (s.o.) ernst nimmt, und sei es die absurdeste, komischste, groteskeste. Eine der Quellen der Kriminalliteratur ist der Surrealismus, eine andere sind Drogen. Wenn du die ernsthafte Kriminalliteratur auf eine „realistische“ Epoche und Strömung reduzierst, argumentierst du, als sei nur die Volksdroge Alk relevant und leugnest Kokain, Heroin, Crack, LSD und all die anderen bewusstseinserweiternden Drogen.
Aufklärung tut not, ist aber zu wenig, um Kriminalliteratur in all ihrer Kraft zu charakterisieren.
„Kriminalliteratur kann alles“ (Jochen Vogt). Und daher wird sie, sofern es noch Leben, Liebe, Tod und Gewalt gibt, also Menschen, nicht aussterben, sondern hoffentlich immer wieder neue Formen finden.
Aber wie soll das im Zeitalter der sozialen Medien und der zahllosen Alternativ-Erzählungen der Wirklichkeit von einem so trägen Medium wie dem Buch noch geleistet werden?
Och, solange wir unser Gehirn nicht auf eine Festplatte auslagern können, besteht die „Descartes-Schranke“ (Tom Hillenbrand: „Hologrammatica“). Damit sind Lesen und Denken und Fantasieren an den menschlichen Körper gebunden, und der ist nun mal nicht so schnell wie das dumme Digitale. Dafür aber reflexiv, erfindungsreich, empfindsam.
Sind die politischen, wirtschaftlichen, sozialen und psychischen Strukturen von (missbrauchter) Macht und (widerrechtlicher) Herrschaft mittlerweile nicht so komplex und ihre Verschleierungstechniken so raffiniert und vielschichtig, dass eine schlichte Kriminalerzählung, womöglich noch mit moralischem Impetus, diesen komplexen Verhältnissen völlig hilflos gegenübersteht?
Und das sagst du als Autor? Willst du aufgeben? Das wäre aber schade.
Vielen Dank für das Gespräch!
Hamburg, im Mai 2021
CrimeMag dankt Robert Brack für seine Herkulestat und dem Interviewten für Auskunftsfreude und Geduld. Tobias Gohlis bei CrimeMag, sein Blog „recoil“ hier. Robert Bracks Texte bei uns hier. Sein nächster Thriller heißt „Blizzard“, erscheint im Herbst bei Ellert & Richter und handelt von einem Juwelenraub, der in einer Schneekatastrophe endet.










