junge rehaugen
express! Eine neue Form von Kritik. Wir exp_erimentieren mit neuen Ansätzen in der digitalen Literaturkritik. Wer denkt wie und warum? Was sagt die Autorin dazu? Können Sie das nachvollziehen? Interaktiv und transparent - eine demokratische Debatte über Literatur. Zwei Literaturkritikerinnen und eine Autorin im Dialog.
In der 6. Folge der Reihe reden Martin A. Hainz und Mario Osterland über DIESER JUNGE. DIGITAL TOES. von Crauss, erschienen im Verlagshaus Berlin in der Edition Binaer. Die Edition Binaer bringt das Gedicht in den virtuellen Raum und wir nutzen genau diesen Raum, um dem Gedicht in die jungen Augen zu sehen. Es geht los ...
Ping-Pong-Pang

Da express! ein Ping-Pong (oder genauer Ping-Pong-Pang, der Autor mischt ja auch mit) ist, beginne ich mit einer kurzen Skizze, worum es in dem Text DIESER JUNGE. DIGITAL TOES geht oder gehen könnte, und führe ein paar Beobachtungen an.
Der Text versammelt Impressionen, und zwar memorierend, vergegenwärtigend, etwa:
„du schlägst die augen auf: sand. du schlägst die augen auf: schnee. du schlägst auf land und fndest ein kind, das du manchmal warst."
Was sich hier verdichtet, folgt keinem narrativen Verlauf, ist Eindruck. Bilder, die vorbegrifflich sich eingebrannt haben mögen, die als Nicht-Erzählform befragt werden:
„du schlägst die augen auf: schnee. du schlägst die augen auf: rot. du blinzelst, der junge hebt seine hand. aufschlag, er hat dir gewunken und trinkt die orangen jetzt leer."
Wie sehr hier Eindruck Ausdruck wird, unterstreicht die behutsame Layoutierung, samt „Betonungszeichen", manches „schneller", manches „langsamer" zu lesen, mit „hohe(r)" oder „tiefe(r) Stimme". Das Verdichten wird dann auch diskursiv etwas erhellt, da sei zunächst eine – z.B.: Herbst- – Stimmung, die aber erst gegeben sei, wenn sie „zum kompakten einwortsatz" geronnen (!) ist, agglutiniert, sonst preisgegeben an „moritat, handlung, bewegung und schlieriges verschwinden."
Die Impression korrespondiert hier dagegen mit der Expression, die sie als das, was sie sei, datiert, mit all den Paradoxien, die man hier diskutieren könnte – und die wir in der Folge vielleicht diskutieren werden.
Diskussion
Kommentare
Das Gedicht hat eine Geschichte

Worum es geht oder gehen könnte in Dieser Junge. Digital Toes. und in dieser sechsten Auflage von express! – Martin Hainz hat einen Anfang gemacht. Ich stimme zu und widerspreche.
Die Beobachtung, dass in Crauss' Gedichten Eindruck zum Ausdruck wird, ist natürlich absolut richtig. Das mag zunächst vielleicht etwas vereinfacht, vielleicht sogar banal klingen, ist jedoch in zweifacher Hinsicht wichtig. Der sprachlichen Engführung vom Eindruck zum Ausdruck ist es nämlich unter anderem zu verdanken, dass Crauss' Gedichte – ich habe das an anderer Stelle schon gesagt – eine bestechende Sinnlichkeit bekommen, die ihren Themen angemessen ist. Und hier muss natürlich gleich der Widerspruch kommen, denn man könnte zu leicht denken Crauss schreibt in schönen Worten auf, was er erlebt und fertig ist das Gedicht.
Doch so kurz sind die Wege zwischen Eindruck und Ausdruck, Impression und Expression wirklich nicht. Davon kündet insbesondere der Essay august acker. wie wie akazie in den orangensaft kommt, der dieser Sammlung beigegeben ist. In ihm gibt Crauss Einblick in den Entstehungsprozess mancher Gedichte dieser Sammlung und wie sie mit anderen, früheren Gedichten und fremden Texten verbunden sind; Saint-Exupérys Nachtflug etwa, und besonders W. G. Sebalds Austerlitz. So bekommen manche Gedichte eine darunterliegende Geschichte, die oft so viel mehr ist, als eine „Poetisierung“ von Eindrücken. Das Gedicht hat eine Geschichte und dadurch meistens auch die Möglichkeit narrativ zu sein, narrativ gelesen zu werden. Viele Liebesgedichte in Dieser Junge. Digital Toes. erzählen. Aber bleiben wir zunächst bei dem von Martin anzitierten ausgust und acker (für jaques austerlitz).
die nüstern blähen sich blutig, wünschen ˇ sich wind und nicht dieses geschürfte zuhause. ˇ ein junge in hohen strümpfen und goldenen fransen, ˇ und man hört einen heimlichen traktor, ˇ und man hört verschiedenes rufen.
Ich kann mich nicht wehren. Wenn ich diese Verse lese, bekomme ich über dein Eindruck hinaus etwas erzählt. Das „geschürfte zuhause“ ist in einem Wort beschrieben und mir wird erzählt, das Zuhause lädt nicht zum bleiben ein. Man wünscht sich Wind, stattdessen nur das schwerfällige Motorengeräusch eines Traktors, der einen nicht weit bringt.
Vielleicht müssen wir darüber reden. Über Dichotomien – Eindruck und Ausdruck, Narration und Verdichtung, Form und Inhalt. In jedem Fall aber über Lyrik und eBook. Über das Kompilieren und Mixen von eigenem und fremden Material. Über das Liebesgedicht heute.
Diskussion
Kommentare
Kleine Synkope

Nun wäre zwar der Dichter dran, aber eine Rhythmusstörung sei mir verziehen: »Die Beobachtung, dass in Crauss' Gedichten Eindruck zum Ausdruck wird, ist natürlich absolut richtig.« – Danke. Dann aber bitte auch weiterzulesen, denn ich schrieb, dass die Impression mit der Expression korrespondiert, »die sie als das, was sie sei, datiert, mit all den Paradoxien, die man hier diskutieren könnte« – keine Rede davon, dass Crauss »in schönen Worten auf(schreibt), was er erlebt«, »und fertig ist das Gedicht«. Ich lege das auch nicht nahe. Datieren würde vielmehr das bedeuten, was in der Literaturtheorie etwa Derrida zeigte.
Ich glaube, wir sparen uns und den Lesern Zeit, wenn wir auch einander einigermaßen gründlich lesen, selbst dann, wenn das bedeutet, dem eine Pointe (oder einen Widerspruch) zu opfern. Danke!
Diskussion
Kommentare
die bewegungsfreiheit erweitern
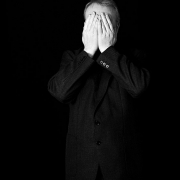
zunächst: DIESER JUNGE ist ja nun gerade nicht ein text, sondern eine sammlung von in reihe - heisst: in spannungsbogen oder leseverlauf - gesetzten gedichten. ich behaupte sowohl narration im einzeltext als auch über die gedichte hinweg. ich behaupte jedoch nicht, eine lückenlose geschichte zu erzählen oder eine einzelne erinnerung, einen traum oder ähnliches zu referieren.
das lyrische layout orientiert sich an wiederkehrenden motiven, an übergängen und cross-fades. das äussere (und in Martins erstem statement ping-pong-pang ignorierte layout mit formatzeichen, dem lyricode (jedoch gerade bei DIESER JUNGE nicht angewendeten betonungszeichen!) war eine notwendigkeit, gedichte überhaupt in die ebook-form bringen zu können, ohne daraus prosa zu machen. es ist ein unterschied, ob ich zeilenwechsel mitlese(n kann) oder nicht.
die zitierte "herbststimmung" kommt übrigens nicht im eigentlichen textkorpus vor, sondern im aufsatz über die entstehung des gedichts "august und acker". von moritat und schlierigem verschwinden begünstigenden "strickjackenwetter" muss man freilich nichts wissen, wenn man "august und acker" oder das parallelgedicht "volle blüte" erkunden, geniessen und reflektieren will. aber man kann. und mir machts spass, durch ein glossar oder das essay die bewegungsfreiheit ein bisschen zu erweitern.
was sagt Derrida denn zum "datieren" bitte? und weiss er, dass man rück- und umdatieren kann?
Diskussion
Kommentare
Eigentlich...

... ist eine Rezension kein Derrida-Seminar, ich wollte mit dem Hinweis nur darauf hinweisen, dass Impression nicht Expression wird, und "fertig", sozusagen. Aber zumindest die Frage, ob Derrida wusste, "dass man rück- und umdatieren kann", greife ich auf. Gegenfrage: Was sonst wäre das Datieren? Oder lebst du in einem perfekten Antizipationshorizont bzw. datierst alles in Echtzeit?
Zu den Sonderzeichen: Ich setze gerade meinen neuen Laptop auf, darum fehlten die zuletzt, ich wies aber auf ihren Gebrauch hin. Sowieso ist eine Rezension ja Anstoß, ein Buch zu lesen – oder nicht zu lesen, sie ist nicht philologischer Befund, der samt Fußnote auszuweisen hat, worauf man hinweist.
Hingewiesen habe ich auf das Spiel von Impression und Expression, nun steht mal die These im Raum, dass die beiden nicht naiv einander entsprechen, das hoffte ich, das behauptetet ihr; möge es im nächsten Statement, das sich dann vielleicht wirklich als Textarbeit erweist, konkret werden.
(Läuft. Bergab und rückwärts, aber immerhin.)
Diskussion
Kommentare
Zur „narration im einzeltext“...

...die es mir in einigen dieser Gedichte besonders angetan hat, weil sie über die angesprochene Sinnlichkeit funktioniert. In waiting for the hurricane etwa, das als Roadmovie in der Schwüle alle Eindrücke aufsaugt und mittels Erzählung zum Ausdruck bringt:
… der junge, ˇ der vom flugplatz mit aufs zimmer gekommen war, ˇ roch nach andern männern; freundschaft ˇ gab es in dieser stadt nicht, und ich versuchte dich ˇ seit wochen zu vergessen. träge verteilte der ventilator ˇ meine gedanken im raum, als das telephon ging. ...
So lässt sich die Trias Impression – Narration – Expression vielleicht verbinden. Wobei ich jetzt auch wieder in die Falle der Kategorien tappe, zumal solcher, die in ästhetische Richtungen (ab-)lenken könnten.
(Mein Widerspruch am Anfang galt im Übrigen gar nicht so sehr Martins Begriffen, sondern war mehr ein vorgreifender, allgemeiner Einspruch à la „glauben Sie nicht: Ausdruck folgt direkt auf/oder ist gleich Eindruck, 'und fertig'“. Ein Missverständnis also.)
Impression und Expression will ich in diesem Zusammenhang für einen Moment bewusst falsch verstehen. Ich denke assoziativ in Richtung Kunstgeschichte. In der Ankündigung des eBooks steht nämlich etwas von „barocken Schnörkeln“, die ich in diesen Gedichten aber, zum Glück, noch immer nicht finden konnte. Denn wo ist in dem zitierten Gedicht die überladene Bildlichkeit, das wuchtige Ornament? Man wird sie nicht finden. Stattdessen eine eindrückliche, poetische Erzählung von Sehnsucht und einer gewissen Orientierungslosigkeit.
Und der Junge! Dieser Junge. Der aus august und acker? Dieser Junge vom Titel? Der allen Texten inhärent ist, obwohl sie keine „lückenlose Geschichte“ erzählen.
Wie kompiliert man so eine Sammlung eigentlich, in der neue, alte und zukünftige Texte vereint sind?
Diskussion
Kommentare
der junge riecht nach kif
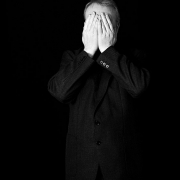
ganz recht, ein Derrida-seminar wollte ich hier auch nicht belegen. mir war bloss nicht klar, was mit dem datieren gemeint sein sollte. ich schreibe und datiere selbstverständlich nicht in echtzeit, dazu ist meine arbeitsweise eine zu langsame, vielleicht gerade deshalb aber eine sehr sinnliche.
ausdruck mag eindruck sein, eindruck ist aber noch kein ausdruck. deshalb darf es auch nicht bei barocken schnörkeln bleiben, die in DIESER JUNGE wahrscheinlich eher einzelne ornamente innerhalb der texte sind und nicht die dekorative ausschmückung, das überborden des ebooks als ganzem.
schnörkel wäre evtl sowas wie die nüstern in "august und acker", die sich "blutig blähen" oder die sonne in "der junge", die "durch das frons flirrt", und dann - eher aus der draufschau denn durchs direkte bild - die "botticelli locken" des eleven, der nach kif riecht, wenn er schwitzt ...
sehnsucht und orientierung. das gefällt mir.
was das kompilieren der kleinen sammlung angeht, so war es nicht sehr schwer, gedichte zum thema begehren in meinen manuskripten zu finden. es ist was mich angeht, über das ich immer wieder schreibe. einige gedichte habe ich überarbeitet, beispielsweise "männer und frauen im traum", oder veranlasst durch das lektorat mit Jo Frank, dem verleger, miteinander kombiniert: "hotel örop" bestand ursprünglich aus zwei zwar miteinander sprechenden, jedoch separat verfertigten gedichten.
neue, alte und zukünftige texte - hier sind wir wieder beim datieren - vertragen sich durch die wiederkehr von motiven miteinander, und eventuell auch dadurch, dass man ein art typischen Crauss-ton liest.
Diskussion
Kommentare
Offenes

Im Moment sehe ich in der Diskussion zweierlei: Saint-Exupérys und W. G. Sebalds Literatur einerseits (hoch gegriffen, übrigens), also Lyrik mit Prosa (oder einfach einer Kontextualisierung) als Basis, was mir die Funktionsweise recht erhellend zu beschreiben scheint: Impression wird Expression, aber in dem Sinne, dass (1) das, was mit einem Eindruck gemacht wird, also der Eindruck selbst, agglutiniert, und (2) dieses "Datum" einem Text eingeschrieben wird.
Dabei gefällt mir auch das Offene, der Text ist fertig, aber seine Versatzstücke, wenn man sie auszumachen sich entschließt, ergeben latent schon neue Optionen: "There is a crack in everything / That's how the light gets in" – wie Leonard Cohen an dieser Stelle (zumal heute) nicht zitieren..?
https://www.youtube.com/watch?v=6wRYjtvIYK0
Die zweite Beschreibung beharrt auf dem Eigenen darin, dass Crauss also, wie er sagt, eine "art typischen Crauss-ton" zu bieten habe, wie verbindlich auch immer. Ich mag es, wenn Autoren in der dritten Person von sich schreiben ... jedenfalls amüsiert es, wenn die Literaturgeschichte so schon Termini offeriert bekommt. Das lasse ich trotzdem nur als Ziel mal so stehen, zum Urteil, ob es so sei, haben wir ja noch Zeit.
Weil da vielleicht auch ein "close reading" Sinn hätte, zitiere ich hier einmal die "Zeichentabelle", damit, wer in der Folge ohne Kenntnis des Buches mitliest, überhaupt versteht, was ich sträflich wegließ, während es ohne Erklärung einen ja auch nicht weiterbringen muß:
"Basiszeichen: ∙ Ein ¨ Zwei ˇ Zeilenumbruch ¬ Einzug – Leerzeichen
Layoutzeichen: ≡ Blocksatz ≈ Flattersatz ÷ Aufzählung
Betonungszeichen: ˘ Betonung ´ schneller ` langsamer ˚ hohe Stimme ˛ tiefe Stimme"
Mal sehen, was sich da noch sagen läßt ... und ob der Umstand, daß es keine Leserkommentare trotz offenbar zahlreicher Zugriffe gibt, sich erklären wird. Rätsel über Rätsel.
Ich lese dann inzwischen mal Michael Krüger weiter, glänzend, der neue Band von ihm.
Diskussion
Kommentare
Die Offenheit...

… ist ein gutes Stichwort. Ich wollte im Hinblick auf Dieser Junge. Digital Toes. unbedingt noch darauf zu sprechen kommen. Geschrieben wurde das eBook (bzw. seine Teile) von 2004 bis 2017, kompiliert wurde und erschienen ist es 2016. Klasse. Es gibt da also eine Beweglichkeit im Crausswerk. Die Texte sind nicht ein für alle mal an ihren ursprünglichen Publikationsort gebunden. Ich mag das persönlich sehr, wenn Autoren ihr Schreiben als offenes System verstehen und ihre (auch bereits publizierten) Texte als Material ansehen, das sich auch nach dem Abruck mehrfach bearbeiten lässt, vom Recycling bis zur Veredelung.
Außerdem besteht dieses eBook nicht nur aus Lyrik, sondern auch aus Prosa und einem Essay, in dem die eingestreute Lyrik wiederum nicht nur Illustrationsfunktion hat. Wir müssen uns diesen Jungen in jeder Hinsicht als open mind(ed) vorstellen, aufgeschlossen, freigeistig.
Und als ob das alles nicht schon genug offene Kompilation wäre, gibt es auch noch ein Nachwort von Matthias Fallenstein, das nicht, wie sonst bei Nachworten üblich, das letzte Wort ist. Die Anordnung der Teile dieser Sammlung stellt vielmehr eine Kommunikationssituation dar. Sie liest sich: 1. Teil: Crausstexte, 2. Teil: Fallensteinnachwort, 3. Teil: Craussessay. Die Krönung wären Remixe und Coverversionen der Crausstexte von anderen Dichtern. (Crauss selbst hat so etwas früher öfter gemacht. Ich finde, Dichterkollegen könnten einander wieder mehr covern und remixen.)
Möglicherweise schweife ich gerade etwas von der eigentlichen Diskussion ab. Verzeiht. Aber wir haben ja zwei Spalten, um uns auch nachträglich noch zu sortieren. Zudem scheint mir dieser Einblick in „Wie funktioniert diese eBook-Publikation eigentlich?“ nicht unwichtig/uninteressant. Denn so sehr ich Crauss' offenes Schreib- und Kompilationssystem auch mag – mit dem eBook werde ich mich wohl nicht so recht anfreunden können. Das liegt im Wesentlichen an drei Dingen, die ich nur kurz skizziere. Vielleicht können wir das ein oder andere noch diskutieren, ohne uns allzu weit vom eigentlichen Craussbuch zu entfernen.
-
Ich mag eBooks an sich nicht. Ich habe es mehrfach versucht und getan und lese lieber im Buch. Dort kann ich Fähnchen einkleben, Notizzettel vergessen und Bleistiftspitzen abbrechen. Ich kann ein Buch auf meine Art lesen, es mit meinen Gedanken erweitern. (Geschmackssache, ich weiß.)
-
Dass Craussbuch wurde bewusst nur als eBook publiziert, würde aber als Buch genauso, d.h. exakt in der gleichen Weise funktionieren. Inklusive des LyriCodes® (Martin hat ihn zitiert.), der aber, obwohl zu beginn des eBooks eingeführt, auf die Texte gar nicht angewendet wird. Von den Zeichen für Flattersatz, Blocktext und Zeilenumbruch mal abgesehen. Ich verstehe also die „eBook-Exklusivität“ dieser Publikation nicht so recht – falls sie überhaupt intendiert ist.
-
Ich verstehe den LyriCode® nicht. Das heißt, ich kann ihn schon lesen. So schwer ist er nicht. Was ich nicht verstehe ist, wozu man ihn braucht. Er soll ja nicht nur Zeilenumbrüche und neue Strophen markieren, um das Gedicht zu einer angemessenen Darstellung im eBook zu verhelfen. Er verfügt auch über Betonungszeichen (betont, schnell, langsam, hohe Stimme, tiefe Stimme), die ich als Leser schlichtweg nicht brauche, eigentlich gar nicht haben will, weil sie die Offenheit eines Gedichts, die individuelle Leseweise eines Gedichtes einschränkt oder zumindest lenkt.
Diskussion
Kommentare
Text, Interface, Aufführung

[Da unser Mitautor kurz pausiert, springe ich mal ein.]
Lieber Mario, da geht es uns beiden in manchem ähnlich. Offenheit – die Chance des Textes, sich zu entwickeln, auch in der Lektüre, Stichwort "Nachreife", nämlich "Nachreife auch der festgelegten Worte". (cf. Walter Benjamins berühmten Text hierzu..!) Ich bin aber nicht der Meinung, daß für diese Nachreife der Autor zuständig ist, fast ist überspitzt gesagt das Gegenteil der Fall, darum sollen auch Dichter nicht sich, sondern "Dichterkollegen [...] einander [...] covern und remixen". Aber dazu bedarf es der Loslösung, der Text, der nach Belieben geändert wird, erlaubt nur mehr bedingt das EInklinken, unterwirft ihn dem Autor, dem der Text aber nur bedingt "gehört". Darum bin ich da zögerlich, den Wandel des Texts durch den Autoren einfach nur gut zu finden ... das ist auch mein Problem mit Textformaten, die derlei nahelegen.
Zum eBook ferner: Ja, Fähnchen einzukleben gehört fast zum Lesen, es ist schon ein verdammt gutes Interface, das klassische Buch, davon einmal abgesehen, daß es Medienrevolutionen stets gut überstand, wo sonst mit dem Lesegerät manches Buch und manche Tonaufnahme (etc. pp) verschwand. Die Stärken des eBooks: Suchfunktionen bei Textcorpora vielleicht, aber so voluminös ist Crauss' Band ja nicht. Und man kann eine Bibliothek ins Krankenhaus mitnehmen, wie mir eine ältere Autorin sagte, das sind ja mal Aussichten.
Den LyriCode® finde ich als Hilfe für den Dichter vielleicht brauchbar, wie Skansionen, aber die werden nicht zwingend einem Buch beigegeben, man liest sie "sowieso", während man liest, oder eben nicht. Weil man Odenstropen erkennt, oder eben nicht. Das könnte hier ähnlich sein, weshalb mir die Lösung, zumal DIESE, prätentiös erscheint, Aufführungsanweisungen beizufügen, die zugleich etwas Grobschlächtiges haben. Nuancenreiche Poesie, aber: hell/dunkel, laut/leise ... "die ich als Leser schlichtweg nicht brauche, eigentlich gar nicht haben will", das geht mir ähnlich, aber nicht nur der Leserlenkung wegen, so stark bin ich, daß ich versuchsweise Texte gegen den Strich lesen kann, sondern weil auch das nicht möglich ist, beide Systeme laufen nebeneinander manchmal spannungslos her.
Jetzt haben wir Zeit gewonnen, können das besprechen ... oder uns fragen, ob der Text nun gut oder schlecht ist; und ob das Layout das verunklärt bzw. dem Text nutzt oder schadet.
Diskussion
Kommentare
adlernest
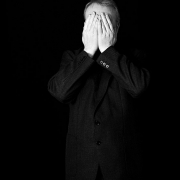
ich möchte auf Marios frühere forderung zurückkommen und mich auf ein close reading freuen, statt allzu ausgiebig über einen lyricode zu diskutieren, der ja nicht ausschliesslich für DIESER JUNGE erfunden wurde - was erklärt, dass mehr kodierungen in ihm enthalten sind als für das Craussbuch notwendig sind. tatsächlich mache ich an keiner stelle im buch anweisungen, wie ein text zu lesen wäre. Lea Schneider tut dies aber in ihrem "O0" sehr wohl. dort sind die betonungszeichen nicht nur leseanweisungen, sondern mehr, sie sind textelement. und das verlagshaus war bestrebt, den lyricode nicht jedesmal neu zu erfinden, sondern eine variante zu entwickeln, die auf viele zukünftige ebooks anwendbar bleibt. das wichtigste fürs Craussbuch: die markierung von pausen oder zeilenwechseln, wei man das im mittelalter bereits getan hat. lyrische texte aus platzersparnis ins fliessen zu bringen, bzw. im ebook: zu verhindern, dass das gedicht eine form annimmt, die durch verstellbare schriftart und -grösse ins beliebige driftet.
ganz gewiss hätte man den lyricode ans ende des buchs, als glossar setzen können. ganz gewiss hätte man ihn anders, konsequenter etc. umsetzen können. und mehr als gewiss sollte schreiben im digitalen medium von vornherein anders stattfinden als kompilierte texte für ein medium zu formatieren. die frage ist: wie kann ich mit den mehr oder minder neuen mitteln neue/eigene texte produzieren. wie, um Martins beispiel aufzugreifen, schaffe ich es, eine art fähnchen in/an die gedichte zu kleben, oder etwas zu generieren, das dem lesen mit bleistift, der notiz auf dem papier nahekommt. eine neue datei zu öffnen, um annotationen zu machen, ist keine option.
jetzt aber meine herren: hinein in die poesie, bevor die bübchen am weiher getrocknet, die sonne untergegangen und uns ganz kalt geworden ist. dem ebook gebe ich an dieser stelle ein fragmentiertes schmankerl hinzu, das eventuell lust macht darüber nachzudenken, wie stimmungen und motive über unterschiedliche texte und bücher hinweg wiederkehren. vielleicht macht es aber auch einfach bloss spass zu lesen. das könnte unter umständen genügen.
in der stadt ist es heiss, august, ich bin einmal wieder für eine weile hier, wohne für ein paar tage bei freunden in einem fidelen haus voll junger studentinnen. es riecht nach duftkerzen, gemeinsamem kochen, kippen, bunten likören und nur selten nach dem besuch, den die mädchen kriegen. sie sind fleissig, gehen früh zu bett, weshalb ich ebenfalls ruhige abende habe oder spät ausgehe. wenn ich nicht unterwegs bin, lege ich letzte hand an die druckvorlage meines neuen und endlich vollendeten buchs. arbeite zwei, drei stunden daran, gehe dann doch noch hinunter und bummle den fluss entlang.
der fluss voller kleiner und grosser boote, die auf und ab schaukeln, einige einer, hin und wieder aber auch längere mit sechs oder acht jungen burschen, die trainieren; sehr belebende anblicke. wenn es zu dunkel ist, reicht die erinnerung an die nachmittage in den auen: eine zarte südliche brise, ein gemächliches gehen und schauen, verweilen, geniessen. bis sonnenuntergang, abendrotflucht, der gemaserte himmel, punkte am himmel, ein kreis, ein schwarzer kreis, ein pochen unter dem lid und alles gewimmel oranger und gelber und schwach ganz schwach grünlicher löcher. und etwas saugendes ist: entfernungen, die sich nun anders messen als tagsüber. schatten.dann nach hause, ein paar notizen, tagebuch, ein bier, vielleicht zwei. auf dem bett liegend, lustlos meist, ein wenig fernsehen und einnicken. da ich diesen vormittag hinkend ein, zwei stunden an etwas einsameren stellen des ufers entlangschlenderte und unter einer alten zeder sass, auf halbem wege den hügel hinauf und fadoborn in sichtweite, kamen viele junge menschen zusammen, um zu baden oder zu schwimmen, gruppen von burschen, zu zweit, zu dritt, ein paar ältere unter ihnen. ein eigentümliches kostümfest, später beinahe hundert badende, vertraulich miteinander, freundschaftlich. das lachen, die stimmen, die rufe, die erwiderungen — das springen und tauchen von dem grossen stützbalken des verfallenden anlegers. sie klettern hinauf, stehen schlange, nackt, rosig, mit bewegungen. sie posen, übertreffen sich gegenseitig, necken sich, fassen sich gegenseitig zwischen die beine, provozieren, es entbrennen handtuchgefechte, kurze, heftige kämpfe, die in lachanfällen münden oder ausgelassenen schubsereien, vorzeitigem sich ins wasser fallen lassen. ergib dich! ergib dich, du hund!
zu all dem die sonne, strahlend, die dunkelgrünen schatten der hügel auf der anderen seite, die bernsteinfarben rollenden wellen, die sich beim anschwappen ans ufer in einen transparenten tee verwandeln, das platschen der spielenden jungen beim eintauchen, das versprühen von glitzernden tropfen und die angenehme brise.manchmal, je nachdem wie der wind steht oder wie scheusslich es im korridor duftet, riecht, stinkt, treibt es mich später erneut hinaus. nach dem abendbrot siehst du keinen hund mehr auf der strasse. das bunte treiben vom tage ist längst verklungen, insbesondere die gegend am fluss zwischen den alten industrien schimmert in einem ungesunden grün. gefährlich, sagen die touristen, die sich hierher verirren. erregend, sagen die von einem guide angespornten. die phantasie wird beflügelt durch die thriller, die man zuletzt gesehen hat („so etwas gibts sonst nur in der bronx“) („bei uns wäre eine solche gegend nicht denkbar“); oder durch die sensationsmeldungen im kostenlos an der s-bahn verteilten boulevardblatt: das ist die gegend, wo du nach einbruch der dunkelheit nur noch schüsse und schreie hörst und knietief in blut watest. denn die wirklichkeit ist nicht, was wirklich ist. sie ist nicht die wahrnehmung des einzelnen, dem, was du tatsächlich siehst, riechst, der dampf auf der strasse oder jener, der dir später, im hinteren teil des "adlernests", in die nase steigt. es ist die zeit der verfallenden natur und individueller todesarten. und du hast dir vorgenommen, einen ganz eigenen tod zu sterben, deine unruhe, unrast abzutöten. warst du schon einmal hier? Fassbinder soll in dieser gegend einen film gedreht haben.
Diskussion
Kommentare
Closer to Crauss

Ich glaube, ich hatte gar kein close reading gefordert. Das war Martin. Oder doch ich? Ich könnte nachschauen, natürlich, aber warum nicht mehrere Wirklichkeiten zulassen? „denn die wirklichkeit ist nicht, was wirklich ist. sie ist nicht die wahrnehmung des einzelnen, dem, was du tatsächlich siehst, riechst...“ Dieses individuelle Moment ist es, was mir an der fragmentarischen Passage auffiel. Weniger ein Individualismus aus Abgrenzung, eher ein immer empfundenes Außenseitertum. Das „ich“ am Ufer und „ihr“ zusammen tobend im Wasser, im Fluß.
Bzgl. Wirklichkeit und Wiederkehr – „... wie stimmungen und motive über unterschiedliche texte und bücher hinweg wiederkehren.“
¬≈ der tag war heiss. ich sitze, die schreibmappe auf knien, ˇ nackt im pavillon. ein kahn kommt durch die weide in ˇ sicht. an
seiner ruderbank aus vollen kräften rudernd ein ˇ mann, den blick empor zur lichtdurchwirkten blauen ferne.
Lieber Crauss, warst du eigentlich mal in Buckow? Natürlich warst du dort. Mindestens im Gedicht. Und hast den jungen Männern beim Rudern zugesehen, die parallel an dir vorbeizogen? Ganz nah. Sie treffen d/sich im Unendlichen. Die Stimmung, die Sinnlichkeit, die Sehnsucht resultiert schon allein aus dem Sehen, „sehr belebende anblicke.“
Vom Schwimmen in Seen und Flüssen lese ich wiederkehrend in deinen Texten. Da will sich immer etwas, jemand abstoßen vom Ufer – nicht mitschwimmen, aber sich treiben lassen zwischen all den anderen, den zwei oder drei, den sechs oder acht jungen Burschen. Mädchen sind natürlich auch dabei. Natürlich! Ich lese deine Texte immer seltener als Texte des Begehrens, immer öfter als Texte über echte Freundschaften, die sich davon entkoppeln. Vielleicht ist das überhaupt ein zentraler Gedanke, wenn auch recht spät gefasst – der Fluss, das Wasser, das offene System. Die Suche nach einer Harmonie bei all der Orientierungslosigkeit. Martin ließ Leonard anklingen, den Größten, und er wusste es ebenso und vor ihm wussten es andere:
Things are going to slide, slide in all directions/ Won't be nothing/ Nothing you can measure anymore
... „und du hast dir vorgenommen … deine unruhe, unrast abzutöten. warst du schon einmal hier?“ Sehen wir uns in Buckow?
Diskussion
Kommentare
Fließen

Die Idee, das Lesen auch ein Gehen und Sammeln ist, gefällt mir, sie findet sich bei Celan, vielleicht gefällt sie mir darum noch mehr.
Zum Beispiel ans Ufer, wie Ihr vorschlagt, wo man "panta rhei" sagt. Und das Ufer ist auch nicht mehr so fest.
„Man kann nicht zweimal in denselben Fluß steigen, aber man kehrt an dasselbe Ufer zurück, und dies sogar dann, wenn man sich im Fluß, um mit ihm als demselben wenigstens für eine Zeit eins zu bleiben, hat treiben lassen."
Formuliert Hans Blumenberg. Ist das so?
Offenheit, Verflüssigung, wer sich verhärtet, der ist kein guter Leser.
... ich bin aus persönlichen Gründen in den nächsten Tagen offline, mögt Ihr weitermachen, bis ich wieder mit"mische"..?
Diskussion
Kommentare
Ich bin mit meinen Statements
der stare tag war heiss, im wolkenzopf herrscht nacht
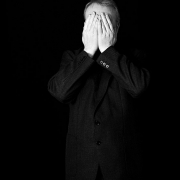
und so geschieht es mit dem ebook wie es mit einem konventionellen buch geschehen mag: man hat ein stückweit gelesen, lesezeichen gesetzt, fähnchen, sich vielleicht ein paar notizen gemacht - und legt es nun beiseite. vorerst ist man satt oder wird von anderem aufgehalten, begeistert. und dann? nach wochen, monaten, sieht man das buch auf dem lesetisch. es hat staub angesetzt. sieht man die epub-datei wieder, schlägt auf ("du schlägst die augen auf"), erinnert sich ("zurückspulen nachschauen, -sehen, ˇ ob man erinnert
erlebt oder träumt. alles, ˇ was geschieht, ist rauh und wild und aus- ˇ gelassen"), und vielleicht liest man neu, liest weiter.
oder man lässt es und geht lieber ein stückchen spazieren am buckower see. ich war noch nicht dort, aber ich kann mir - see oder fluss - vorstellen, dass man sich bei schwülem wetter nur allzu gern ins wasser fallen und treiben lässt. dabei gleitet man nicht zwangsläufig ans selbe, ans eigene ufer zurück, ganz gleich, was Blumenberg sagt und meint dazu. eventuell anlandet man gegenüber, ruht sich aus und sieht erst nach eienr weile, dass da jemand sitzt auf einem niedrigen stühlchen, einen stapel bücher neben sich, der beim geringsten bienenwind durcheinanderpurzelt: Hans Arp, Bernd Beißel, Bert Brecht (natürlich, Brecht, ist ja seine wiese), Matthäus von Collin, Franz Fosef Degenhard, Miguel Angel García Martínez, Hohann Wolfgang Goethe, Lioba Happel, Heine, Hesse, Hölderlin, Christine Huber, Friedrich Gottlieb Klopstock, Gottfried Kölwel, Dieter Krause, Jürgen Kühn, Günter Kunert, Reiner Kunze, Nikolaus Lenau, Hans Scherer, Georg Trakl & Katja Winkler.
und alle haben sie etwas zu sagen zu den männern im kahn, die sich von einem kind übers wasser rudern lassen. oder zum wolkenanprall, zum dräuenden gewitter.
Diskussion
Kommentare
ich möchte die zöpfe nicht
Tja, Blumenberg. Ich mag ihn,
Fixpoetry 2016
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung von Fixpoetry.com und der Urheber
Dieser Artikel ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Sie dürfen den Artikel jedoch gerne verlinken. Namentlich gekennzeichnete Beiträge geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.







Ihr Kommentar wurde erstellt.