Das Gedicht als unberührbarer Ort?

„„Verändert habe ich mich nicht, meine Grundsätze sind die gleichen geblieben, nur noch gefestigter, intensiver und vielleicht gereifter“, und: „Es sind die wenigsten geblieben und davon sind die wenigsten sich treu geblieben“. H. G. Adlers Gedichte mit ihrer drastischen Beschreibung des Schauerlichen reihen sich hier insofern ein, als eine spätere Kehrtwende hin zu einer Ästhetik „technischer Virtuosität“ davon zu zeugen scheint, sich gegen die Vereinnahmung des freien, reinen Geistes durch das materiell Grausame zur Wehr zu setzen, wie Jeremy Adler vermutet. Ein unsichtbarer, innerer, geistiger und unberührbarer Ort bietet somit den Raum, das „Gut-Sein zu bewahren“.“ Sandy Scheffler bespricht auf literaturkritik.de die „Heimat der Heimatlosen“.
Das Dreigestirn H. G. Adler, Elias Canetti und Franz Baermann Steiner gehört zu den interessantesten Exilgruppen der deutschen Nachkriegszeit. Sie schufen eine neue Form engagierter Dichtung, die zwischen Literatur und Politik agierte. Die prekäre Lage des Autors bildete die Basis des Selbstverständnis dieser drei, die es verstanden, trotz der Unterjochung, die sie erfuhren, die Gefahren der modernen Welt zu bannen. Man durchschaute das Grauen der Zeit. Man wehrte sich gegen die Attacken, welche das Jahrhundert mit sich brachte. Man war ausgeliefert. Man litt. Man verlor Identität und Heimat – und doch, man bediente sich der Sprache, um Grenzen auszuloten, Schrecken entgegenzuwirken und die Welt in neuer Form wiederherzustellen.
Jeremy Adler: Das bittere Brot. H.G. Adler, Elias Canetti und Franz Baermann Steiner im Londoner Exil. Wallstein Verlag, Göttingen 2015.
Hier ein interessanter Querverweis auf die Lesart zu einem „komplett anderen Licht“.


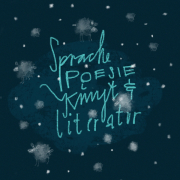

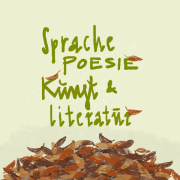
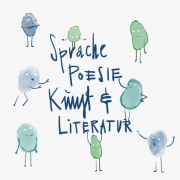
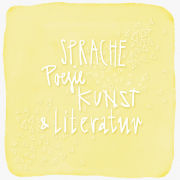
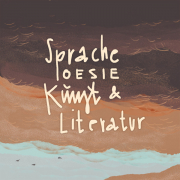
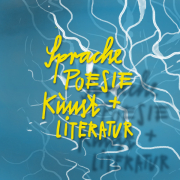
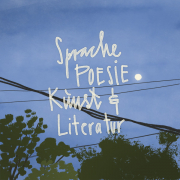
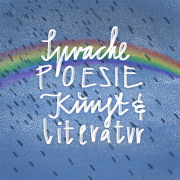
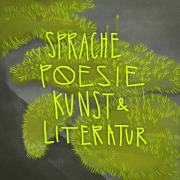
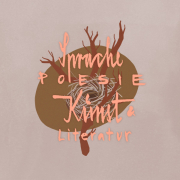
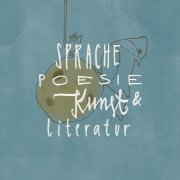
Neuen Kommentar schreiben